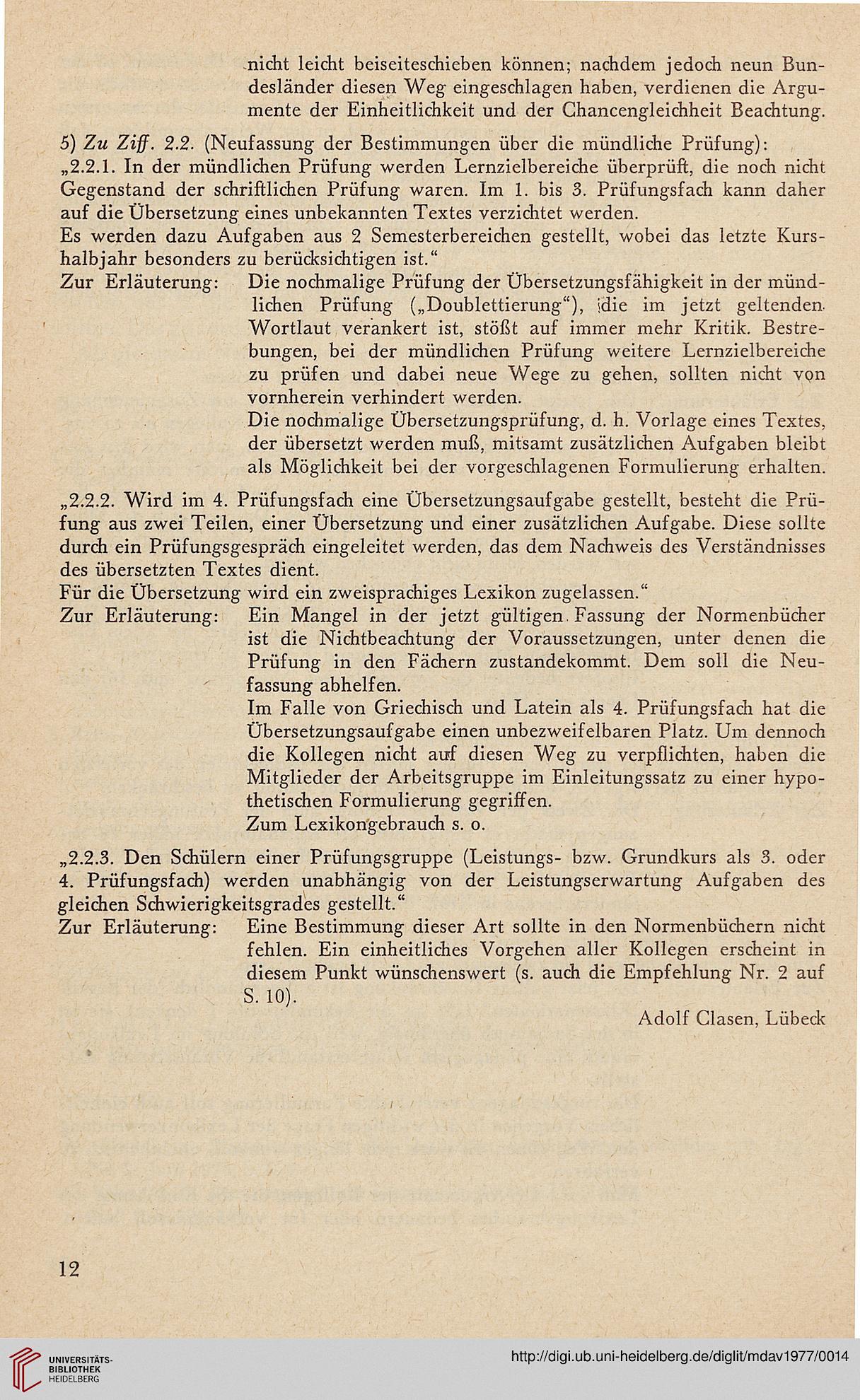nicht leicht beiseiteschieben können; nachdem jedoch neun Bun-
desländer diesen Weg eingeschlagen haben, verdienen die Argu-
mente der Einheitlichkeit und der Chancengleichheit Beachtung.
5) Zu Ziff. 2.2. (Neufassung der Bestimmungen über die mündliche Prüfung);
„2.2.1. In der mündlichen Prüfung werden Lernzielbereiche überprüft, die noch nicht
Gegenstand der schriftlichen Prüfung waren. Im 1. bis 3. Prüfungsfach kann daher
auf die Übersetzung eines unbekannten Textes verzichtet werden.
Es werden dazu Aufgaben aus 2 Semesterbereichen gestellt, wobei das letzte Kurs-
halbjahr besonders zu berücksichtigen ist.“
Zur Erläuterung: Die nochmalige Prüfung der Übersetzungsfähigkeit in der münd-
lichen Prüfung („Doublettierung“), idie im jetzt geltenden
Wortlaut verankert ist, stößt auf immer mehr Kritik. Bestre-
bungen, bei der mündlichen Prüfung weitere Lernzielbereiche
zu prüfen und dabei neue Wege zu gehen, sollten nicht VQn
vornherein verhindert werden.
Die nochmalige Übersetzungsprüfung, d. h. Vorlage eines Textes,
der übersetzt werden muß, mitsamt zusätzlichen Aufgaben bleibt
als Möglichkeit bei der vorgeschlagenen Formulierung erhalten.
„2.2.2. Wird im 4. Prüfungsfach eine Übersetzungsaufgabe gestellt, besteht die Prü-
fung aus zwei Teilen, einer Übersetzung und einer zusätzlichen Aufgabe. Diese sollte
durch ein Prüfungsgespräch eingeleitet werden, das dem Nachweis des Verständnisses
des übersetzten Textes dient.
Für die Übersetzung wird ein zweisprachiges Lexikon zugelassen.“
Zur Erläuterung: Ein Mangel in der jetzt gültigen . Fassung der Normenbücher
ist die Nichtbeachtung der Voraussetzungen, unter denen die
Prüfung in den Fächern zustandekommt. Dem soll die Neu-
fassung abhelfen.
Im Falle von Griechisch und Latein als 4. Prüfungsfach hat die
Übersetzungsaufgabe einen unbezweifelbaren Platz. Um dennoch
die Kollegen nicht auf diesen Weg zu verpflichten, haben die
Mitglieder der Arbeitsgruppe im Einleitungssatz zu einer hypo-
thetischen Formulierung gegriffen.
Zum Lexikongebrauch s. o.
„2.2.3. Den Schülern einer Prüfungsgruppe (Leistungs- bzw. Grundkurs als 3. oder
4. Prüfungsfach) werden unabhängig von der Leistungserwartung Aufgaben des
gleichen Schwierigkeitsgrades gestellt.“
Zur Erläuterung: Eine Bestimmung dieser Art sollte in den Normenbüchern nicht
fehlen. Ein einheitliches Vorgehen aller Kollegen erscheint in
diesem Punkt wünschenswert (s. auch die Empfehlung Nr. 2 auf
S. 10).
Adolf Clasen, Lübeck
12
desländer diesen Weg eingeschlagen haben, verdienen die Argu-
mente der Einheitlichkeit und der Chancengleichheit Beachtung.
5) Zu Ziff. 2.2. (Neufassung der Bestimmungen über die mündliche Prüfung);
„2.2.1. In der mündlichen Prüfung werden Lernzielbereiche überprüft, die noch nicht
Gegenstand der schriftlichen Prüfung waren. Im 1. bis 3. Prüfungsfach kann daher
auf die Übersetzung eines unbekannten Textes verzichtet werden.
Es werden dazu Aufgaben aus 2 Semesterbereichen gestellt, wobei das letzte Kurs-
halbjahr besonders zu berücksichtigen ist.“
Zur Erläuterung: Die nochmalige Prüfung der Übersetzungsfähigkeit in der münd-
lichen Prüfung („Doublettierung“), idie im jetzt geltenden
Wortlaut verankert ist, stößt auf immer mehr Kritik. Bestre-
bungen, bei der mündlichen Prüfung weitere Lernzielbereiche
zu prüfen und dabei neue Wege zu gehen, sollten nicht VQn
vornherein verhindert werden.
Die nochmalige Übersetzungsprüfung, d. h. Vorlage eines Textes,
der übersetzt werden muß, mitsamt zusätzlichen Aufgaben bleibt
als Möglichkeit bei der vorgeschlagenen Formulierung erhalten.
„2.2.2. Wird im 4. Prüfungsfach eine Übersetzungsaufgabe gestellt, besteht die Prü-
fung aus zwei Teilen, einer Übersetzung und einer zusätzlichen Aufgabe. Diese sollte
durch ein Prüfungsgespräch eingeleitet werden, das dem Nachweis des Verständnisses
des übersetzten Textes dient.
Für die Übersetzung wird ein zweisprachiges Lexikon zugelassen.“
Zur Erläuterung: Ein Mangel in der jetzt gültigen . Fassung der Normenbücher
ist die Nichtbeachtung der Voraussetzungen, unter denen die
Prüfung in den Fächern zustandekommt. Dem soll die Neu-
fassung abhelfen.
Im Falle von Griechisch und Latein als 4. Prüfungsfach hat die
Übersetzungsaufgabe einen unbezweifelbaren Platz. Um dennoch
die Kollegen nicht auf diesen Weg zu verpflichten, haben die
Mitglieder der Arbeitsgruppe im Einleitungssatz zu einer hypo-
thetischen Formulierung gegriffen.
Zum Lexikongebrauch s. o.
„2.2.3. Den Schülern einer Prüfungsgruppe (Leistungs- bzw. Grundkurs als 3. oder
4. Prüfungsfach) werden unabhängig von der Leistungserwartung Aufgaben des
gleichen Schwierigkeitsgrades gestellt.“
Zur Erläuterung: Eine Bestimmung dieser Art sollte in den Normenbüchern nicht
fehlen. Ein einheitliches Vorgehen aller Kollegen erscheint in
diesem Punkt wünschenswert (s. auch die Empfehlung Nr. 2 auf
S. 10).
Adolf Clasen, Lübeck
12