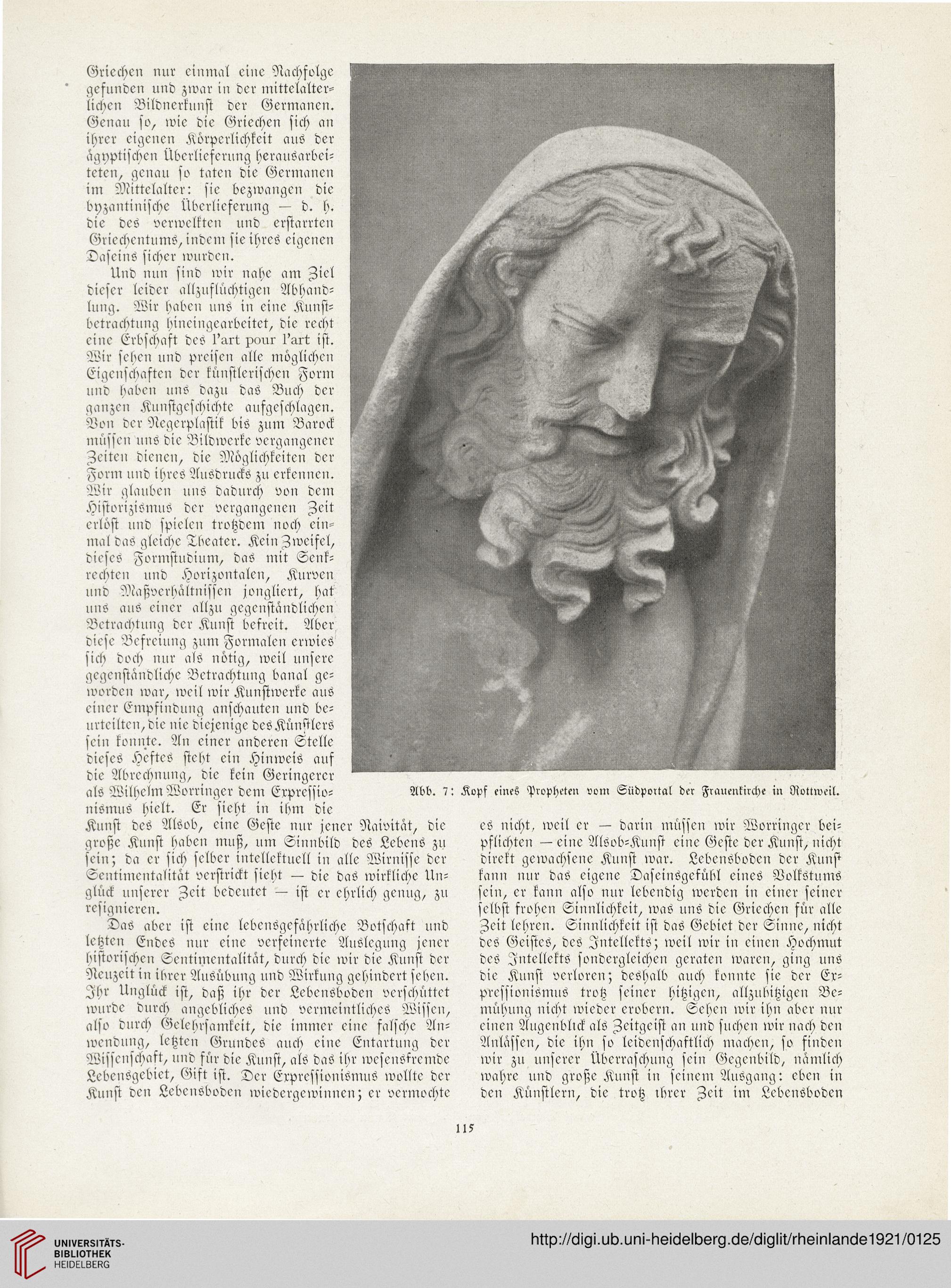Abb. 7: Kopf eines Propheten vom Südportal der Frauenkirche in Rottweil.
Griechen nur einmal eine Nachfolge
gefunden und zwar in der mittelalter-
lichen Bildnerkunst der Germanen.
Genau so, wie die Griechen sich an
ihrer eigenen Körperlichkeit aus der
ägyptischen Überlieferung herausarbei-
teten, genau so taten die Germanen
im Mittelalter: sie bezwangen die
byzantinische Überlieferung — d. h.
die des verwelkten und erstarrten
Griechentums, indem sie ihres eigenen
Daseins sicher wurden.
Und nun sind wir nahe am Ziel
dieser leider allzuflüchtigen Abhand¬
lung. Wir haben uns in eine Kunst-
betrachtung hineingearbeitet, die recht
eine Erbschaft des l'urt xour l'mt ist.
Wir sehen und preisen alle möglichen
Eigenschaften der künstlerischen Form
und haben uns dazu das Buch der
ganzen Kunstgeschichte aufgeschlagen.
Von der Negerplastik bis zum Barock
müssen uns die Bildwerke vergangener
Zeiten dienen, die Möglichkeiten der
Form und ihres Ausdrucks zu erkennen.
Wir glauben uns dadurch von dem
Historizismus der vergangenen Zeit
erlöst und spielen trotzdem noch ein-
mal das gleiche Theater. Kein Zweifel,
dieses Formstudium, das mit Senk-
rechten und Horizontalen, Kurven
und Maßvcrhältnisfcn jongliert, hat
uns aus einer allzu gegenständlichen
Betrachtung der Kunst befreit. Abep
diese Befreiung zum Formalen erwies'
sich doch nur als nötig, weil unsere
gegenständliche Betrachtung banal ge-
worden war, weil wir Kunstwerke aus
einer Empfindung anschauten und be-
urteilten, die nie diejenige des Künstlers
sein konnte. An einer anderen Stelle
dieses Heftes steht ein Hinweis auf
die Abrechnung, die kein Geringerer
als Wilhelm Worringer dem Expressio-
nismus hielt. Er sieht in ihm die
Kunst des Alsob, eine Geste nur jener Naivität, die
große Kunst haben muß, um Sinnbild des Lebens zu
sein; da er sich selber intellektuell in alle Wirnisse der
Sentimentalität verstrickt sieht — die das wirkliche Un-
glück unserer Zeit bedeutet — ist er ehrlich genug, zu
resignieren.
Das aber ist eine lebensgefährliche Botschaft und
letzten Endes nur eine verfeinerte Auslegung jener
historischen Sentimentalität, durch die wir die Kunst der
Neuzeit in ihrer Ausübung und Wirkung gehindert sehen.
Ihr Unglück ist, daß ihr der Lebensboden verschüttet
wurde durch angebliches und vermeintliches Wissen,
also durch Gelehrsamkeit, die immer eine falsche An-
wendung, letzten Grundes auch eine Entartung der
Wissenschaft, und für die Kunst, als das ihr wesensfremde
Lebensgebiet, Gift ist. Der Expressionismus wollte der
Kunst den Lebensboden wiedergewinnen; er vermochte
es nicht, weil er — darin müssen wir Worringer bei-
pflichten — eine Alsob-Kunst eine Geste der Kunst, nicht
direkt gewachsene Kunst war. Lebcnsboden der Kunst
kann nur das eigene Daseinsgesühl eines Volkstums
sein, er kann also nur lebendig werden in einer seiner
selbst frohen Sinnlichkeit, was uns die Griechen für alle
Zeit lehren. Sinnlichkeit ist das Gebiet der Sinne, nicht
des Geistes, des Intellekts; weil wir in einen Hochmut
des Intellekts sondergleichen geraten waren, ging uns
die Kunst verloren; deshalb auch konnte sie der Ex-
pressionismus trotz seiner hitzigen, allzuhitzigen Be-
mühung nicht wieder erobern. Sehen wir ihn aber nur
einen Augenblick als Zeitgeist an und suchen wir nach den
Anlässen, die ihn so leidenschaftlich machen, so finden
wir zu unserer Überraschung sein Gegenbild, nämlich
wahre und große Kunst in seinem Ausgang: eben in
den Künstlern, die trotz ihrer Zeit in: Lebcnsboden
Griechen nur einmal eine Nachfolge
gefunden und zwar in der mittelalter-
lichen Bildnerkunst der Germanen.
Genau so, wie die Griechen sich an
ihrer eigenen Körperlichkeit aus der
ägyptischen Überlieferung herausarbei-
teten, genau so taten die Germanen
im Mittelalter: sie bezwangen die
byzantinische Überlieferung — d. h.
die des verwelkten und erstarrten
Griechentums, indem sie ihres eigenen
Daseins sicher wurden.
Und nun sind wir nahe am Ziel
dieser leider allzuflüchtigen Abhand¬
lung. Wir haben uns in eine Kunst-
betrachtung hineingearbeitet, die recht
eine Erbschaft des l'urt xour l'mt ist.
Wir sehen und preisen alle möglichen
Eigenschaften der künstlerischen Form
und haben uns dazu das Buch der
ganzen Kunstgeschichte aufgeschlagen.
Von der Negerplastik bis zum Barock
müssen uns die Bildwerke vergangener
Zeiten dienen, die Möglichkeiten der
Form und ihres Ausdrucks zu erkennen.
Wir glauben uns dadurch von dem
Historizismus der vergangenen Zeit
erlöst und spielen trotzdem noch ein-
mal das gleiche Theater. Kein Zweifel,
dieses Formstudium, das mit Senk-
rechten und Horizontalen, Kurven
und Maßvcrhältnisfcn jongliert, hat
uns aus einer allzu gegenständlichen
Betrachtung der Kunst befreit. Abep
diese Befreiung zum Formalen erwies'
sich doch nur als nötig, weil unsere
gegenständliche Betrachtung banal ge-
worden war, weil wir Kunstwerke aus
einer Empfindung anschauten und be-
urteilten, die nie diejenige des Künstlers
sein konnte. An einer anderen Stelle
dieses Heftes steht ein Hinweis auf
die Abrechnung, die kein Geringerer
als Wilhelm Worringer dem Expressio-
nismus hielt. Er sieht in ihm die
Kunst des Alsob, eine Geste nur jener Naivität, die
große Kunst haben muß, um Sinnbild des Lebens zu
sein; da er sich selber intellektuell in alle Wirnisse der
Sentimentalität verstrickt sieht — die das wirkliche Un-
glück unserer Zeit bedeutet — ist er ehrlich genug, zu
resignieren.
Das aber ist eine lebensgefährliche Botschaft und
letzten Endes nur eine verfeinerte Auslegung jener
historischen Sentimentalität, durch die wir die Kunst der
Neuzeit in ihrer Ausübung und Wirkung gehindert sehen.
Ihr Unglück ist, daß ihr der Lebensboden verschüttet
wurde durch angebliches und vermeintliches Wissen,
also durch Gelehrsamkeit, die immer eine falsche An-
wendung, letzten Grundes auch eine Entartung der
Wissenschaft, und für die Kunst, als das ihr wesensfremde
Lebensgebiet, Gift ist. Der Expressionismus wollte der
Kunst den Lebensboden wiedergewinnen; er vermochte
es nicht, weil er — darin müssen wir Worringer bei-
pflichten — eine Alsob-Kunst eine Geste der Kunst, nicht
direkt gewachsene Kunst war. Lebcnsboden der Kunst
kann nur das eigene Daseinsgesühl eines Volkstums
sein, er kann also nur lebendig werden in einer seiner
selbst frohen Sinnlichkeit, was uns die Griechen für alle
Zeit lehren. Sinnlichkeit ist das Gebiet der Sinne, nicht
des Geistes, des Intellekts; weil wir in einen Hochmut
des Intellekts sondergleichen geraten waren, ging uns
die Kunst verloren; deshalb auch konnte sie der Ex-
pressionismus trotz seiner hitzigen, allzuhitzigen Be-
mühung nicht wieder erobern. Sehen wir ihn aber nur
einen Augenblick als Zeitgeist an und suchen wir nach den
Anlässen, die ihn so leidenschaftlich machen, so finden
wir zu unserer Überraschung sein Gegenbild, nämlich
wahre und große Kunst in seinem Ausgang: eben in
den Künstlern, die trotz ihrer Zeit in: Lebcnsboden