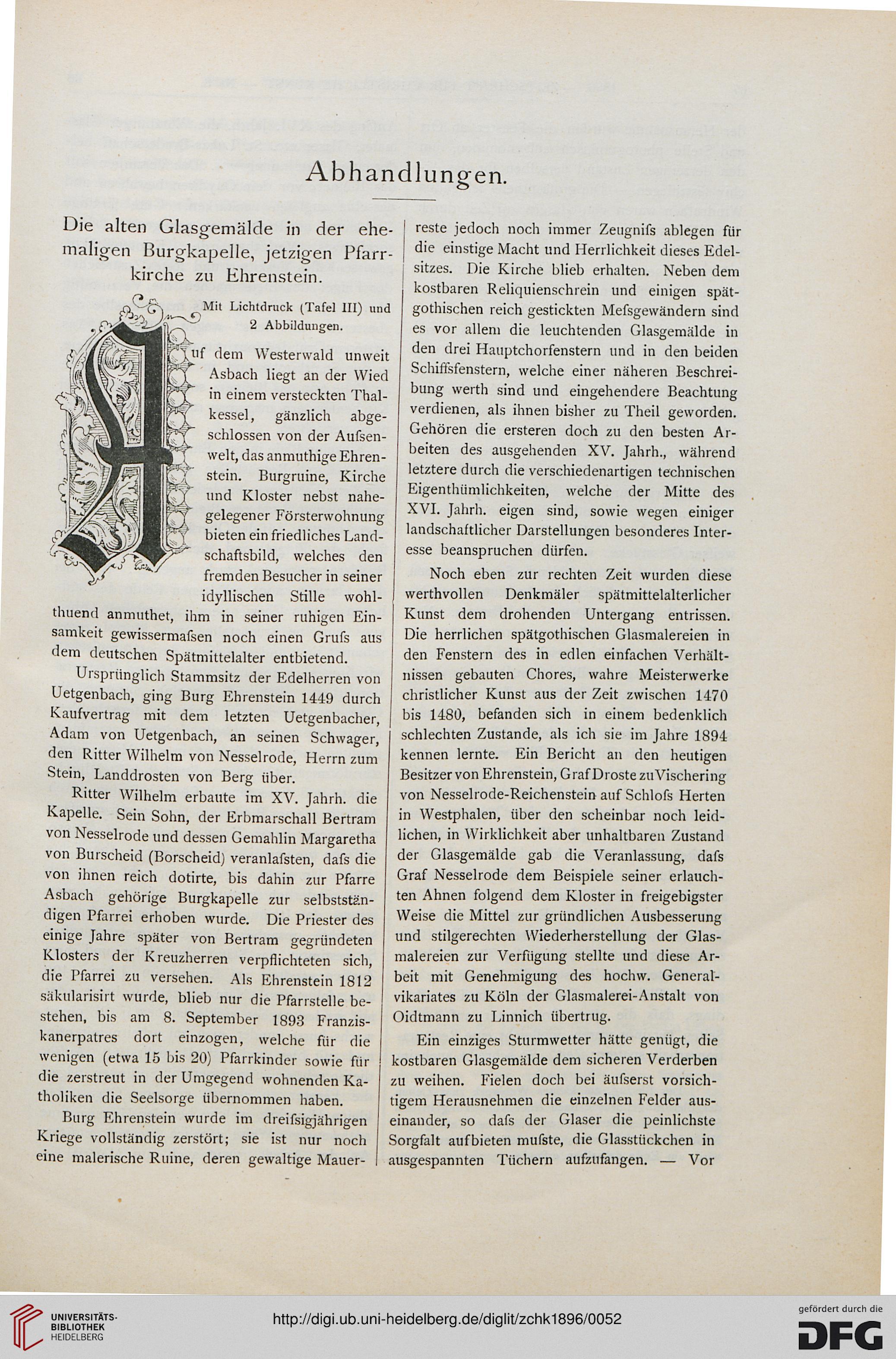Abhandlungen.
Die alten Glasgemälde in der ehe-
maligen Burgkapelle, jetzigen Pfarr-
kirche zu Ehrenstein.
Mit Lichtdruck (Tafel III) und
2 Abbildungen.
V
kuf dem Westerwald unweit
Asbach liegt an der Wied
in einem versteckten Thal-
kessel, gänzlich abge-
schlossen von der Aufsen-
welt, das anmuthige Ehren-
stein. Burgruine, Kirche
und Kloster nebst nahe-
gelegener Försterwohnung
bieten ein friedliches Land-
schaftsbild, welches den
fremden Besucher in seiner
idyllischen Stille wohl-
thuend anmuthet, ihm in seiner ruhigen Ein-
samkeit gewissermafsen noch einen Grafs aus
dem deutschen Spätmittelalter entbietend.
Ursprünglich Stammsitz der Edelherren von
Uetgenbach, ging Burg Ehrenstein 1449 durch
Kaufvertrag mit dem letzten Uetgenbacher,
Adam von Uetgenbach, an seinen Schwager,
den Ritter Wilhelm von Nessel rode, Herrn zum
Stein, Landdrosten von Berg über.
Ritter Wilhelm erbaute im XV. Jahrh. die
Kapelle. Sein Sohn, der Erbmarschall Bertram
von Nesselrode und dessen Gemahlin Margaretha
von Burscheid (Borscheid) veranlafsten, dafs die
von ihnen reich dotirte, bis dahin zur Pfarre
Asbach gehörige Burgkapelle zur selbststän-
digen Pfarrei erhoben wurde. Die Priester des
einige Jahre später von Bertram gegründeten
Klosters der Kreuzherren verpflichteten sich,
die Pfarrei zu versehen. Als Ehrenstein 1812
säkularisirt wurde, blieb nur die Pfarrstelle be-
stehen, bis am 8. September 1893 Franzis-
kanerpatres dort einzogen, welche für die
wenigen (etwa 15 bis 20) Pfarrkinder sowie für
die zerstreut in der Umgegend wohnenden Ka-
tholiken die Seelsorge übernommen haben.
Burg Ehrenstein wurde im dreifsigjährigen
Kriege vollständig zerstört; sie ist nur noch
eine malerische Ruine, deren gewaltige Mauer-
reste jedoch noch immer Zetignifs ablegen für
die einstige Macht und Herrlichkeit dieses Edel-
sitzes. Die Kirche blieb erhalten. Neben dem
kostbaren Reliquienschrein und einigen spät-
gothischen reich gestickten Mefsgewändern sind
es vor allem die leuchtenden Glasgemälde in
den drei Hauptchorfenstern und in den beiden
Schiffsfenstern, welche einer näheren Beschrei-
bung werth sind und eingehendere Beachtung
verdienen, als ihnen bisher zu Theil geworden.
Gehören die ersteren doch zu den besten Ar-
beiten des ausgehenden XV. Jahrh., während
letztere durch die verschiedenartigen technischen
Eigenthümlichkeiten, welche der Mitte des
XVI. Jahrh. eigen sind, sowie wegen einiger
landschaftlicher Darstellungen besonderes Inter-
esse beanspruchen dürfen.
Noch eben zur rechten Zeit wurden diese
werthvollen Denkmäler spätmittelalterlicher
Kunst dem drohenden Untergang entrissen.
Die herrlichen spätgothischen Glasmalereien in
den Fenstern des in edlen einfachen Verhält-
nissen gebauten Chores, wahre Meisterwerke
christlicher Kunst aus der Zeit zwischen 1470
bis 1480, befanden sich in einem bedenklich
schlechten Zustande, als ich sie im Jahre 1894
kennen lernte. Ein Bericht an den heutigen
Besitzer von Ehrenstein, GrafDrostezuVischering
von Nesselrode-Reichenstein auf Schlofs Herten
in Westphalen, über den scheinbar noch leid-
lichen, in Wirklichkeit aber unhaltbaren Zustand
der Glasgemälde gab die Veranlassung, dafs
Graf Nesselrode dem Beispiele seiner erlauch-
ten Ahnen folgend dem Kloster in freigebigster
Weise die Mittel zur gründlichen Ausbesserung
und stilgerechten Wiederherstellung der Glas-
malereien zur Verfügung stellte und diese Ar-
beit mit Genehmigung des hochw. General-
vikariates zu Köln der Glasmalerei-Anstalt von
Oidtmann zu Linnich übertrug.
Ein einziges Sturmwetter hätte genügt, die
kostbaren Glasgemälde dem sicheren Verderben
zu weihen. Fielen doch bei äufserst vorsich-
tigem Herausnehmen die einzelnen Felder aus-
einander, so dafs der Glaser die peinlichste
Sorgfalt aufbieten mufste, die Glasstückchen in
ausgespannten Tüchern aufzufangen. — Vor
Die alten Glasgemälde in der ehe-
maligen Burgkapelle, jetzigen Pfarr-
kirche zu Ehrenstein.
Mit Lichtdruck (Tafel III) und
2 Abbildungen.
V
kuf dem Westerwald unweit
Asbach liegt an der Wied
in einem versteckten Thal-
kessel, gänzlich abge-
schlossen von der Aufsen-
welt, das anmuthige Ehren-
stein. Burgruine, Kirche
und Kloster nebst nahe-
gelegener Försterwohnung
bieten ein friedliches Land-
schaftsbild, welches den
fremden Besucher in seiner
idyllischen Stille wohl-
thuend anmuthet, ihm in seiner ruhigen Ein-
samkeit gewissermafsen noch einen Grafs aus
dem deutschen Spätmittelalter entbietend.
Ursprünglich Stammsitz der Edelherren von
Uetgenbach, ging Burg Ehrenstein 1449 durch
Kaufvertrag mit dem letzten Uetgenbacher,
Adam von Uetgenbach, an seinen Schwager,
den Ritter Wilhelm von Nessel rode, Herrn zum
Stein, Landdrosten von Berg über.
Ritter Wilhelm erbaute im XV. Jahrh. die
Kapelle. Sein Sohn, der Erbmarschall Bertram
von Nesselrode und dessen Gemahlin Margaretha
von Burscheid (Borscheid) veranlafsten, dafs die
von ihnen reich dotirte, bis dahin zur Pfarre
Asbach gehörige Burgkapelle zur selbststän-
digen Pfarrei erhoben wurde. Die Priester des
einige Jahre später von Bertram gegründeten
Klosters der Kreuzherren verpflichteten sich,
die Pfarrei zu versehen. Als Ehrenstein 1812
säkularisirt wurde, blieb nur die Pfarrstelle be-
stehen, bis am 8. September 1893 Franzis-
kanerpatres dort einzogen, welche für die
wenigen (etwa 15 bis 20) Pfarrkinder sowie für
die zerstreut in der Umgegend wohnenden Ka-
tholiken die Seelsorge übernommen haben.
Burg Ehrenstein wurde im dreifsigjährigen
Kriege vollständig zerstört; sie ist nur noch
eine malerische Ruine, deren gewaltige Mauer-
reste jedoch noch immer Zetignifs ablegen für
die einstige Macht und Herrlichkeit dieses Edel-
sitzes. Die Kirche blieb erhalten. Neben dem
kostbaren Reliquienschrein und einigen spät-
gothischen reich gestickten Mefsgewändern sind
es vor allem die leuchtenden Glasgemälde in
den drei Hauptchorfenstern und in den beiden
Schiffsfenstern, welche einer näheren Beschrei-
bung werth sind und eingehendere Beachtung
verdienen, als ihnen bisher zu Theil geworden.
Gehören die ersteren doch zu den besten Ar-
beiten des ausgehenden XV. Jahrh., während
letztere durch die verschiedenartigen technischen
Eigenthümlichkeiten, welche der Mitte des
XVI. Jahrh. eigen sind, sowie wegen einiger
landschaftlicher Darstellungen besonderes Inter-
esse beanspruchen dürfen.
Noch eben zur rechten Zeit wurden diese
werthvollen Denkmäler spätmittelalterlicher
Kunst dem drohenden Untergang entrissen.
Die herrlichen spätgothischen Glasmalereien in
den Fenstern des in edlen einfachen Verhält-
nissen gebauten Chores, wahre Meisterwerke
christlicher Kunst aus der Zeit zwischen 1470
bis 1480, befanden sich in einem bedenklich
schlechten Zustande, als ich sie im Jahre 1894
kennen lernte. Ein Bericht an den heutigen
Besitzer von Ehrenstein, GrafDrostezuVischering
von Nesselrode-Reichenstein auf Schlofs Herten
in Westphalen, über den scheinbar noch leid-
lichen, in Wirklichkeit aber unhaltbaren Zustand
der Glasgemälde gab die Veranlassung, dafs
Graf Nesselrode dem Beispiele seiner erlauch-
ten Ahnen folgend dem Kloster in freigebigster
Weise die Mittel zur gründlichen Ausbesserung
und stilgerechten Wiederherstellung der Glas-
malereien zur Verfügung stellte und diese Ar-
beit mit Genehmigung des hochw. General-
vikariates zu Köln der Glasmalerei-Anstalt von
Oidtmann zu Linnich übertrug.
Ein einziges Sturmwetter hätte genügt, die
kostbaren Glasgemälde dem sicheren Verderben
zu weihen. Fielen doch bei äufserst vorsich-
tigem Herausnehmen die einzelnen Felder aus-
einander, so dafs der Glaser die peinlichste
Sorgfalt aufbieten mufste, die Glasstückchen in
ausgespannten Tüchern aufzufangen. — Vor