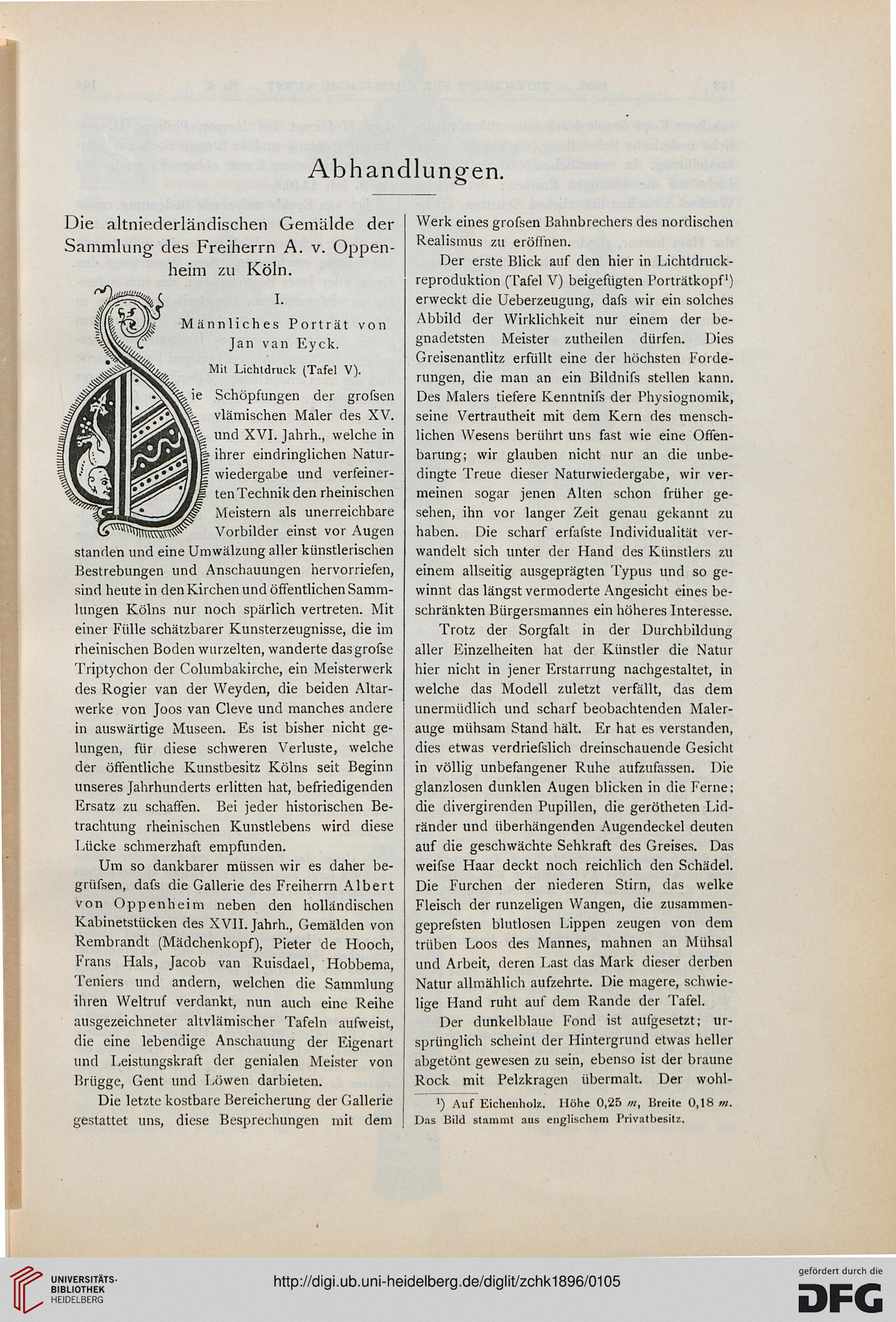Abhandlung-en.
Die altniederländischen Gemälde der
Sammlung' des Freiherrn A. v. Oppen-
heim zu Köln.
I.
innliches Porträt von
Jan van Eyck.
Mit Lichtdruck (Tafel V).
Schöpfungen der grofsen
vlämischen Maler des XV.
und XVI. Jahrh., welche in
ihrer eindringlichen Natur-
wiedergabe und verfeiner-
ten Technik den rheinischen
Meistern als unerreichbare
Vorbilder einst vor Augen
standen und eine Umwälzung aller künstlerischen
Bestrebungen und Anschauungen hervorriefen,
sind heute in den Kirchen und öffentlichen Samm-
lungen Kölns nur noch spärlich vertreten. Mit
einer Fülle schätzbarer Kunsterzeugnisse, die im
rheinischen Boden wurzelten, wanderte dasgrofse
Triptychon der Columbakirche, ein Meisterwerk
des Rogier van der Weyden, die beiden Altar-
werke von Joos van Cleve und manches andere
in auswärtige Museen. Es ist bisher nicht ge-
lungen, für diese schweren Verluste, welche
der öffentliche Kunstbesitz Kölns seit Beginn
unseres Jahrhunderts erlitten hat, befriedigenden
Ersatz zu schaffen. Bei jeder historischen Be-
trachtung rheinischen Kunstlebens wird diese
Lücke schmerzhaft empfunden.
Um so dankbarer müssen wir es daher be-
grüfsen, dafs die Gallerie des Freiherrn Albert
von Oppenheim neben den holländischen
Kabinetstücken des XVII. Jahrh., Gemälden von
Rembrandt (Mädchenkopf), Pieter de Hooch,
Frans Hals, Jacob van Ruisdael, Hobbema,
Temers und andern, welchen die Sammlung
ihren Weltruf verdankt, nun auch eine Reihe
ausgezeichneter altvlämischer Tafeln aufweist,
die eine lebendige Anschauung der Eigenart
und Leistungskraft der genialen Meister von
Brügge, Gent und Löwen darbieten.
Die letzte kostbare Bereicherung der Gallerie
gestattet uns, diese Besprechungen mit dem
Werk eines grofsen Bahnbrechers des nordischen
Realismus zu eröffnen.
Der erste Blick auf den hier in Lichtdruck-
reproduktion (Tafel V) beigefügten Porträtkopf1)
erweckt die Ueberzeugung, dafs wir ein solches
Abbild der Wirklichkeit nur einem der be-
gnadetsten Meister zutheilen dürfen. Dies
Greisenantlitz erfüllt eine der höchsten Forde-
rungen, die man an ein Bildnifs stellen kann.
Des Malers tiefere Kenntnifs der Physiognomik,
seine Vertrautheit mit dem Kern des mensch-
lichen Wesens berührt uns fast wie eine Offen-
barung; wir glauben nicht nur an die unbe-
dingte Treue dieser Naturwiedergabe, wir ver-
meinen sogar jenen Alten schon früher ge-
sehen, ihn vor langer Zeit genau gekannt zu
haben. Die scharf erfafste Individualität ver-
wandelt sich unter der Hand des Künstlers zu
einem allseitig ausgeprägten Typus und so ge-
winnt das längst vermoderte Angesicht eines be-
schränkten Bürgersmannes ein höheres Interesse.
Trotz der Sorgfalt in der Durchbildung
aller Einzelheiten hat der Künstler die Natur
hier nicht in jener Erstarrung nachgestaltet, in
welche das Modell zuletzt verfällt, das dem
unermüdlich und scharf beobachtenden Maler-
auge mühsam Stand hält. Er hat es verstanden,
dies etwas verdriefslich dreinschauende Gesicht
in völlig unbefangener Ruhe aufzufassen. Die
glanzlosen dunklen Augen blicken in die Ferne;
die divergirenden Pupillen, die gerötheten Lid-
ränder und überhängenden Augendeckel deuten
auf die geschwächte Sehkraft des Greises. Das
weifse Haar deckt noch reichlich den Schädel.
Die Furchen der niederen Stirn, das welke
Fleisch der runzeligen Wangen, die zusammen-
geprefsten blutlosen Lippen zeugen von dem
trüben Loos des Mannes, mahnen an Mühsal
und Arbeit, deren Last das Mark dieser derben
Natur allmählich aufzehrte. Die magere, schwie-
lige Hand ruht auf dem Rande der Tafel.
Der dunkelblaue Fond ist aufgesetzt; ur-
sprünglich scheint der Hintergrund etwas heller
abgetönt gewesen zu sein, ebenso ist der braune
Rock mit Pelzkragen übermalt. Der wohl-
') Auf Eichenholz. Höhe 0,25 /«, Breite 0,18 m.
Das Bild stammt aus englischem Privatbesitz.
Die altniederländischen Gemälde der
Sammlung' des Freiherrn A. v. Oppen-
heim zu Köln.
I.
innliches Porträt von
Jan van Eyck.
Mit Lichtdruck (Tafel V).
Schöpfungen der grofsen
vlämischen Maler des XV.
und XVI. Jahrh., welche in
ihrer eindringlichen Natur-
wiedergabe und verfeiner-
ten Technik den rheinischen
Meistern als unerreichbare
Vorbilder einst vor Augen
standen und eine Umwälzung aller künstlerischen
Bestrebungen und Anschauungen hervorriefen,
sind heute in den Kirchen und öffentlichen Samm-
lungen Kölns nur noch spärlich vertreten. Mit
einer Fülle schätzbarer Kunsterzeugnisse, die im
rheinischen Boden wurzelten, wanderte dasgrofse
Triptychon der Columbakirche, ein Meisterwerk
des Rogier van der Weyden, die beiden Altar-
werke von Joos van Cleve und manches andere
in auswärtige Museen. Es ist bisher nicht ge-
lungen, für diese schweren Verluste, welche
der öffentliche Kunstbesitz Kölns seit Beginn
unseres Jahrhunderts erlitten hat, befriedigenden
Ersatz zu schaffen. Bei jeder historischen Be-
trachtung rheinischen Kunstlebens wird diese
Lücke schmerzhaft empfunden.
Um so dankbarer müssen wir es daher be-
grüfsen, dafs die Gallerie des Freiherrn Albert
von Oppenheim neben den holländischen
Kabinetstücken des XVII. Jahrh., Gemälden von
Rembrandt (Mädchenkopf), Pieter de Hooch,
Frans Hals, Jacob van Ruisdael, Hobbema,
Temers und andern, welchen die Sammlung
ihren Weltruf verdankt, nun auch eine Reihe
ausgezeichneter altvlämischer Tafeln aufweist,
die eine lebendige Anschauung der Eigenart
und Leistungskraft der genialen Meister von
Brügge, Gent und Löwen darbieten.
Die letzte kostbare Bereicherung der Gallerie
gestattet uns, diese Besprechungen mit dem
Werk eines grofsen Bahnbrechers des nordischen
Realismus zu eröffnen.
Der erste Blick auf den hier in Lichtdruck-
reproduktion (Tafel V) beigefügten Porträtkopf1)
erweckt die Ueberzeugung, dafs wir ein solches
Abbild der Wirklichkeit nur einem der be-
gnadetsten Meister zutheilen dürfen. Dies
Greisenantlitz erfüllt eine der höchsten Forde-
rungen, die man an ein Bildnifs stellen kann.
Des Malers tiefere Kenntnifs der Physiognomik,
seine Vertrautheit mit dem Kern des mensch-
lichen Wesens berührt uns fast wie eine Offen-
barung; wir glauben nicht nur an die unbe-
dingte Treue dieser Naturwiedergabe, wir ver-
meinen sogar jenen Alten schon früher ge-
sehen, ihn vor langer Zeit genau gekannt zu
haben. Die scharf erfafste Individualität ver-
wandelt sich unter der Hand des Künstlers zu
einem allseitig ausgeprägten Typus und so ge-
winnt das längst vermoderte Angesicht eines be-
schränkten Bürgersmannes ein höheres Interesse.
Trotz der Sorgfalt in der Durchbildung
aller Einzelheiten hat der Künstler die Natur
hier nicht in jener Erstarrung nachgestaltet, in
welche das Modell zuletzt verfällt, das dem
unermüdlich und scharf beobachtenden Maler-
auge mühsam Stand hält. Er hat es verstanden,
dies etwas verdriefslich dreinschauende Gesicht
in völlig unbefangener Ruhe aufzufassen. Die
glanzlosen dunklen Augen blicken in die Ferne;
die divergirenden Pupillen, die gerötheten Lid-
ränder und überhängenden Augendeckel deuten
auf die geschwächte Sehkraft des Greises. Das
weifse Haar deckt noch reichlich den Schädel.
Die Furchen der niederen Stirn, das welke
Fleisch der runzeligen Wangen, die zusammen-
geprefsten blutlosen Lippen zeugen von dem
trüben Loos des Mannes, mahnen an Mühsal
und Arbeit, deren Last das Mark dieser derben
Natur allmählich aufzehrte. Die magere, schwie-
lige Hand ruht auf dem Rande der Tafel.
Der dunkelblaue Fond ist aufgesetzt; ur-
sprünglich scheint der Hintergrund etwas heller
abgetönt gewesen zu sein, ebenso ist der braune
Rock mit Pelzkragen übermalt. Der wohl-
') Auf Eichenholz. Höhe 0,25 /«, Breite 0,18 m.
Das Bild stammt aus englischem Privatbesitz.