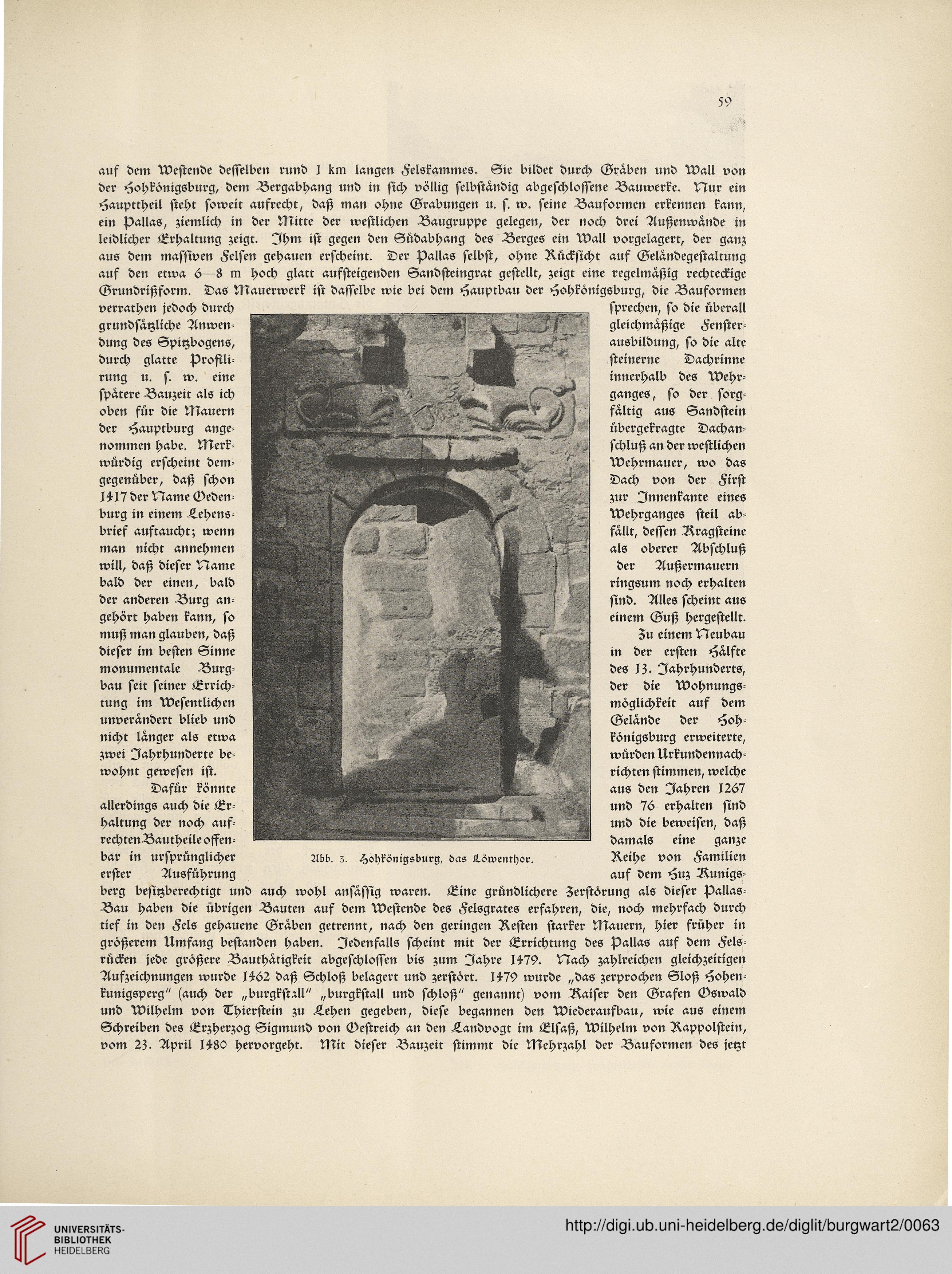59
auf dem Westeride dessewen rund 1 km langen Felskammes. Gie bildet durch Graben und Wall von
der Hohkönigsburg, dem Bergabhang und in sich völlig selbstandig abgeschlossene Bauwerke. V7ur ein
Haupttheil steht soweit aufrecht, daß man ohne Grabungen u. s. w. seine Bauformen erkennen kann,
ein Pallas, ziemlich in der Mitte der westlichen Baugruppe gelegen, der noch drei Außenwande in
leidlicher Erhaltung zeigt. Ihm ist gegen den Güdabhang des Berges ein Wall vorgelagert, der ganz
aus dem massiven Lelsen gehauen erscheint. Der s)allas selbst, ohne Rücksicht auf Gelandegestaltung
auf den etwa 6—8 m hoch glatt aufsteigenden Gandsteingrat gestellt, zeigt eine regelmaßig rechteckige
Grundrißform. Das Mauerwerk ist dasselbe wie bei dem Hauptbau der Hohkönigsburg, die Vauformen
verrathen jedoch durch
grundsatzliche Anwen-
dung des Spitzbogens,
durch glatte Profili-
rung u. s. w. eine
spatere Bauzeit als ich
oben für die Mauern
der Hauptburg ange-
nommen habe. Merk
würdig erscheint dem-
gegenüber, daß schon
1417 der Vlame Geden
burg in einem Lehens-
brief auftaucht; wenn
inan nicht annehmen
will, daß dieser ^ame
bald der einen, bald
der anderen Burg an-
gehört haben kann, so
muß man glauben, daß
dieser im besten Ginne
monumenrale Burg-
bau seit seiner Errich-
tung Lm Wesentlichen
unverandert blieb und
nicht langer als etwa
zwei Iahrhunderte be-
wohnt gewesen ist.
Dafür könnce
allerdings auch die Er-
haltung der noch auf-
rechtenBautheile offen-
bar Ln ursprünglicher
erster Ausführung
Abb. z. Hohkönigsburg, das Löwenthor.
sprechen, so die überall
gleichmaßige Fenster-
ausbildung, so die alte
steinerne Dachrinne
Lnnerhalb des Wehr-
ganges, so der sorg-
faltig aus Sandstein
übergekragte Dachan-
schluß an der westlichen
wehrmauer, wo das
Dach von der First
zur Innenkante eines
Wehrganges steil ab-
fällt, dessen Rragsteine
als oberer Abschluß
der Außermauern
ringsum noch erhalten
sind. Alles scheint aus
einem Guß hergestellt.
Zu einem ^eubau
in der ersten Halfte
des 1Z. Iahrhunderts,
der die Wohnungs-
möglichkeit auf dem
Gelande der Hoh-
königsburg erweiterte,
würden Urkundennach-
richten stimmen, welche
aus den Iahren 1267
und 76 erhalten sind
und die beweisen, daß
damals eine ganze
Reihe von Familien
auf dem Huz Runigs-
berg besitzberechtigt und auch wohl ansassig waren. Eine gründlichere Zerstörung als dieser s)allas-
Bau haben die übrigen Bauten auf dem Westende des Felsgrates erfahren, die, noch mehrfach durch
tief in den Fels gehauene Graben getrennt, nach den geri»tgen Resten starker Mauern, hier früher Ln
größerem Umfang bestanden haben. Iedenfalls scheint mit der Errichtung des Pallas auf dem ^els
rücken jede größere Bauthatigkeit abgeschlossen bis zum Iahre 1479. )^ach zahlreichen gleichzeitigen
Aufzeichnungen wurde 1462 daß Schloß belagert und zerstört. 1479 wurde „das zerprochen Sloß Hohen-
kunigsperg" (auch der „burgkstall" „burgkstall und schloß" genannt) vom Raiser den Grafen Gswald
und Wilhelm von Thierstein zu Lehen gegeben, diese begannen den Wiederaufbau, wie aus einem
Gchreiben des Erzherzog Sigmund von Gestreich an den Landvogt im Elsaß, Wilhelm von Rappolstein,
vom 2Z. April 1489 hervorgeht. Mit dieser Bauzeit stimmt die Mehrzahl der Bauformen des jetzt
auf dem Westeride dessewen rund 1 km langen Felskammes. Gie bildet durch Graben und Wall von
der Hohkönigsburg, dem Bergabhang und in sich völlig selbstandig abgeschlossene Bauwerke. V7ur ein
Haupttheil steht soweit aufrecht, daß man ohne Grabungen u. s. w. seine Bauformen erkennen kann,
ein Pallas, ziemlich in der Mitte der westlichen Baugruppe gelegen, der noch drei Außenwande in
leidlicher Erhaltung zeigt. Ihm ist gegen den Güdabhang des Berges ein Wall vorgelagert, der ganz
aus dem massiven Lelsen gehauen erscheint. Der s)allas selbst, ohne Rücksicht auf Gelandegestaltung
auf den etwa 6—8 m hoch glatt aufsteigenden Gandsteingrat gestellt, zeigt eine regelmaßig rechteckige
Grundrißform. Das Mauerwerk ist dasselbe wie bei dem Hauptbau der Hohkönigsburg, die Vauformen
verrathen jedoch durch
grundsatzliche Anwen-
dung des Spitzbogens,
durch glatte Profili-
rung u. s. w. eine
spatere Bauzeit als ich
oben für die Mauern
der Hauptburg ange-
nommen habe. Merk
würdig erscheint dem-
gegenüber, daß schon
1417 der Vlame Geden
burg in einem Lehens-
brief auftaucht; wenn
inan nicht annehmen
will, daß dieser ^ame
bald der einen, bald
der anderen Burg an-
gehört haben kann, so
muß man glauben, daß
dieser im besten Ginne
monumenrale Burg-
bau seit seiner Errich-
tung Lm Wesentlichen
unverandert blieb und
nicht langer als etwa
zwei Iahrhunderte be-
wohnt gewesen ist.
Dafür könnce
allerdings auch die Er-
haltung der noch auf-
rechtenBautheile offen-
bar Ln ursprünglicher
erster Ausführung
Abb. z. Hohkönigsburg, das Löwenthor.
sprechen, so die überall
gleichmaßige Fenster-
ausbildung, so die alte
steinerne Dachrinne
Lnnerhalb des Wehr-
ganges, so der sorg-
faltig aus Sandstein
übergekragte Dachan-
schluß an der westlichen
wehrmauer, wo das
Dach von der First
zur Innenkante eines
Wehrganges steil ab-
fällt, dessen Rragsteine
als oberer Abschluß
der Außermauern
ringsum noch erhalten
sind. Alles scheint aus
einem Guß hergestellt.
Zu einem ^eubau
in der ersten Halfte
des 1Z. Iahrhunderts,
der die Wohnungs-
möglichkeit auf dem
Gelande der Hoh-
königsburg erweiterte,
würden Urkundennach-
richten stimmen, welche
aus den Iahren 1267
und 76 erhalten sind
und die beweisen, daß
damals eine ganze
Reihe von Familien
auf dem Huz Runigs-
berg besitzberechtigt und auch wohl ansassig waren. Eine gründlichere Zerstörung als dieser s)allas-
Bau haben die übrigen Bauten auf dem Westende des Felsgrates erfahren, die, noch mehrfach durch
tief in den Fels gehauene Graben getrennt, nach den geri»tgen Resten starker Mauern, hier früher Ln
größerem Umfang bestanden haben. Iedenfalls scheint mit der Errichtung des Pallas auf dem ^els
rücken jede größere Bauthatigkeit abgeschlossen bis zum Iahre 1479. )^ach zahlreichen gleichzeitigen
Aufzeichnungen wurde 1462 daß Schloß belagert und zerstört. 1479 wurde „das zerprochen Sloß Hohen-
kunigsperg" (auch der „burgkstall" „burgkstall und schloß" genannt) vom Raiser den Grafen Gswald
und Wilhelm von Thierstein zu Lehen gegeben, diese begannen den Wiederaufbau, wie aus einem
Gchreiben des Erzherzog Sigmund von Gestreich an den Landvogt im Elsaß, Wilhelm von Rappolstein,
vom 2Z. April 1489 hervorgeht. Mit dieser Bauzeit stimmt die Mehrzahl der Bauformen des jetzt