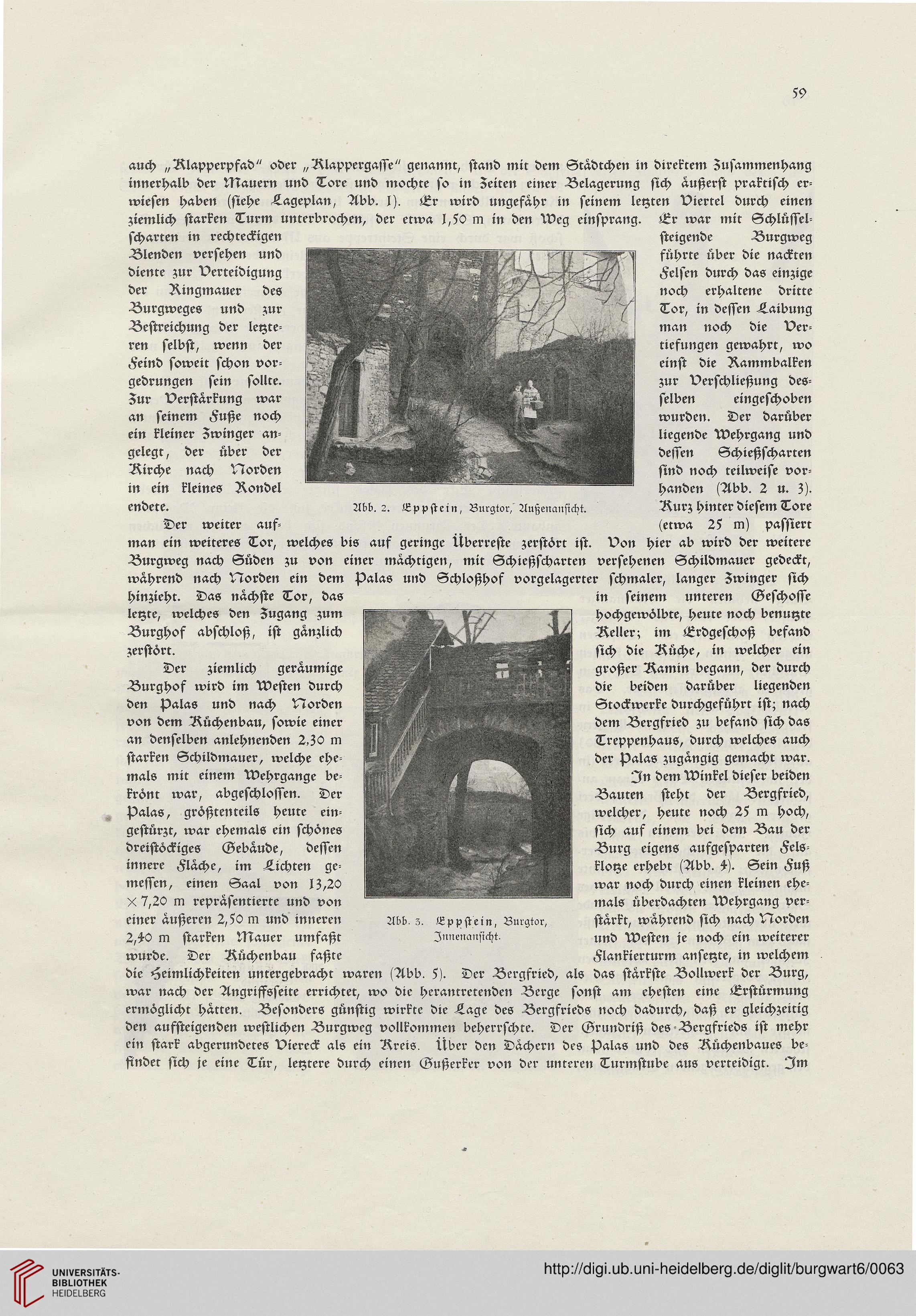59
auch „Rlapperpfad" oder „Rlappergasse" genanm, stand mit dem Scadtchen in direkcem Zusammenhang
innerhalb der Mauern und Tore und inochre so in Zeiten einer Belagerung ssch außerst prakcisch cr-
rviesen haben (ssehe Lageplan, Abb. l). Er rvird ungefahr in seinem leycen Viertel durch einen
ziemlich starken Turm unterbrochen, der ecwa 1,50 m in den weg einsprang. Er war inir Schlüssel-
scharten in rechreckigen
Blenden versehen und
dienre zur Verteidigung
der Ringmauer des
Burgweges und zur
Bcstreichung der letzte-
ren selbst, wenn der
Feind soweit schon vor-
gedrungen sein sollre.
Zur Verstarkung war
an seinem Fuße noch
ein kleiner Zwinger an-
gelegc, der über der
Rirche nach Norden
in ein kleines Rondel
endere.
Der weiter auf-
Abb. 2. Eppstcin, Burgtor, Außenansicht.
steigende Burgweg
führce über die nackren
Felsen durch das einzige
noch erssalcenc drirre
Tor, Ln dessen Eaibung
man noch die Ver-
riefungen gewahrr, wo
einst die Rammbalken
;ur Verschließung des-
selben eingeschoben
wurdcn. Der darüber
liegende Wehrgang und
dessen Gchießscharten
sind noch ceilweise vor-
handen sAbb. 2 u. Z).
Rurz lssncer diesem Tore
(erwa 25 m) passierr
man ein weiceres Tor, welches bis auf geringe Uberrestc zerstörr ist. 1?on hier ab wird der weitere
itzurgweg nach Süden zu von einer machtigen, mit Gchießscharren verseßenen Schildmauer gedeckt,
wahrend nach Norden ein dem Palas und Schloßßof vorgelagercer schmaler, langer Zwinger sich
hinzieht. Das nachste Tor, das
letzte, welches den Zugang zum
Burghof abschloß, ist ganzlich
zerstörr.
Der ziemlich geraumige
2Aurgl>of wird im Westen durch
den palas und nach Norden
von dem Rüchenbau, sowie einer
an densclben anleßnenden 2,ZS m
starken Gcbildinauer, welche ehe-
mals mit einem Wchrgange be-
krönc war, abgeschlossen. Der
palas, größrenteils heure ein-
gestürzt, war cheinals ein schönes
dreistöckiges Gebaude, desscn
innere Flache, im Eichten ge-
messen, einen Saal von IZ,20
X 7,2S m reprasentierte und von
einer außeren 2,52 m und inneren
2F2 m starken Mauer umfaßr
wurde. Der Rüchcnbau faßre
Abb. 3. Eppstein, Burgtor,
Iniiencinsicht.
in seinem unceren Geschosse
hochgewölbce, heure noch benutzte
Reller; im Erdgeschoß befand
sich die Rüche, in welcher ein
großer Ramin begann, der durch
die beiden darüber liegenden
Gcockwerkc durchgeführc ist; nach
dcm Bergfried ;u befand stch das
Treppenhaus, durch welches auch
der palas zugangig gemacht war.
In dem winkel dieser beiden
Bauren stehr der Bergfried,
welcher, heute noch 25 m hoch,
sich auf einem bei dem Bau der
Burg eigens aufgesparren Fels-
klotze erhebr (Abb. Z-). Gein Luß
war noch durch einen klcinen ehe-
mals überdachten wehrgang vcr-
starkr, wahrend sich nach Vlorden
und westen je noch ein weiterer
Llankierturm ansetzte, in welchem
die Heimlichkeitcn uncergebracht waren (Abb. 5). Der Bergfried, als das starkste Bollwerk der Burg,
war nach der Angriffsseite errichcet, wo die herantretenden Berge sonst am ehestcn eine Erstürmung
ermöglicht hatten. Besonders günstig wirkte die Eage des Bergfrieds noch dadurch, daß er gleichzeicig
den aufsteigenden westlichen Burgwcg vollkommen beherrschte. Der Grundriß des - Bergfrieds ist mehr
ein stark abgernndetes Viereck als ein Rreis. Über dcn Dachern des Palas und des Rüchenbaues be-
findec sich je eine Tür, letztcre durch einen Gußerker von der unteren Turmstnbe aus verteidigt. Im
auch „Rlapperpfad" oder „Rlappergasse" genanm, stand mit dem Scadtchen in direkcem Zusammenhang
innerhalb der Mauern und Tore und inochre so in Zeiten einer Belagerung ssch außerst prakcisch cr-
rviesen haben (ssehe Lageplan, Abb. l). Er rvird ungefahr in seinem leycen Viertel durch einen
ziemlich starken Turm unterbrochen, der ecwa 1,50 m in den weg einsprang. Er war inir Schlüssel-
scharten in rechreckigen
Blenden versehen und
dienre zur Verteidigung
der Ringmauer des
Burgweges und zur
Bcstreichung der letzte-
ren selbst, wenn der
Feind soweit schon vor-
gedrungen sein sollre.
Zur Verstarkung war
an seinem Fuße noch
ein kleiner Zwinger an-
gelegc, der über der
Rirche nach Norden
in ein kleines Rondel
endere.
Der weiter auf-
Abb. 2. Eppstcin, Burgtor, Außenansicht.
steigende Burgweg
führce über die nackren
Felsen durch das einzige
noch erssalcenc drirre
Tor, Ln dessen Eaibung
man noch die Ver-
riefungen gewahrr, wo
einst die Rammbalken
;ur Verschließung des-
selben eingeschoben
wurdcn. Der darüber
liegende Wehrgang und
dessen Gchießscharten
sind noch ceilweise vor-
handen sAbb. 2 u. Z).
Rurz lssncer diesem Tore
(erwa 25 m) passierr
man ein weiceres Tor, welches bis auf geringe Uberrestc zerstörr ist. 1?on hier ab wird der weitere
itzurgweg nach Süden zu von einer machtigen, mit Gchießscharren verseßenen Schildmauer gedeckt,
wahrend nach Norden ein dem Palas und Schloßßof vorgelagercer schmaler, langer Zwinger sich
hinzieht. Das nachste Tor, das
letzte, welches den Zugang zum
Burghof abschloß, ist ganzlich
zerstörr.
Der ziemlich geraumige
2Aurgl>of wird im Westen durch
den palas und nach Norden
von dem Rüchenbau, sowie einer
an densclben anleßnenden 2,ZS m
starken Gcbildinauer, welche ehe-
mals mit einem Wchrgange be-
krönc war, abgeschlossen. Der
palas, größrenteils heure ein-
gestürzt, war cheinals ein schönes
dreistöckiges Gebaude, desscn
innere Flache, im Eichten ge-
messen, einen Saal von IZ,20
X 7,2S m reprasentierte und von
einer außeren 2,52 m und inneren
2F2 m starken Mauer umfaßr
wurde. Der Rüchcnbau faßre
Abb. 3. Eppstein, Burgtor,
Iniiencinsicht.
in seinem unceren Geschosse
hochgewölbce, heure noch benutzte
Reller; im Erdgeschoß befand
sich die Rüche, in welcher ein
großer Ramin begann, der durch
die beiden darüber liegenden
Gcockwerkc durchgeführc ist; nach
dcm Bergfried ;u befand stch das
Treppenhaus, durch welches auch
der palas zugangig gemacht war.
In dem winkel dieser beiden
Bauren stehr der Bergfried,
welcher, heute noch 25 m hoch,
sich auf einem bei dem Bau der
Burg eigens aufgesparren Fels-
klotze erhebr (Abb. Z-). Gein Luß
war noch durch einen klcinen ehe-
mals überdachten wehrgang vcr-
starkr, wahrend sich nach Vlorden
und westen je noch ein weiterer
Llankierturm ansetzte, in welchem
die Heimlichkeitcn uncergebracht waren (Abb. 5). Der Bergfried, als das starkste Bollwerk der Burg,
war nach der Angriffsseite errichcet, wo die herantretenden Berge sonst am ehestcn eine Erstürmung
ermöglicht hatten. Besonders günstig wirkte die Eage des Bergfrieds noch dadurch, daß er gleichzeicig
den aufsteigenden westlichen Burgwcg vollkommen beherrschte. Der Grundriß des - Bergfrieds ist mehr
ein stark abgernndetes Viereck als ein Rreis. Über dcn Dachern des Palas und des Rüchenbaues be-
findec sich je eine Tür, letztcre durch einen Gußerker von der unteren Turmstnbe aus verteidigt. Im