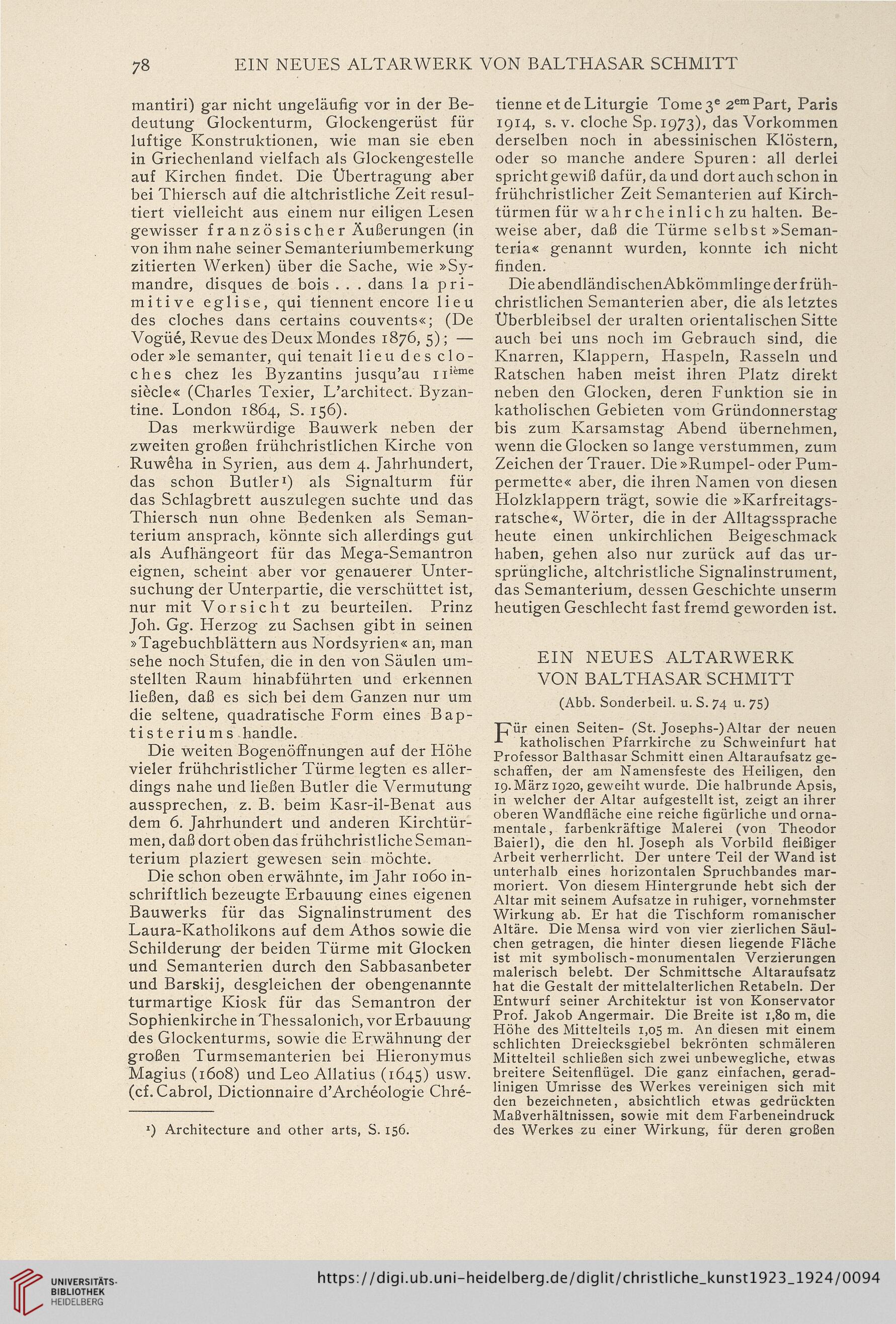78
EIN NEUES ALTARWERK VON BALTHASAR SCHMITT
mantiri) gar nicht ungeläufig vor in der Be-
deutung Glockenturm, Glockengerüst für
luftige Konstruktionen, wie man sie eben
in Griechenland vielfach als Glockengestelle
auf Kirchen findet. Die Übertragung aber
bei Thiersch auf die altchristliche Zeit resul-
tiert vielleicht aus einem nur eiligen Lesen
gewisser französischer Äußerungen (in
von ihm nahe seiner Semanteriumbemerkung
zitierten Werken) über die Sache, wie »Sy-
mandre, disques de bois . . . dans la pri-
mitive eglise, qui tiennent encore 1 ieu
des cloches dans certains couvents«; (De
Vogüe, Revue des Deux Mondes 1876, 5); —
oder »le semanter, qui tenait lieu des clo-
ches chez les Byzantins jusqu’au nI'me
siede« (Charles Texier, L’architect. Byzan-
tine. London 1864, S. 156).
Das merkwürdige Bauwerk neben der
zweiten großen frühchristlichen Kirche von
Ruweha in Syrien, aus dem 4. Jahrhundert,
das schon Butler1) als Signalturm für
das Schlagbrett auszulegen suchte und das
Thiersch nun ohne Bedenken als Seman-
terium ansprach, könnte sich allerdings gut
als Aufhängeort für das Mega-Semantron
eignen, scheint aber vor genauerer Unter-
suchung der Unterpartie, die verschüttet ist,
nur mit Vorsicht zu beurteilen. Prinz
Joh. Gg. Herzog zu Sachsen gibt in seinen
»Tagebuchblättern aus Nordsyrien« an, man
sehe noch Stufen, die in den von Säulen um-
stellten Raum hinabführten und erkennen
ließen, daß es sich bei dem Ganzen nur um
die seltene, quadratische Form eines Bap-
tisteriums handle.
Die weiten Bogenöffnungen auf der Höhe
vieler frühchristlicher Türme legten es aller-
dings nahe und ließen Butler die Vermutung
aussprechen, z. B. beim Kasr-il-Benat aus
dem 6. Jahrhundert und anderen Kirchtür-
men, daß dort oben das frühchristliche Seman-
terium plaziert gewesen sein möchte.
Die schon oben erwähnte, im Jahr 1060 in-
schriftlich bezeugte Erbauung eines eigenen
Bauwerks für das Signalinstrument des
Laura-Katholikons auf dem Athos sowie die
Schilderung der beiden Türme mit Glocken
und Semanterien durch den Sabbasanbeter
und Barskij, desgleichen der obengenannte
turmartige Kiosk für das Semantron der
Sophienkirche in Thessalonich, vor Erbauung
des Glockenturms, sowie die Erwähnung der
großen Turmsemanterien bei Hieronymus
Magius (1608) und Leo Allatius (1645) usw.
(cf. Cabrol, Dictionnaire d’Archeologie Chre-
9 Architecture and other arts, S. 156.
tienne et de Liturgie Tome 3e 2em Part, Paris
1914, s. v. cloche Sp. 1973), das Vorkommen
derselben noch in abessinischen Klöstern,
oder so manche andere Spuren: all derlei
spricht gewiß dafür, da und dort auch schon in
frühchristlicher Zeit Semanterien auf Kirch-
türmen für wahrcheinlichzu halten. Be-
weise aber, daß die Türme selbst »Seman-
teria« genannt wurden, konnte ich nicht
finden.
Die abendländischen Abkömmlinge der früh-
christlichen Semanterien aber, die als letztes
Überbleibsel der uralten orientalischen Sitte
auch bei uns noch im Gebrauch sind, die
Knarren, Klappern, Haspeln, Rasseln und
Ratschen haben meist ihren Platz direkt
neben den Glocken, deren Funktion sie in
katholischen Gebieten vom Gründonnerstag
bis zum Karsamstag Abend übernehmen,
wenn die Glocken so lange verstummen, zum
Zeichen der Trauer. Die »Rumpel- oder Pum-
permette« aber, die ihren Namen von diesen
Holzklappern trägt, sowie die »Karfreitags-
ratsche«, Wörter, die in der Alltagssprache
heute einen unkirchlichen Beigeschmack
haben, gehen also nur zurück auf das ur-
sprüngliche, altchristliche Signalinstrument,
das Semanterium, dessen Geschichte unserm
heutigen Geschlecht fast fremd geworden ist.
EIN NEUES ALTARWERK
VON BALTHASAR SCHMITT
(Abb. Sonderbeil. u. S. 74 u. 75)
I7ür einen Seiten- (St. Josephs-) Altar der neuen
katholischen Pfarrkirche zu Schweinfurt hat
Professor Balthasar Schmitt einen Altaraufsatz ge-
schaffen, der am Namensfeste des Heiligen, den
19. März 1920, geweiht wurde. Die halbrunde Apsis,
in welcher der Altar aufgestellt ist, zeigt an ihrer
oberen Wandfläche eine reiche figürliche und orna-
mentale , farbenkräftige Malerei (von Theodor
Baierl), die den hl. Joseph als Vorbild fleißiger
Arbeit verherrlicht. Der untere Teil der Wand ist
unterhalb eines horizontalen Spruchbandes mar-
moriert. Von diesem Hintergründe hebt sich der
Altar mit seinem Aufsatze in ruhiger, vornehmster
Wirkung ab. Er hat die Tischform romanischer
Altäre. Die Mensa wird von vier zierlichen Säul-
chen getragen, die hinter diesen liegende Fläche
ist mit symbolisch-monumentalen Verzierungen
malerisch belebt. Der Schmittsche Altaraufsatz
hat die Gestalt der mittelalterlichen Retabeln. Der
Entwurf seiner Architektur ist von Konservator
Prof. Jakob Angermair. Die Breite ist 1,80 m, die
Höhe des Mittelteils 1,05 m. An diesen mit einem
schlichten Dreiecksgiebel bekrönten schmäleren
Mittelteil schließen sich zwei unbewegliche, etwas
breitere Seitenflügel. Die ganz einfachen, gerad-
linigen Umrisse des Werkes vereinigen sich mit
den bezeichneten, absichtlich etwas gedrückten
Maßverhältnissen, sowie mit dem Farbeneindruck
des Werkes zu einer Wirkung, für deren großen
EIN NEUES ALTARWERK VON BALTHASAR SCHMITT
mantiri) gar nicht ungeläufig vor in der Be-
deutung Glockenturm, Glockengerüst für
luftige Konstruktionen, wie man sie eben
in Griechenland vielfach als Glockengestelle
auf Kirchen findet. Die Übertragung aber
bei Thiersch auf die altchristliche Zeit resul-
tiert vielleicht aus einem nur eiligen Lesen
gewisser französischer Äußerungen (in
von ihm nahe seiner Semanteriumbemerkung
zitierten Werken) über die Sache, wie »Sy-
mandre, disques de bois . . . dans la pri-
mitive eglise, qui tiennent encore 1 ieu
des cloches dans certains couvents«; (De
Vogüe, Revue des Deux Mondes 1876, 5); —
oder »le semanter, qui tenait lieu des clo-
ches chez les Byzantins jusqu’au nI'me
siede« (Charles Texier, L’architect. Byzan-
tine. London 1864, S. 156).
Das merkwürdige Bauwerk neben der
zweiten großen frühchristlichen Kirche von
Ruweha in Syrien, aus dem 4. Jahrhundert,
das schon Butler1) als Signalturm für
das Schlagbrett auszulegen suchte und das
Thiersch nun ohne Bedenken als Seman-
terium ansprach, könnte sich allerdings gut
als Aufhängeort für das Mega-Semantron
eignen, scheint aber vor genauerer Unter-
suchung der Unterpartie, die verschüttet ist,
nur mit Vorsicht zu beurteilen. Prinz
Joh. Gg. Herzog zu Sachsen gibt in seinen
»Tagebuchblättern aus Nordsyrien« an, man
sehe noch Stufen, die in den von Säulen um-
stellten Raum hinabführten und erkennen
ließen, daß es sich bei dem Ganzen nur um
die seltene, quadratische Form eines Bap-
tisteriums handle.
Die weiten Bogenöffnungen auf der Höhe
vieler frühchristlicher Türme legten es aller-
dings nahe und ließen Butler die Vermutung
aussprechen, z. B. beim Kasr-il-Benat aus
dem 6. Jahrhundert und anderen Kirchtür-
men, daß dort oben das frühchristliche Seman-
terium plaziert gewesen sein möchte.
Die schon oben erwähnte, im Jahr 1060 in-
schriftlich bezeugte Erbauung eines eigenen
Bauwerks für das Signalinstrument des
Laura-Katholikons auf dem Athos sowie die
Schilderung der beiden Türme mit Glocken
und Semanterien durch den Sabbasanbeter
und Barskij, desgleichen der obengenannte
turmartige Kiosk für das Semantron der
Sophienkirche in Thessalonich, vor Erbauung
des Glockenturms, sowie die Erwähnung der
großen Turmsemanterien bei Hieronymus
Magius (1608) und Leo Allatius (1645) usw.
(cf. Cabrol, Dictionnaire d’Archeologie Chre-
9 Architecture and other arts, S. 156.
tienne et de Liturgie Tome 3e 2em Part, Paris
1914, s. v. cloche Sp. 1973), das Vorkommen
derselben noch in abessinischen Klöstern,
oder so manche andere Spuren: all derlei
spricht gewiß dafür, da und dort auch schon in
frühchristlicher Zeit Semanterien auf Kirch-
türmen für wahrcheinlichzu halten. Be-
weise aber, daß die Türme selbst »Seman-
teria« genannt wurden, konnte ich nicht
finden.
Die abendländischen Abkömmlinge der früh-
christlichen Semanterien aber, die als letztes
Überbleibsel der uralten orientalischen Sitte
auch bei uns noch im Gebrauch sind, die
Knarren, Klappern, Haspeln, Rasseln und
Ratschen haben meist ihren Platz direkt
neben den Glocken, deren Funktion sie in
katholischen Gebieten vom Gründonnerstag
bis zum Karsamstag Abend übernehmen,
wenn die Glocken so lange verstummen, zum
Zeichen der Trauer. Die »Rumpel- oder Pum-
permette« aber, die ihren Namen von diesen
Holzklappern trägt, sowie die »Karfreitags-
ratsche«, Wörter, die in der Alltagssprache
heute einen unkirchlichen Beigeschmack
haben, gehen also nur zurück auf das ur-
sprüngliche, altchristliche Signalinstrument,
das Semanterium, dessen Geschichte unserm
heutigen Geschlecht fast fremd geworden ist.
EIN NEUES ALTARWERK
VON BALTHASAR SCHMITT
(Abb. Sonderbeil. u. S. 74 u. 75)
I7ür einen Seiten- (St. Josephs-) Altar der neuen
katholischen Pfarrkirche zu Schweinfurt hat
Professor Balthasar Schmitt einen Altaraufsatz ge-
schaffen, der am Namensfeste des Heiligen, den
19. März 1920, geweiht wurde. Die halbrunde Apsis,
in welcher der Altar aufgestellt ist, zeigt an ihrer
oberen Wandfläche eine reiche figürliche und orna-
mentale , farbenkräftige Malerei (von Theodor
Baierl), die den hl. Joseph als Vorbild fleißiger
Arbeit verherrlicht. Der untere Teil der Wand ist
unterhalb eines horizontalen Spruchbandes mar-
moriert. Von diesem Hintergründe hebt sich der
Altar mit seinem Aufsatze in ruhiger, vornehmster
Wirkung ab. Er hat die Tischform romanischer
Altäre. Die Mensa wird von vier zierlichen Säul-
chen getragen, die hinter diesen liegende Fläche
ist mit symbolisch-monumentalen Verzierungen
malerisch belebt. Der Schmittsche Altaraufsatz
hat die Gestalt der mittelalterlichen Retabeln. Der
Entwurf seiner Architektur ist von Konservator
Prof. Jakob Angermair. Die Breite ist 1,80 m, die
Höhe des Mittelteils 1,05 m. An diesen mit einem
schlichten Dreiecksgiebel bekrönten schmäleren
Mittelteil schließen sich zwei unbewegliche, etwas
breitere Seitenflügel. Die ganz einfachen, gerad-
linigen Umrisse des Werkes vereinigen sich mit
den bezeichneten, absichtlich etwas gedrückten
Maßverhältnissen, sowie mit dem Farbeneindruck
des Werkes zu einer Wirkung, für deren großen