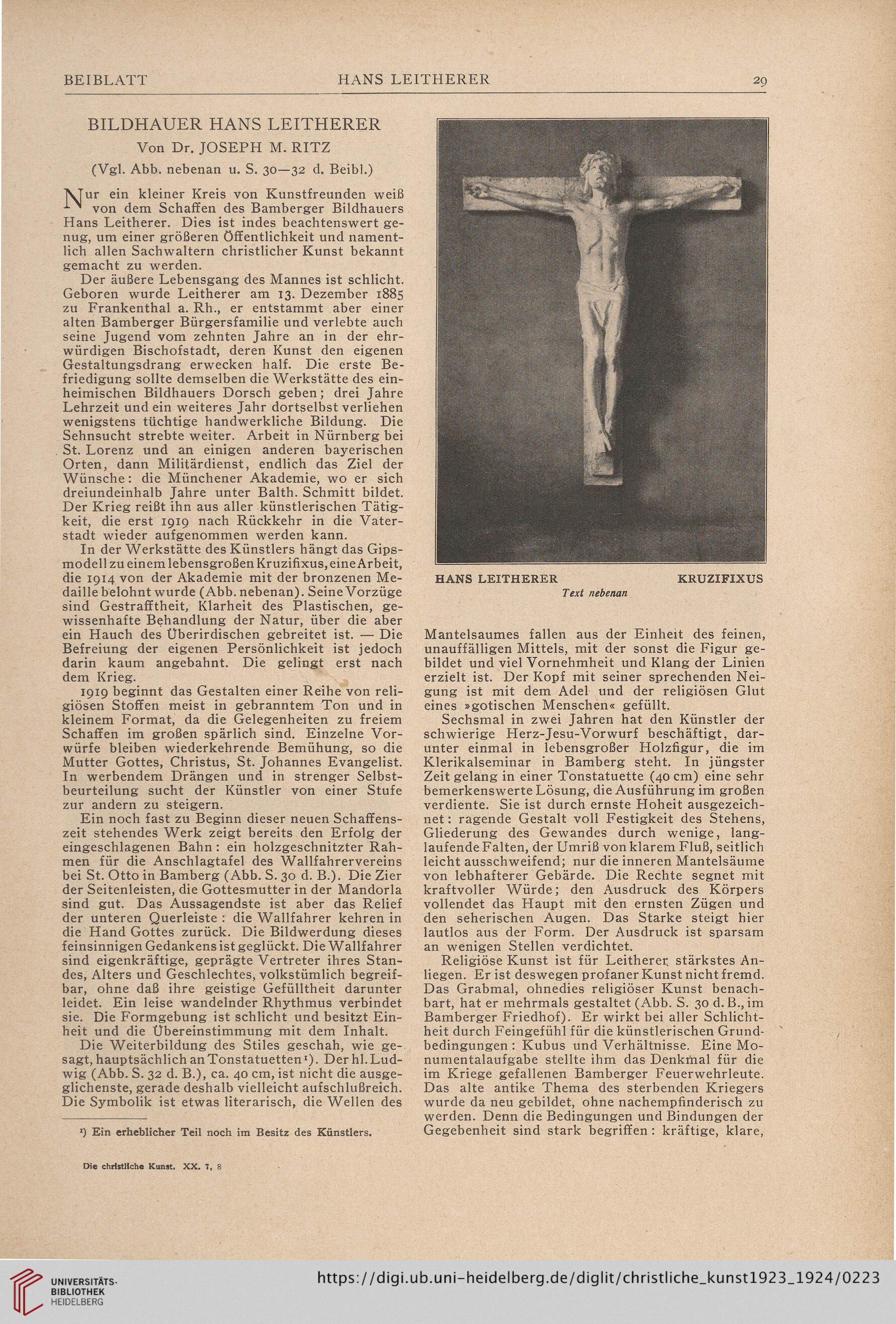BEIBLATT
HANS LEITHERER
29
BILDHAUER HANS LEITHERER
Von Dr. JOSEPH M. RITZ
(Vgl. Abb. nebenan u. S. 30—32 d. Beibl.)
NTur ein kleiner Kreis von Kunstfreunden weiß
von dem Schaffen des Bamberger Bildhauers
Hans Leitherer. Dies ist indes beachtenswert ge-
nug, um einer größeren Öffentlichkeit und nament-
lich allen Sachwaltern christlicher Kunst bekannt
gemacht zu werden.
Der äußere Lebensgang des Mannes ist schlicht.
Geboren wurde Leitherer am 13. Dezember 1885
zu Frankenthal a. Rh., er entstammt aber einer
alten Bamberger Bürgersfamilie und verlebte auch
seine Jugend vom zehnten Jahre an in der ehr-
würdigen Bischofstadt, deren Kunst den eigenen
Gestaltungsdrang erwecken half. Die erste Be-
friedigung sollte demselben die Werkstätte des ein-
heimischen Bildhauers Dorsch geben; drei Jahre
Lehrzeit und ein weiteres Jahr dortselbst verliehen
wenigstens tüchtige handwerkliche Bildung. Die
Sehnsucht strebte weiter. Arbeit in Nürnberg bei
St. Lorenz und an einigen anderen bayerischen
Orten, dann Militärdienst, endlich das Ziel der
Wünsche: die Münchener Akademie, wo er sich
dreiundeinhalb Jahre unter Balth. Schmitt bildet.
Der Krieg reißt ihn aus aller künstlerischen Tätig-
keit, die erst 1919 nach Rückkehr in die Vater-
stadt wieder aufgenommen werden kann.
In der Werkstätte des Künstlers hängt das Gips-
modell zu einem lebensgroßen Kruzifixus,eineArbeit,
die 1914 von der Akademie mit der bronzenen Me-
daille belohnt wurde (Abb. nebenan). Seine Vorzüge
sind Gestrafftheit, Klarheit des Plastischen, ge-
wissenhafte Behandlung der Natur, über die aber
ein Hauch des Überirdischen gebreitet ist. — Die
Befreiung der eigenen Persönlichkeit ist jedoch
darin kaum angebahnt. Die gelingt erst nach
dem Krieg.
1919 beginnt das Gestalten einer Reihe von reli-
giösen Stoffen meist in gebranntem Ton und in
kleinem Format, da die Gelegenheiten zu freiem
Schaffen im großen spärlich sind. Einzelne Vor-
würfe bleiben wiederkehrende Bemühung, so die
Mutter Gottes, Christus, St. Johannes Evangelist.
In werbendem Drängen und in strenger Selbst-
beurteilung sucht der Künstler von einer Stufe
zur andern zu steigern.
Ein noch fast zu Beginn dieser neuen Schaffens-
zeit stehendes Werk zeigt bereits den Erfolg der
eingeschlagenen Bahn : ein holzgeschnitzter Rah-
men für die Anschlagtafel des Wallfahrervereins
bei St. Otto in Bamberg (Abb. S. 30 d. B.). Die Zier
der Seitenleisten, die Gottesmutter in der Mandorla
sind gut. Das Aussagendste ist aber das Relief
der unteren Querleiste : die Wallfahrer kehren in
die Hand Gottes zurück. Die Bildwerdung dieses
feinsinnigen Gedankens ist geglückt. Die Wallfahrer
sind eigenkräftige, geprägte Vertreter ihres Stan-
des, Alters und Geschlechtes, volkstümlich begreif-
bar, ohne daß ihre geistige Gefülltheit darunter
leidet. Ein leise wandelnder Rhythmus verbindet
sie. Die Formgebung ist schlicht und besitzt Ein-
heit und die Übereinstimmung mit dem Inhalt.
Die Weiterbildung des Stiles geschah, wie ge-
sagt, hauptsächlich anTonstatuetten1)- Der hl. Lud-
wig (Abb. S. 32 d. B.), ca. 40 cm, ist nicht die ausge-
glichenste, gerade deshalb vielleicht aufschlußreich.
Die Symbolik ist etwas literarisch, die Wellen des
’) Ein erheblicher Teil noch im Besitz des Künstlers.
HANS LEITHERER KRUZIFIXUS
Text nebenan
Mantelsaumes fallen aus der Einheit des feinen,
unauffälligen Mittels, mit der sonst die Figur ge-
bildet und viel Vornehmheit und Klang der Linien
erzielt ist. Der Kopf mit seiner sprechenden Nei-
gung ist mit dem Adel und der religiösen Glut
eines »gotischen Menschen« gefüllt.
Sechsmal in zwei Jahren hat den Künstler der
schwierige Herz-Jesu-Vorwurf beschäftigt, dar-
unter einmal in lebensgroßer Holzfigur, die im
Klerikalseminar in Bamberg steht. In jüngster
Zeit gelang in einer Tonstatuette (40 cm) eine sehr
bemerkenswerte Lösung, die Ausführung im großen
verdiente. Sie ist durch ernste Hoheit ausgezeich-
net: ragende Gestalt voll Festigkeit des Stehens,
Gliederung des Gewandes durch wenige, lang-
laufende Falten, der Umriß von klarem Fluß, seitlich
leicht ausschweifend; nur die inneren Mantelsäume
von lebhafterer Gebärde. Die Rechte segnet mit
kraftvoller Würde; den Ausdruck des Körpers
vollendet das Haupt mit den ernsten Zügen und
den seherischen Augen. Das Starke steigt hier
lautlos aus der Form. Der Ausdruck ist sparsam
an wenigen Stellen verdichtet.
Religiöse Kunst ist für Leitherer stärkstes An-
liegen. Er ist deswegen profaner Kunst nicht fremd.
Das Grabmal, ohnedies religiöser Kunst benach-
bart, hat er mehrmals gestaltet (Abb. S. 30 d. B., im
Bamberger Friedhof). Er wirkt bei aller Schlicht-
heit durch Feingefühl für die künstlerischen Grund-
bedingungen : Kubus und Verhältnisse. Eine Mo-
numentalaufgabe stellte ihm das Denkmal für die
im Kriege gefallenen Bamberger Feuerwehrleute.
Das alte antike Thema des sterbenden Kriegers
wurde da neu gebildet, ohne nachempfinderisch zu
werden. Denn die Bedingungen und Bindungen der
Gegebenheit sind stark begriffen : kräftige, klare,
Die christliche Kunst. XX. 7, 8
HANS LEITHERER
29
BILDHAUER HANS LEITHERER
Von Dr. JOSEPH M. RITZ
(Vgl. Abb. nebenan u. S. 30—32 d. Beibl.)
NTur ein kleiner Kreis von Kunstfreunden weiß
von dem Schaffen des Bamberger Bildhauers
Hans Leitherer. Dies ist indes beachtenswert ge-
nug, um einer größeren Öffentlichkeit und nament-
lich allen Sachwaltern christlicher Kunst bekannt
gemacht zu werden.
Der äußere Lebensgang des Mannes ist schlicht.
Geboren wurde Leitherer am 13. Dezember 1885
zu Frankenthal a. Rh., er entstammt aber einer
alten Bamberger Bürgersfamilie und verlebte auch
seine Jugend vom zehnten Jahre an in der ehr-
würdigen Bischofstadt, deren Kunst den eigenen
Gestaltungsdrang erwecken half. Die erste Be-
friedigung sollte demselben die Werkstätte des ein-
heimischen Bildhauers Dorsch geben; drei Jahre
Lehrzeit und ein weiteres Jahr dortselbst verliehen
wenigstens tüchtige handwerkliche Bildung. Die
Sehnsucht strebte weiter. Arbeit in Nürnberg bei
St. Lorenz und an einigen anderen bayerischen
Orten, dann Militärdienst, endlich das Ziel der
Wünsche: die Münchener Akademie, wo er sich
dreiundeinhalb Jahre unter Balth. Schmitt bildet.
Der Krieg reißt ihn aus aller künstlerischen Tätig-
keit, die erst 1919 nach Rückkehr in die Vater-
stadt wieder aufgenommen werden kann.
In der Werkstätte des Künstlers hängt das Gips-
modell zu einem lebensgroßen Kruzifixus,eineArbeit,
die 1914 von der Akademie mit der bronzenen Me-
daille belohnt wurde (Abb. nebenan). Seine Vorzüge
sind Gestrafftheit, Klarheit des Plastischen, ge-
wissenhafte Behandlung der Natur, über die aber
ein Hauch des Überirdischen gebreitet ist. — Die
Befreiung der eigenen Persönlichkeit ist jedoch
darin kaum angebahnt. Die gelingt erst nach
dem Krieg.
1919 beginnt das Gestalten einer Reihe von reli-
giösen Stoffen meist in gebranntem Ton und in
kleinem Format, da die Gelegenheiten zu freiem
Schaffen im großen spärlich sind. Einzelne Vor-
würfe bleiben wiederkehrende Bemühung, so die
Mutter Gottes, Christus, St. Johannes Evangelist.
In werbendem Drängen und in strenger Selbst-
beurteilung sucht der Künstler von einer Stufe
zur andern zu steigern.
Ein noch fast zu Beginn dieser neuen Schaffens-
zeit stehendes Werk zeigt bereits den Erfolg der
eingeschlagenen Bahn : ein holzgeschnitzter Rah-
men für die Anschlagtafel des Wallfahrervereins
bei St. Otto in Bamberg (Abb. S. 30 d. B.). Die Zier
der Seitenleisten, die Gottesmutter in der Mandorla
sind gut. Das Aussagendste ist aber das Relief
der unteren Querleiste : die Wallfahrer kehren in
die Hand Gottes zurück. Die Bildwerdung dieses
feinsinnigen Gedankens ist geglückt. Die Wallfahrer
sind eigenkräftige, geprägte Vertreter ihres Stan-
des, Alters und Geschlechtes, volkstümlich begreif-
bar, ohne daß ihre geistige Gefülltheit darunter
leidet. Ein leise wandelnder Rhythmus verbindet
sie. Die Formgebung ist schlicht und besitzt Ein-
heit und die Übereinstimmung mit dem Inhalt.
Die Weiterbildung des Stiles geschah, wie ge-
sagt, hauptsächlich anTonstatuetten1)- Der hl. Lud-
wig (Abb. S. 32 d. B.), ca. 40 cm, ist nicht die ausge-
glichenste, gerade deshalb vielleicht aufschlußreich.
Die Symbolik ist etwas literarisch, die Wellen des
’) Ein erheblicher Teil noch im Besitz des Künstlers.
HANS LEITHERER KRUZIFIXUS
Text nebenan
Mantelsaumes fallen aus der Einheit des feinen,
unauffälligen Mittels, mit der sonst die Figur ge-
bildet und viel Vornehmheit und Klang der Linien
erzielt ist. Der Kopf mit seiner sprechenden Nei-
gung ist mit dem Adel und der religiösen Glut
eines »gotischen Menschen« gefüllt.
Sechsmal in zwei Jahren hat den Künstler der
schwierige Herz-Jesu-Vorwurf beschäftigt, dar-
unter einmal in lebensgroßer Holzfigur, die im
Klerikalseminar in Bamberg steht. In jüngster
Zeit gelang in einer Tonstatuette (40 cm) eine sehr
bemerkenswerte Lösung, die Ausführung im großen
verdiente. Sie ist durch ernste Hoheit ausgezeich-
net: ragende Gestalt voll Festigkeit des Stehens,
Gliederung des Gewandes durch wenige, lang-
laufende Falten, der Umriß von klarem Fluß, seitlich
leicht ausschweifend; nur die inneren Mantelsäume
von lebhafterer Gebärde. Die Rechte segnet mit
kraftvoller Würde; den Ausdruck des Körpers
vollendet das Haupt mit den ernsten Zügen und
den seherischen Augen. Das Starke steigt hier
lautlos aus der Form. Der Ausdruck ist sparsam
an wenigen Stellen verdichtet.
Religiöse Kunst ist für Leitherer stärkstes An-
liegen. Er ist deswegen profaner Kunst nicht fremd.
Das Grabmal, ohnedies religiöser Kunst benach-
bart, hat er mehrmals gestaltet (Abb. S. 30 d. B., im
Bamberger Friedhof). Er wirkt bei aller Schlicht-
heit durch Feingefühl für die künstlerischen Grund-
bedingungen : Kubus und Verhältnisse. Eine Mo-
numentalaufgabe stellte ihm das Denkmal für die
im Kriege gefallenen Bamberger Feuerwehrleute.
Das alte antike Thema des sterbenden Kriegers
wurde da neu gebildet, ohne nachempfinderisch zu
werden. Denn die Bedingungen und Bindungen der
Gegebenheit sind stark begriffen : kräftige, klare,
Die christliche Kunst. XX. 7, 8