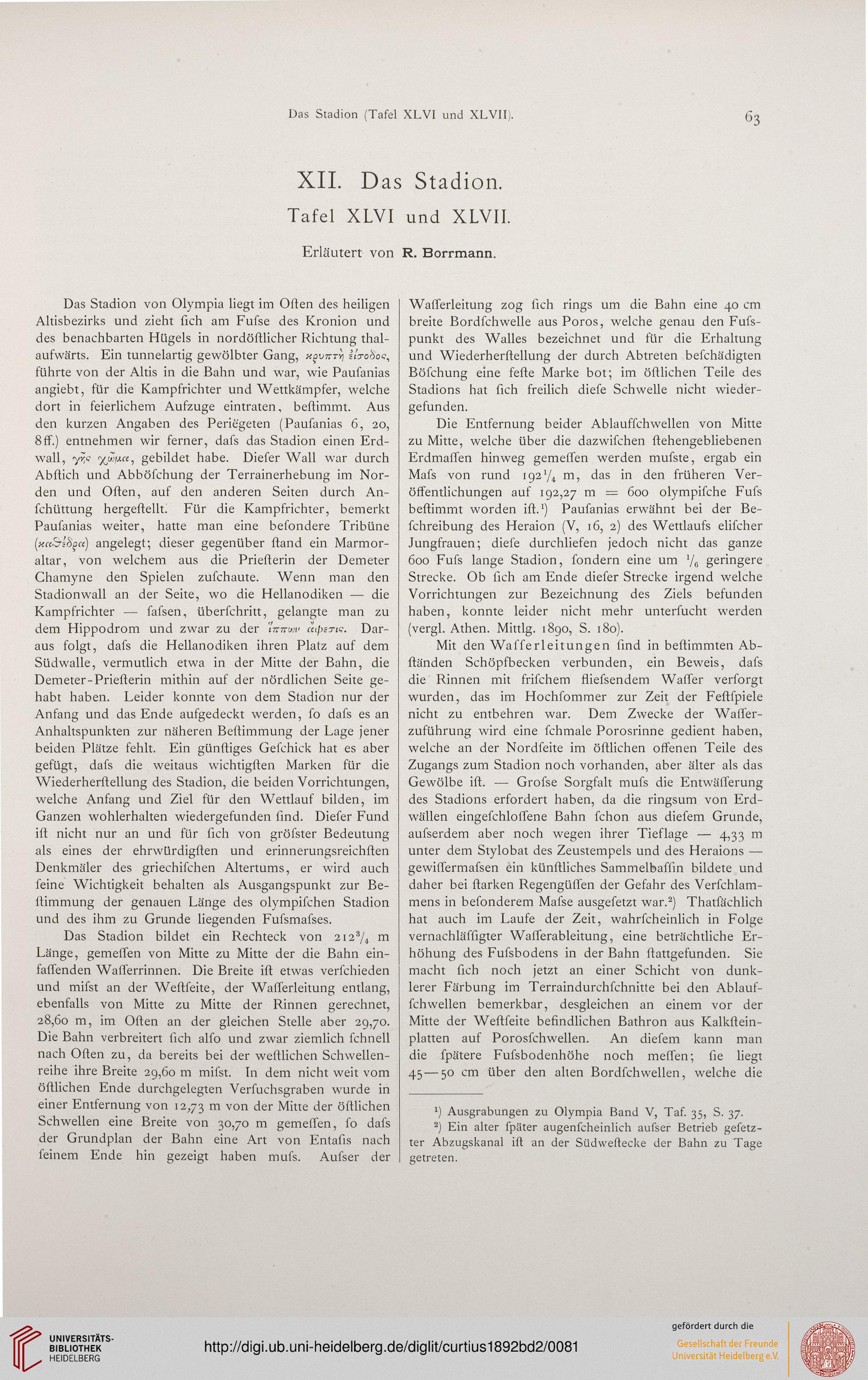Das Stadion (Tafel XLVI und XLVII)
63
XII. Das Stadion.
Tafel XLVI und XLVII.
Erläutert von R. Borrmann.
Das Stadion von Olympia liegt im Osten des heiligen
Altisbezirks und zieht sich am Fusse des Kronion und
des benachbarten Hügels in nordöstlicher Richtung thal-
aufwärts. Ein tunnelartig gewölbter Gang, h^wtt^ I<toc>oc,
führte von der Altis in die Bahn und war, wie Pausanias
angiebt, für die Kampfrichter und Wettkämpfer, welche
dort in feierlichem Aufzuge eintraten, benimmt. Aus
den kurzen Angaben des Periegeten (Pausanias 6, 20,
8sf.) entnehmen wir ferner, dass das Stadion einen Erd-
wall, <yrsi %wct, gebildet habe. Dieser Wall war durch
Abstich und Abböschung der Terrainerhebung im Nor-
den und Osten, auf den anderen Seiten durch An-
schüttung hergestellt. Für die Kampfrichter, bemerkt
Pausanias weiter, hatte man eine besondere Tribüne
(xaS-eBgu) angelegt; dieser gegenüber stand ein Marmor-
altar, von welchem aus die Priesterin der Demeter
Chamyne den Spielen zuschaute. Wenn man den
Stadion wall an der Seite, wo die Hellanodiken — die
Kampfrichter — sassen, überschritt, gelangte man zu
dem Hippodrom und zwar zu der 'Ittww äipss-K. Dar-
aus folgt, dass die Hellanodiken ihren Platz auf dem
Südwalle, vermutlich etwa in der Mitte der Bahn, die
Demeter-Priesterin mithin auf der nördlichen Seite ge-
habt haben. Leider konnte von dem Stadion nur der
Anfang und das Ende aufgedeckt werden, so dass es an
Anhaltspunkten zur näheren Bestimmung der Lage jener
beiden Plätze fehlt. Ein günstiges Geschick hat es aber
gefügt, dass die weitaus wichtigsten Marken für die
Wiederherstellung des Stadion, die beiden Vorrichtungen,
welche Anfang und Ziel für den Wettlauf bilden, im
Ganzen wohlerhalten wiedergefunden lind. Dieser Fund
ist nicht nur an und für sich von grösster Bedeutung
als eines der ehrwürdigsten und erinnerungsreichsten
Denkmäler des griechischen Altertums, er wird auch
seine Wichtigkeit behalten als Ausgangspunkt zur Be-
stimmung der genauen Länge des olympischen Stadion
und des ihm zu Grunde liegenden Fussmasses.
Das Stadion bildet ein Rechteck von 2i23/4 rn
Länge, gemessen von Mitte zu Mitte der die Bahn ein-
fahrenden Wasserrinnen. Die Breite ist etwas verschieden
und misst an der Westseite, der Wasserleitung entlang,
ebenfalls von Mitte zu Mitte der Rinnen gerechnet,
28,60 m, im Osten an der gleichen Stelle aber 29,70.
Die Bahn verbreitert sich also und zwar ziemlich schnell
nach Osten zu, da bereits bei der westlichen Schwellen-
reihe ihre Breite 29,60 m misst. In dem nicht weit vom
östlichen Ende durchgelegten Versuchsgraben wurde in
einer Entfernung von 12,73 m von der Mitte der östlichen
Schwellen eine Breite von 30,70 m gemessen, so dass
der Grundplan der Bahn eine Art von Entasis nach
seinem Ende hin gezeigt haben muss. Ausser der
Wasserleitung zog sich rings um die Bahn eine 40 cm
breite Bordschwelle aus Porös, welche genau den Fuss-
punkt des Walles bezeichnet und für die Erhaltung
und Wiederherstellung der durch Abtreten beschädigten
Böschung eine feste Marke bot; im östlichen Teile des
Stadions hat sich freilich diese Schwelle nicht wieder-
gefunden.
Die Entfernung beider Ablauffchwellen von Mitte
zu Mitte, welche über die dazwischen stehengebliebenen
Erdmassen hinweg gemessen werden musste, ergab ein
Mass von rund 19274 m, das in den früheren Ver-
ösfentlichungen auf 192,27 m = 600 olympische Fuss
bestimmt worden ist.1) Pausanias erwähnt bei der Be-
schreibung des Heraion (V, 16, 2) des Wettlaufs elischer
Jungfrauen; diese durchliefen jedoch nicht das ganze
600 Fuss lange Stadion, sondern eine um '/6 geringere
Strecke. Ob sich am Ende dieser Strecke irgend welche
Vorrichtungen zur Bezeichnung des Ziels befunden
haben, konnte leider nicht mehr untersucht werden
(vergl. Athen. Mittig. 1890, S. 180).
Mit den Wasserleitungen sind in bestimmten Ab-
ständen Schöpfbecken verbunden, ein Beweis, dass
die Rinnen mit frischem fiiessendem Wasser versorgt
wurden, das im Hochsommer zur Zeit der Festspiele
nicht zu entbehren war. Dem Zwecke der Wasser-
zuführung wird eine schmale Porosrinne gedient haben,
welche an der Nordseite im östlichen ofsenen Teile des
Zugangs zum Stadion noch vorhanden, aber älter als das
Gewölbe ist. — Grosse Sorgfalt muss die Entwässerung
des Stadions erfordert haben, da die ringsum von Erd-
wällen eingeschlossene Bahn schon aus diesem Grunde,
ausserdem aber noch wegen ihrer Tief läge — 4,33 m
unter dem Stylobat des Zeustempels und des Heraions —
gewissermassen ein künstliches Sammelbassin bildete und
daher bei starken Regengüssen der Gefahr des Verschlam-
mens in besonderem Masse ausgesetzt war.2) Thatsächlich
hat auch im Laufe der Zeit, wahrscheinlich in Folge
vernachlässigter Wasserableitung, eine beträchtliche Er-
höhung des Fussbodens in der Bahn stattgefunden. Sie
macht sich noch jetzt an einer Schicht von dunk-
lerer Färbung im Terraindurchschnitte bei den Ablauf-
schwellen bemerkbar, desgleichen an einem vor der
Mitte der Westseite befindlichen Bathron aus Kalkstein-
platten auf Porosschwellen. An diesem kann man
die spätere Fussbodenhöhe noch messen; sie liegt
45—5° cm uber den allen Bordschwellen, welche die
J) Ausgrabungen zu Olympia Band V, Taf. 35, S. 37.
2) Ein alter später augenscheinlich ausser Betrieb gesetz-
ter Abzugskanal ist an der Südwestecke der Bahn zu Tage
getreten.
63
XII. Das Stadion.
Tafel XLVI und XLVII.
Erläutert von R. Borrmann.
Das Stadion von Olympia liegt im Osten des heiligen
Altisbezirks und zieht sich am Fusse des Kronion und
des benachbarten Hügels in nordöstlicher Richtung thal-
aufwärts. Ein tunnelartig gewölbter Gang, h^wtt^ I<toc>oc,
führte von der Altis in die Bahn und war, wie Pausanias
angiebt, für die Kampfrichter und Wettkämpfer, welche
dort in feierlichem Aufzuge eintraten, benimmt. Aus
den kurzen Angaben des Periegeten (Pausanias 6, 20,
8sf.) entnehmen wir ferner, dass das Stadion einen Erd-
wall, <yrsi %wct, gebildet habe. Dieser Wall war durch
Abstich und Abböschung der Terrainerhebung im Nor-
den und Osten, auf den anderen Seiten durch An-
schüttung hergestellt. Für die Kampfrichter, bemerkt
Pausanias weiter, hatte man eine besondere Tribüne
(xaS-eBgu) angelegt; dieser gegenüber stand ein Marmor-
altar, von welchem aus die Priesterin der Demeter
Chamyne den Spielen zuschaute. Wenn man den
Stadion wall an der Seite, wo die Hellanodiken — die
Kampfrichter — sassen, überschritt, gelangte man zu
dem Hippodrom und zwar zu der 'Ittww äipss-K. Dar-
aus folgt, dass die Hellanodiken ihren Platz auf dem
Südwalle, vermutlich etwa in der Mitte der Bahn, die
Demeter-Priesterin mithin auf der nördlichen Seite ge-
habt haben. Leider konnte von dem Stadion nur der
Anfang und das Ende aufgedeckt werden, so dass es an
Anhaltspunkten zur näheren Bestimmung der Lage jener
beiden Plätze fehlt. Ein günstiges Geschick hat es aber
gefügt, dass die weitaus wichtigsten Marken für die
Wiederherstellung des Stadion, die beiden Vorrichtungen,
welche Anfang und Ziel für den Wettlauf bilden, im
Ganzen wohlerhalten wiedergefunden lind. Dieser Fund
ist nicht nur an und für sich von grösster Bedeutung
als eines der ehrwürdigsten und erinnerungsreichsten
Denkmäler des griechischen Altertums, er wird auch
seine Wichtigkeit behalten als Ausgangspunkt zur Be-
stimmung der genauen Länge des olympischen Stadion
und des ihm zu Grunde liegenden Fussmasses.
Das Stadion bildet ein Rechteck von 2i23/4 rn
Länge, gemessen von Mitte zu Mitte der die Bahn ein-
fahrenden Wasserrinnen. Die Breite ist etwas verschieden
und misst an der Westseite, der Wasserleitung entlang,
ebenfalls von Mitte zu Mitte der Rinnen gerechnet,
28,60 m, im Osten an der gleichen Stelle aber 29,70.
Die Bahn verbreitert sich also und zwar ziemlich schnell
nach Osten zu, da bereits bei der westlichen Schwellen-
reihe ihre Breite 29,60 m misst. In dem nicht weit vom
östlichen Ende durchgelegten Versuchsgraben wurde in
einer Entfernung von 12,73 m von der Mitte der östlichen
Schwellen eine Breite von 30,70 m gemessen, so dass
der Grundplan der Bahn eine Art von Entasis nach
seinem Ende hin gezeigt haben muss. Ausser der
Wasserleitung zog sich rings um die Bahn eine 40 cm
breite Bordschwelle aus Porös, welche genau den Fuss-
punkt des Walles bezeichnet und für die Erhaltung
und Wiederherstellung der durch Abtreten beschädigten
Böschung eine feste Marke bot; im östlichen Teile des
Stadions hat sich freilich diese Schwelle nicht wieder-
gefunden.
Die Entfernung beider Ablauffchwellen von Mitte
zu Mitte, welche über die dazwischen stehengebliebenen
Erdmassen hinweg gemessen werden musste, ergab ein
Mass von rund 19274 m, das in den früheren Ver-
ösfentlichungen auf 192,27 m = 600 olympische Fuss
bestimmt worden ist.1) Pausanias erwähnt bei der Be-
schreibung des Heraion (V, 16, 2) des Wettlaufs elischer
Jungfrauen; diese durchliefen jedoch nicht das ganze
600 Fuss lange Stadion, sondern eine um '/6 geringere
Strecke. Ob sich am Ende dieser Strecke irgend welche
Vorrichtungen zur Bezeichnung des Ziels befunden
haben, konnte leider nicht mehr untersucht werden
(vergl. Athen. Mittig. 1890, S. 180).
Mit den Wasserleitungen sind in bestimmten Ab-
ständen Schöpfbecken verbunden, ein Beweis, dass
die Rinnen mit frischem fiiessendem Wasser versorgt
wurden, das im Hochsommer zur Zeit der Festspiele
nicht zu entbehren war. Dem Zwecke der Wasser-
zuführung wird eine schmale Porosrinne gedient haben,
welche an der Nordseite im östlichen ofsenen Teile des
Zugangs zum Stadion noch vorhanden, aber älter als das
Gewölbe ist. — Grosse Sorgfalt muss die Entwässerung
des Stadions erfordert haben, da die ringsum von Erd-
wällen eingeschlossene Bahn schon aus diesem Grunde,
ausserdem aber noch wegen ihrer Tief läge — 4,33 m
unter dem Stylobat des Zeustempels und des Heraions —
gewissermassen ein künstliches Sammelbassin bildete und
daher bei starken Regengüssen der Gefahr des Verschlam-
mens in besonderem Masse ausgesetzt war.2) Thatsächlich
hat auch im Laufe der Zeit, wahrscheinlich in Folge
vernachlässigter Wasserableitung, eine beträchtliche Er-
höhung des Fussbodens in der Bahn stattgefunden. Sie
macht sich noch jetzt an einer Schicht von dunk-
lerer Färbung im Terraindurchschnitte bei den Ablauf-
schwellen bemerkbar, desgleichen an einem vor der
Mitte der Westseite befindlichen Bathron aus Kalkstein-
platten auf Porosschwellen. An diesem kann man
die spätere Fussbodenhöhe noch messen; sie liegt
45—5° cm uber den allen Bordschwellen, welche die
J) Ausgrabungen zu Olympia Band V, Taf. 35, S. 37.
2) Ein alter später augenscheinlich ausser Betrieb gesetz-
ter Abzugskanal ist an der Südwestecke der Bahn zu Tage
getreten.