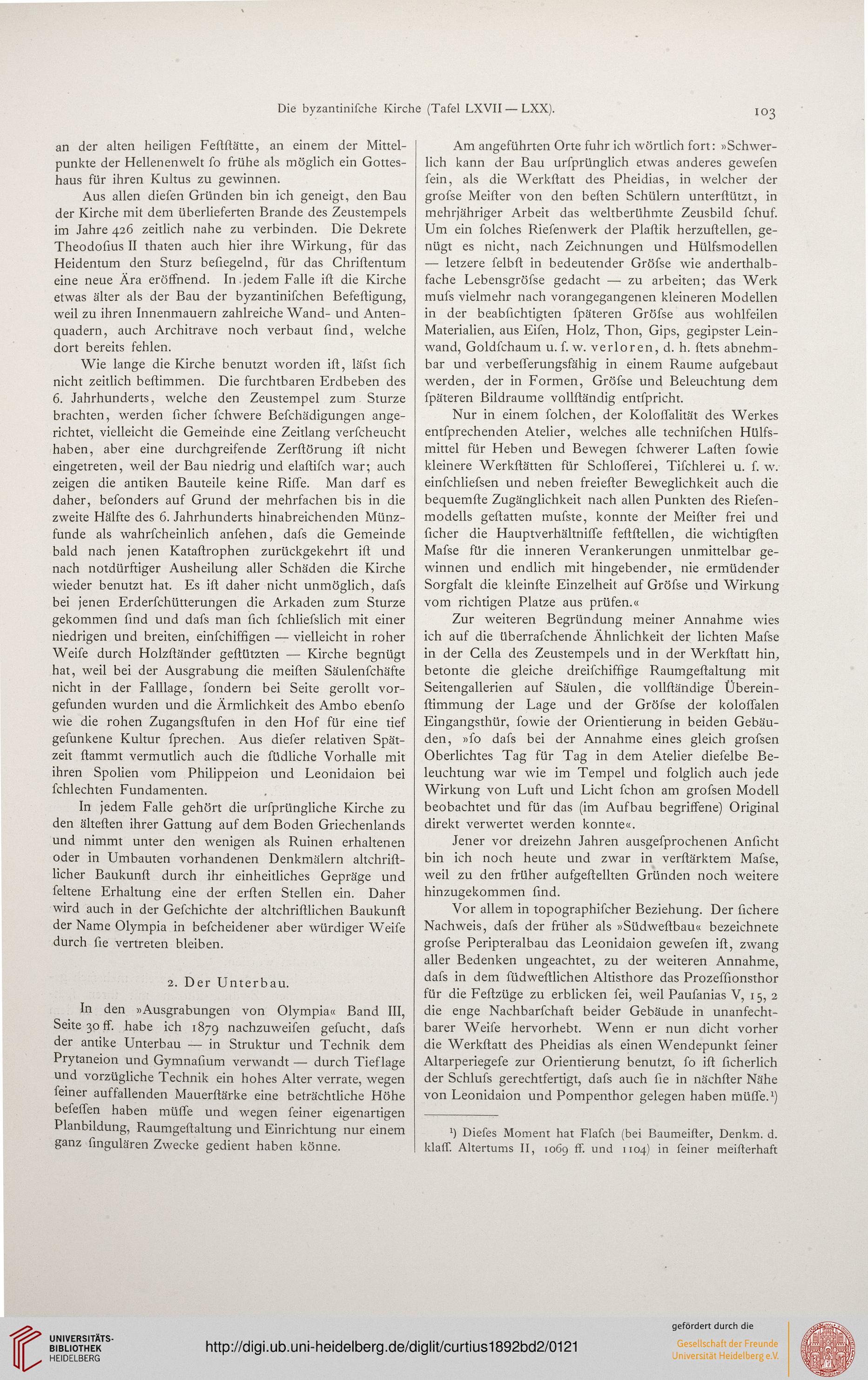Die byzantinische Kirche (Tafel LXVII — LXX).
103
an der alten heiligen Feststätte, an einem der Mittel-
punkte der Hellenenwelt so frühe als möglich ein Gottes-
haus für ihren Kultus zu gewinnen.
Aus allen diesen Gründen bin ich geneigt, den Bau
der Kirche mit dem überlieferten Brande des Zeustempels
im Jahre 426 zeitlich nahe zu verbinden. Die Dekrete
Theodosms II thaten auch hier ihre Wirkung, für das
Heidentum den Sturz besiegelnd, für das Christentum
eine neue Ära erösfnend. In jedem Falle ist die Kirche
etwas älter als der Bau der byzantinischen Befestigung,
weil zu ihren Innenmauern zahlreiche Wand- und Anten-
quadern, auch Architrave noch verbaut sind, welche
dort bereits fehlen.
Wie lange die Kirche benutzt worden ist, lässt sich
nicht zeitlich bestimmen. Die furchtbaren Erdbeben des
6. Jahrhunderts, welche den Zeustempel zum Sturze
brachten, werden sicher schwere Beschädigungen ange-
richtet, vielleicht die Gemeinde eine Zeitlang verscheucht
haben, aber eine durchgreifende Zerstörung ist nicht
eingetreten, weil der Bau niedrig und elastisch war; auch
zeigen die antiken Bauteile keine Risse. Man darf es
daher, besonders auf Grund der mehrfachen bis in die
zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts hinabreichenden Münz-
funde als wahrscheinlich ansehen, dass die Gemeinde
bald nach jenen Katastrophen zurückgekehrt ist und
nach notdürftiger Ausheilung aller Schäden die Kirche
wieder benutzt hat. Es ist daher nicht unmöglich, dass
bei jenen Erderschütterungen die Arkaden zum Sturze
gekommen sind und dass man sich schliesslich mit einer
niedrigen und breiten, einschiffigen — vielleicht in roher
Weise durch Holzständer gestützten — Kirche begnügt
hat, weil bei der Ausgrabung die meisten Säulenschäfte
nicht in der Falllage, sondern bei Seite gerollt vor-
gefunden wurden und die Ärmlichkeit des Ambo ebenso
wie die rohen Zugangsstufen in den Hof für eine tief
gesunkene Kultur sprechen. Aus dieser relativen Spät-
zeit flammt vermutlich auch die südliche Vorhalle mit
ihren Spolien vom Philippeion und Leonidaion bei
schlechten Fundamenten.
In jedem Falle gehört die ursprüngliche Kirche zu
den ältesten ihrer Gattung auf dem Boden Griechenlands
und nimmt unter den wenigen als Ruinen erhaltenen
oder in Umbauten vorhandenen Denkmälern altchrist-
licher Baukunst durch ihr einheitliches Gepräge und
seltene Erhaltung eine der ersten Stellen ein. Daher
wird auch in der Geschichte der altchristlichen Baukunst
der Name Olympia in bescheidener aber würdiger Weise
durch sie vertreten bleiben.
2. Der Unterbau.
In den »Ausgrabungen von Olympia« Band III,
Seite 30 ff. habe ich 1879 nachzuwersen gesucht, dass
der antike Unterbau — in Struktur und Technik dem
Prytaneion und Gymnasium verwandt — durch Ties läge
und vorzügliche Technik ein hohes Alter verrate, wegen
seiner aussallenden Mauerstärke eine beträchtliche Höhe
besessen haben musse und wegen seiner eigenartigen
Planbildung, Raumgestaltung und Einrichtung nur einem
ganz singulären Zwecke gedient haben könne.
Am angeführten Orte fuhr ich wörtlich sort: »Schwer-
lich kann der Bau ursprünglich etwas anderes gewesen
sein, als die Werkstatt des Pheidias, in welcher der
grosse Meister von den besten Schülern unterftützt, in
mehrjähriger Arbeit das weltberühmte Zeusbild schus.
Um ein solches Riesenwerk der Plastik herzustellen, ge-
nügt es nicht, nach Zeichnungen und Hülssmodellen
— letzere selbst in bedeutender Grösse wie anderthalb-
fache Lebensgrösse gedacht — zu arbeiten; das Werk
muss vielmehr nach vorangegangenen kleineren Modellen
in der beabsichtigten späteren Grösse aus wohlseilen
Materialien, aus Eisen, Holz, Thon, Gips, gegipster Lein-
wand, Goldschaum u. s. w. verloren, d. h. stets abnehm-
bar und verbesserungsfähig in einem Räume aufgebaut
werden, der in Formen, Grösse und Beleuchtung dem
späteren Bildraume vollständig entspricht.
Nur in einem solchen, der Kolossalität des Werkes
entsprechenden Atelier, welches alle technischen Hülss-
mittel für Heben und Bewegen schwerer Laften sowie
kleinere Werkstätten für Schlosserei, Tischlerei u. s. w.
einschliessen und neben freiester Beweglichkeit auch die
bequemste Zugänglichkeit nach allen Punkten des Riesen-
modells gestatten musste, konnte der Meister srei und
sicher die Hauptverhältnisse feststellen, die wichtigsten
Masse für die inneren Verankerungen unmittelbar ge-
winnen und endlich mit hingebender, nie ermüdender
Sorgfalt die kleinste Einzelheit auf Grösse und Wirkung
vom richtigen Platze aus prüfen.«
Zur weiteren Begründung meiner Annahme wies
ich auf die Uberraschende Ähnlichkeit der lichten Masse
in der Cella des Zeustempels und in der Werkstatt hin.,
betonte die gleiche dreischissige Raumgestaltung mit
Seitengallerien auf Säulen, die vollständige Uberein-
stimmung der Lage und der Grösse der kolossalen
Eingangsthür, sowie der Orientierung in beiden Gebäu-
den, »so dass bei der Annahme eines gleich grossen
Oberlichtes Tag für Tag in dem Atelier dieselbe Be-
leuchtung war wie im Tempel und folglich auch jede
Wirkung von Luft und Licht schon am grossen Modell
beobachtet und für das (im Aufbau begrisfene) Original
direkt verwertet werden konnte«.
Jener vor dreizehn Jahren ausgesprochenen Ansicht
bin ich noch heute und zwar in verstärktem Masse,
weil zu den früher aufgestellten Gründen noch weitere
hinzugekommen sind.
Vor allem in topographischer Beziehung. Der sichere
Nachweis, dass der früher als »Südwestbau« bezeichnete
grosse Peripteralbau das Leonidaion gewesen ist, zwang
aller Bedenken ungeachtet, zu der weiteren Annahme,
dass in dem südwestlichen Altisthore das Prozesfionsthor
für die Festzüge zu erblicken sei, weil Pausanias V, 15, 2
die enge Nachbarschaft beider Gebäude in unansecht-
barer Weise hervorhebt. Wenn er nun dicht vorher
die Werkstatt des Pheidias als einen Wendepunkt seiner
Altarperiegese zur Orientierung benutzt, so ist sicherlich
der Schluss gerechtfertigt, dass auch sie in nächster Nähe
von Leonidaion und Pompenthor gelegen haben muffe.1)
l) Dieses Moment hat Flasch (bei Baumeister, Denkm. d.
klass. Altertums II, 1069 ss. und 1104) in feiner meisterhast
103
an der alten heiligen Feststätte, an einem der Mittel-
punkte der Hellenenwelt so frühe als möglich ein Gottes-
haus für ihren Kultus zu gewinnen.
Aus allen diesen Gründen bin ich geneigt, den Bau
der Kirche mit dem überlieferten Brande des Zeustempels
im Jahre 426 zeitlich nahe zu verbinden. Die Dekrete
Theodosms II thaten auch hier ihre Wirkung, für das
Heidentum den Sturz besiegelnd, für das Christentum
eine neue Ära erösfnend. In jedem Falle ist die Kirche
etwas älter als der Bau der byzantinischen Befestigung,
weil zu ihren Innenmauern zahlreiche Wand- und Anten-
quadern, auch Architrave noch verbaut sind, welche
dort bereits fehlen.
Wie lange die Kirche benutzt worden ist, lässt sich
nicht zeitlich bestimmen. Die furchtbaren Erdbeben des
6. Jahrhunderts, welche den Zeustempel zum Sturze
brachten, werden sicher schwere Beschädigungen ange-
richtet, vielleicht die Gemeinde eine Zeitlang verscheucht
haben, aber eine durchgreifende Zerstörung ist nicht
eingetreten, weil der Bau niedrig und elastisch war; auch
zeigen die antiken Bauteile keine Risse. Man darf es
daher, besonders auf Grund der mehrfachen bis in die
zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts hinabreichenden Münz-
funde als wahrscheinlich ansehen, dass die Gemeinde
bald nach jenen Katastrophen zurückgekehrt ist und
nach notdürftiger Ausheilung aller Schäden die Kirche
wieder benutzt hat. Es ist daher nicht unmöglich, dass
bei jenen Erderschütterungen die Arkaden zum Sturze
gekommen sind und dass man sich schliesslich mit einer
niedrigen und breiten, einschiffigen — vielleicht in roher
Weise durch Holzständer gestützten — Kirche begnügt
hat, weil bei der Ausgrabung die meisten Säulenschäfte
nicht in der Falllage, sondern bei Seite gerollt vor-
gefunden wurden und die Ärmlichkeit des Ambo ebenso
wie die rohen Zugangsstufen in den Hof für eine tief
gesunkene Kultur sprechen. Aus dieser relativen Spät-
zeit flammt vermutlich auch die südliche Vorhalle mit
ihren Spolien vom Philippeion und Leonidaion bei
schlechten Fundamenten.
In jedem Falle gehört die ursprüngliche Kirche zu
den ältesten ihrer Gattung auf dem Boden Griechenlands
und nimmt unter den wenigen als Ruinen erhaltenen
oder in Umbauten vorhandenen Denkmälern altchrist-
licher Baukunst durch ihr einheitliches Gepräge und
seltene Erhaltung eine der ersten Stellen ein. Daher
wird auch in der Geschichte der altchristlichen Baukunst
der Name Olympia in bescheidener aber würdiger Weise
durch sie vertreten bleiben.
2. Der Unterbau.
In den »Ausgrabungen von Olympia« Band III,
Seite 30 ff. habe ich 1879 nachzuwersen gesucht, dass
der antike Unterbau — in Struktur und Technik dem
Prytaneion und Gymnasium verwandt — durch Ties läge
und vorzügliche Technik ein hohes Alter verrate, wegen
seiner aussallenden Mauerstärke eine beträchtliche Höhe
besessen haben musse und wegen seiner eigenartigen
Planbildung, Raumgestaltung und Einrichtung nur einem
ganz singulären Zwecke gedient haben könne.
Am angeführten Orte fuhr ich wörtlich sort: »Schwer-
lich kann der Bau ursprünglich etwas anderes gewesen
sein, als die Werkstatt des Pheidias, in welcher der
grosse Meister von den besten Schülern unterftützt, in
mehrjähriger Arbeit das weltberühmte Zeusbild schus.
Um ein solches Riesenwerk der Plastik herzustellen, ge-
nügt es nicht, nach Zeichnungen und Hülssmodellen
— letzere selbst in bedeutender Grösse wie anderthalb-
fache Lebensgrösse gedacht — zu arbeiten; das Werk
muss vielmehr nach vorangegangenen kleineren Modellen
in der beabsichtigten späteren Grösse aus wohlseilen
Materialien, aus Eisen, Holz, Thon, Gips, gegipster Lein-
wand, Goldschaum u. s. w. verloren, d. h. stets abnehm-
bar und verbesserungsfähig in einem Räume aufgebaut
werden, der in Formen, Grösse und Beleuchtung dem
späteren Bildraume vollständig entspricht.
Nur in einem solchen, der Kolossalität des Werkes
entsprechenden Atelier, welches alle technischen Hülss-
mittel für Heben und Bewegen schwerer Laften sowie
kleinere Werkstätten für Schlosserei, Tischlerei u. s. w.
einschliessen und neben freiester Beweglichkeit auch die
bequemste Zugänglichkeit nach allen Punkten des Riesen-
modells gestatten musste, konnte der Meister srei und
sicher die Hauptverhältnisse feststellen, die wichtigsten
Masse für die inneren Verankerungen unmittelbar ge-
winnen und endlich mit hingebender, nie ermüdender
Sorgfalt die kleinste Einzelheit auf Grösse und Wirkung
vom richtigen Platze aus prüfen.«
Zur weiteren Begründung meiner Annahme wies
ich auf die Uberraschende Ähnlichkeit der lichten Masse
in der Cella des Zeustempels und in der Werkstatt hin.,
betonte die gleiche dreischissige Raumgestaltung mit
Seitengallerien auf Säulen, die vollständige Uberein-
stimmung der Lage und der Grösse der kolossalen
Eingangsthür, sowie der Orientierung in beiden Gebäu-
den, »so dass bei der Annahme eines gleich grossen
Oberlichtes Tag für Tag in dem Atelier dieselbe Be-
leuchtung war wie im Tempel und folglich auch jede
Wirkung von Luft und Licht schon am grossen Modell
beobachtet und für das (im Aufbau begrisfene) Original
direkt verwertet werden konnte«.
Jener vor dreizehn Jahren ausgesprochenen Ansicht
bin ich noch heute und zwar in verstärktem Masse,
weil zu den früher aufgestellten Gründen noch weitere
hinzugekommen sind.
Vor allem in topographischer Beziehung. Der sichere
Nachweis, dass der früher als »Südwestbau« bezeichnete
grosse Peripteralbau das Leonidaion gewesen ist, zwang
aller Bedenken ungeachtet, zu der weiteren Annahme,
dass in dem südwestlichen Altisthore das Prozesfionsthor
für die Festzüge zu erblicken sei, weil Pausanias V, 15, 2
die enge Nachbarschaft beider Gebäude in unansecht-
barer Weise hervorhebt. Wenn er nun dicht vorher
die Werkstatt des Pheidias als einen Wendepunkt seiner
Altarperiegese zur Orientierung benutzt, so ist sicherlich
der Schluss gerechtfertigt, dass auch sie in nächster Nähe
von Leonidaion und Pompenthor gelegen haben muffe.1)
l) Dieses Moment hat Flasch (bei Baumeister, Denkm. d.
klass. Altertums II, 1069 ss. und 1104) in feiner meisterhast