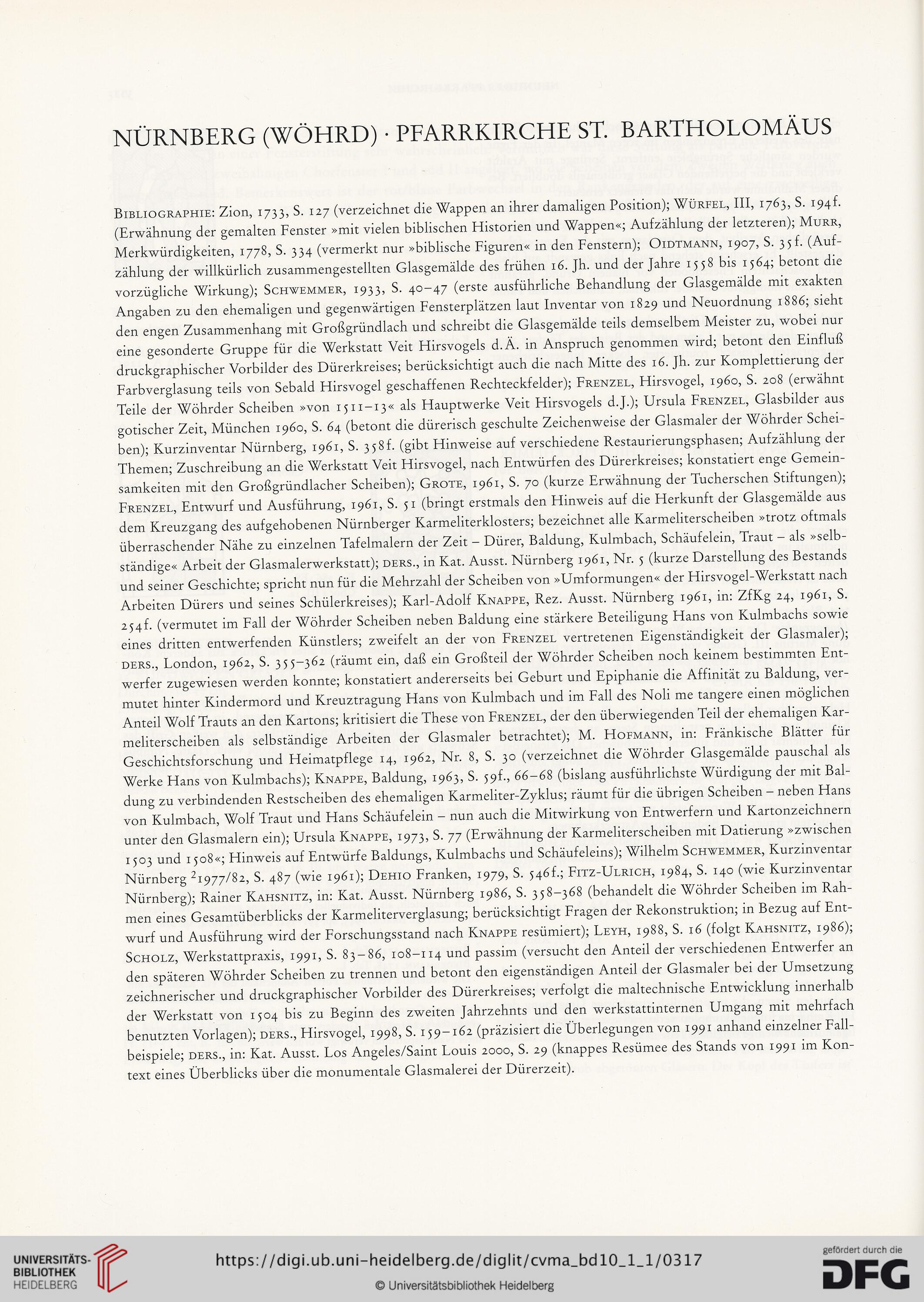NÜRNBERG (WÖHRD) • PFARRKIRCHE ST. BARTHOLOMÄUS
Bibliographie: Zion, 1733, S. 127 (verzeichnet die Wappen an ihrer damaligen Position); Würfel, III, 1763, S. 194L
(Erwähnung der gemalten Fenster »mit vielen biblischen Historien und Wappen«; Aufzählung der letzteren); Murr,
Merkwürdigkeiten, 1778, S. 334 (vermerkt nur »biblische Figuren« in den Fenstern); Oidtmann, 1907, S. 3 5 f - (Auf-
zählung der willkürlich zusammengestellten Glasgemälde des frühen 16. Jh. und der Jahre 1558 bis 1564; betont die
vorzügliche Wirkung); Schwemm er, 1933, S. 40-47 (erste ausführliche Behandlung der Glasgemälde mit exakten
Angaben zu den ehemaligen und gegenwärtigen Fensterplätzen laut Inventar von 1829 und Neuordnung 1886; sieht
den engen Zusammenhang mit Großgründlach und schreibt die Glasgemälde teils demselbem Meister zu, wobei nur
eine gesonderte Gruppe für die Werkstatt Veit Hirsvogels d.Ä. in Anspruch genommen wird; betont den Einfluß
druckgraphischer Vorbilder des Dürerkreises; berücksichtigt auch die nach Mitte des 16. Jh. zur Komplettierung der
Farbverglasung teils von Sebald Hirsvogel geschaffenen Rechteckfelder); Frenzel, Hirsvogel, 1960, S. 208 (erwähnt
Teile der Wöhrder Scheiben »von 1511-13« als Hauptwerke Veit Hirsvogels d.J.); Ursula Frenzel, Glasbilder aus
gotischer Zeit, München 1960, S. 64 (betont die dürerisch geschulte Zeichenweise der Glasmaler der Wöhrder Schei-
ben); Kurzinventar Nürnberg, 1961, S. 3 5 8 f. (gibt Hinweise auf verschiedene Restaurierungsphasen; Aufzählung der
Themen; Zuschreibung an die Werkstatt Veit Hirsvogel, nach Entwürfen des Dürerkreises; konstatiert enge Gemein-
samkeiten mit den Großgründlacher Scheiben); Grote, 1961, S. 70 (kurze Erwähnung der Tucherschen Stiftungen);
Frenzel, Entwurf und Ausführung, 1961, S. 51 (bringt erstmals den Hinweis auf die Herkunft der Glasgemälde aus
dem Kreuzgang des aufgehobenen Nürnberger Karmeliterklosters; bezeichnet alle Karmeliterscheiben »trotz oftmals
überraschender Nähe zu einzelnen Tafelmalern der Zeit - Dürer, Baldung, Kulmbach, Schäufelein, Traut - als »selb-
ständige« Arbeit der Glasmalerwerkstatt); ders., in Kat. Ausst. Nürnberg 1961, Nr. 5 (kurze Darstellung des Bestands
und seiner Geschichte; spricht nun für die Mehrzahl der Scheiben von »Umformungen« der Hirsvogel-Werkstatt nach
Arbeiten Dürers und seines Schülerkreises); Karl-Adolf Knappe, Rez. Ausst. Nürnberg 1961, in: ZfKg 24, 1961, S.
254E (vermutet im Fall der Wöhrder Scheiben neben Baldung eine stärkere Beteiligung Hans von Kulmbachs sowie
eines dritten entwerfenden Künstlers; zweifelt an der von Frenzel vertretenen Eigenständigkeit der Glasmaler);
ders., London, 1962, S. 355-362 (räumt ein, daß ein Großteil der Wöhrder Scheiben noch keinem bestimmten Ent-
werfer zugewiesen werden konnte; konstatiert andererseits bei Geburt und Epiphanie die Affinität zu Baldung, ver-
mutet hinter Kindermord und Kreuztragung Hans von Kulmbach und im Fall des Noli me tangere einen möglichen
Anteil Wolf Trauts an den Kartons; kritisiert die These von Frenzel, der den überwiegenden Teil der ehemaligen Kar-
meliterscheiben als selbständige Arbeiten der Glasmaler betrachtet); M. Hofmann, in: Fränkische Blätter für
Geschichtsforschung und Heimatpflege 14, 1962, Nr. 8, S. 30 (verzeichnet die Wöhrder Glasgemälde pauschal als
Werke Hans von Kulmbachs); Knappe, Baldung, 1963, S. 59E, 66-68 (bislang ausführlichste Würdigung der mit Bal-
dung zu verbindenden Restscheiben des ehemaligen Karmeliter-Zyklus; räumt für die übrigen Scheiben - neben Hans
von Kulmbach, Wolf Traut und Hans Schäufelein - nun auch die Mitwirkung von Entwerfern und Kartonzeichnern
unter den Glasmalern ein); Ursula Knappe, 1973, S. 77 (Erwähnung der Karmeliterscheiben mit Datierung »zwischen
1503 und 1508«; Hinweis auf Entwürfe Baldungs, Kulmbachs und Schäufeleins); Wilhelm Schwemmer, Kurzinventar
Nürnberg 21977/82, S. 487 (wie 1961); Dehio Franken, 1979, S. 546L; Fitz-Ulrich, 1984, S. 140 (wie Kurzinventar
Nürnberg); Rainer Kahsnitz, in: Kat. Ausst. Nürnberg 1986, S. 358-368 (behandelt die Wöhrder Scheiben im Rah-
men eines Gesamtüberblicks der Karmeliterverglasung; berücksichtigt Fragen der Rekonstruktion; in Bezug auf Ent-
wurf und Ausführung wird der Forschungsstand nach Knappe resümiert); Leyh, 1988, S. 16 (folgt Kahsnitz, 1986);
Scholz, Werkstattpraxis, 1991, S. 83-86, 108-114 und passim (versucht den Anteil der verschiedenen Entwerfer an
den späteren Wöhrder Scheiben zu trennen und betont den eigenständigen Anteil der Glasmaler bei der Umsetzung
zeichnerischer und druckgraphischer Vorbilder des Dürerkreises; verfolgt die maltechnische Entwicklung innerhalb
der Werkstatt von 1504 bis zu Beginn des zweiten Jahrzehnts und den werkstattinternen Umgang mit mehrfach
benutzten Vorlagen); ders., Hirsvogel, 1998,8. 159-162 (präzisiert die Überlegungen von 1991 anhand einzelner Fall-
beispiele; ders., in: Kat. Ausst. Los Angeles/Saint Louis 2000, S. 29 (knappes Resümee des Stands von 1991 im Kon-
text eines Überblicks über die monumentale Glasmalerei der Dürerzeit).
Bibliographie: Zion, 1733, S. 127 (verzeichnet die Wappen an ihrer damaligen Position); Würfel, III, 1763, S. 194L
(Erwähnung der gemalten Fenster »mit vielen biblischen Historien und Wappen«; Aufzählung der letzteren); Murr,
Merkwürdigkeiten, 1778, S. 334 (vermerkt nur »biblische Figuren« in den Fenstern); Oidtmann, 1907, S. 3 5 f - (Auf-
zählung der willkürlich zusammengestellten Glasgemälde des frühen 16. Jh. und der Jahre 1558 bis 1564; betont die
vorzügliche Wirkung); Schwemm er, 1933, S. 40-47 (erste ausführliche Behandlung der Glasgemälde mit exakten
Angaben zu den ehemaligen und gegenwärtigen Fensterplätzen laut Inventar von 1829 und Neuordnung 1886; sieht
den engen Zusammenhang mit Großgründlach und schreibt die Glasgemälde teils demselbem Meister zu, wobei nur
eine gesonderte Gruppe für die Werkstatt Veit Hirsvogels d.Ä. in Anspruch genommen wird; betont den Einfluß
druckgraphischer Vorbilder des Dürerkreises; berücksichtigt auch die nach Mitte des 16. Jh. zur Komplettierung der
Farbverglasung teils von Sebald Hirsvogel geschaffenen Rechteckfelder); Frenzel, Hirsvogel, 1960, S. 208 (erwähnt
Teile der Wöhrder Scheiben »von 1511-13« als Hauptwerke Veit Hirsvogels d.J.); Ursula Frenzel, Glasbilder aus
gotischer Zeit, München 1960, S. 64 (betont die dürerisch geschulte Zeichenweise der Glasmaler der Wöhrder Schei-
ben); Kurzinventar Nürnberg, 1961, S. 3 5 8 f. (gibt Hinweise auf verschiedene Restaurierungsphasen; Aufzählung der
Themen; Zuschreibung an die Werkstatt Veit Hirsvogel, nach Entwürfen des Dürerkreises; konstatiert enge Gemein-
samkeiten mit den Großgründlacher Scheiben); Grote, 1961, S. 70 (kurze Erwähnung der Tucherschen Stiftungen);
Frenzel, Entwurf und Ausführung, 1961, S. 51 (bringt erstmals den Hinweis auf die Herkunft der Glasgemälde aus
dem Kreuzgang des aufgehobenen Nürnberger Karmeliterklosters; bezeichnet alle Karmeliterscheiben »trotz oftmals
überraschender Nähe zu einzelnen Tafelmalern der Zeit - Dürer, Baldung, Kulmbach, Schäufelein, Traut - als »selb-
ständige« Arbeit der Glasmalerwerkstatt); ders., in Kat. Ausst. Nürnberg 1961, Nr. 5 (kurze Darstellung des Bestands
und seiner Geschichte; spricht nun für die Mehrzahl der Scheiben von »Umformungen« der Hirsvogel-Werkstatt nach
Arbeiten Dürers und seines Schülerkreises); Karl-Adolf Knappe, Rez. Ausst. Nürnberg 1961, in: ZfKg 24, 1961, S.
254E (vermutet im Fall der Wöhrder Scheiben neben Baldung eine stärkere Beteiligung Hans von Kulmbachs sowie
eines dritten entwerfenden Künstlers; zweifelt an der von Frenzel vertretenen Eigenständigkeit der Glasmaler);
ders., London, 1962, S. 355-362 (räumt ein, daß ein Großteil der Wöhrder Scheiben noch keinem bestimmten Ent-
werfer zugewiesen werden konnte; konstatiert andererseits bei Geburt und Epiphanie die Affinität zu Baldung, ver-
mutet hinter Kindermord und Kreuztragung Hans von Kulmbach und im Fall des Noli me tangere einen möglichen
Anteil Wolf Trauts an den Kartons; kritisiert die These von Frenzel, der den überwiegenden Teil der ehemaligen Kar-
meliterscheiben als selbständige Arbeiten der Glasmaler betrachtet); M. Hofmann, in: Fränkische Blätter für
Geschichtsforschung und Heimatpflege 14, 1962, Nr. 8, S. 30 (verzeichnet die Wöhrder Glasgemälde pauschal als
Werke Hans von Kulmbachs); Knappe, Baldung, 1963, S. 59E, 66-68 (bislang ausführlichste Würdigung der mit Bal-
dung zu verbindenden Restscheiben des ehemaligen Karmeliter-Zyklus; räumt für die übrigen Scheiben - neben Hans
von Kulmbach, Wolf Traut und Hans Schäufelein - nun auch die Mitwirkung von Entwerfern und Kartonzeichnern
unter den Glasmalern ein); Ursula Knappe, 1973, S. 77 (Erwähnung der Karmeliterscheiben mit Datierung »zwischen
1503 und 1508«; Hinweis auf Entwürfe Baldungs, Kulmbachs und Schäufeleins); Wilhelm Schwemmer, Kurzinventar
Nürnberg 21977/82, S. 487 (wie 1961); Dehio Franken, 1979, S. 546L; Fitz-Ulrich, 1984, S. 140 (wie Kurzinventar
Nürnberg); Rainer Kahsnitz, in: Kat. Ausst. Nürnberg 1986, S. 358-368 (behandelt die Wöhrder Scheiben im Rah-
men eines Gesamtüberblicks der Karmeliterverglasung; berücksichtigt Fragen der Rekonstruktion; in Bezug auf Ent-
wurf und Ausführung wird der Forschungsstand nach Knappe resümiert); Leyh, 1988, S. 16 (folgt Kahsnitz, 1986);
Scholz, Werkstattpraxis, 1991, S. 83-86, 108-114 und passim (versucht den Anteil der verschiedenen Entwerfer an
den späteren Wöhrder Scheiben zu trennen und betont den eigenständigen Anteil der Glasmaler bei der Umsetzung
zeichnerischer und druckgraphischer Vorbilder des Dürerkreises; verfolgt die maltechnische Entwicklung innerhalb
der Werkstatt von 1504 bis zu Beginn des zweiten Jahrzehnts und den werkstattinternen Umgang mit mehrfach
benutzten Vorlagen); ders., Hirsvogel, 1998,8. 159-162 (präzisiert die Überlegungen von 1991 anhand einzelner Fall-
beispiele; ders., in: Kat. Ausst. Los Angeles/Saint Louis 2000, S. 29 (knappes Resümee des Stands von 1991 im Kon-
text eines Überblicks über die monumentale Glasmalerei der Dürerzeit).