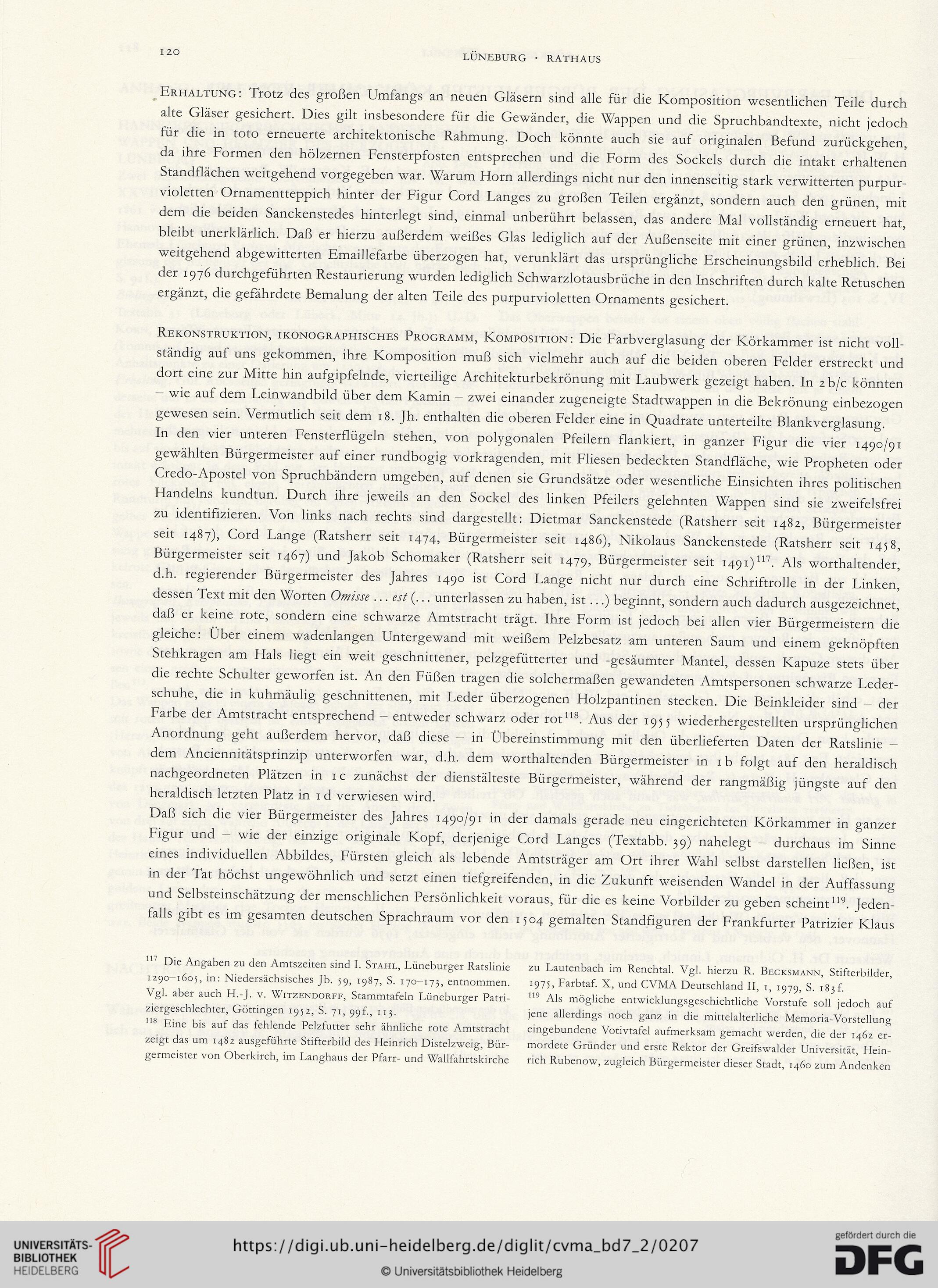120
LÜNEBURG • RATHAUS
Erhaltung: Trotz des großen Umfangs an neuen Gläsern sind alle für die Komposition wesentlichen Teile durch
alte Gläser gesichert. Dies gilt insbesondere für die Gewänder, die Wappen und die Spruchbandtexte, nicht jedoch
für die in toto erneuerte architektonische Rahmung. Doch könnte auch sie auf originalen Befund zurückgehen,
da ihre Formen den hölzernen Fensterpfosten entsprechen und die Form des Sockels durch die intakt erhaltenen
Standflächen weitgehend vorgegeben war. Warum Horn allerdings nicht nur den innenseitig stark verwitterten purpur-
violetten Ornamentteppich hinter der Figur Cord Langes zu großen Teilen ergänzt, sondern auch den grünen, mit
dem die beiden Sanckenstedes hinterlegt sind, einmal unberührt belassen, das andere Mal vollständig erneuert hat,
bleibt unerklärlich. Daß er hierzu außerdem weißes Glas lediglich auf der Außenseite mit einer grünen, inzwischen
weitgehend abgewitterten Emaillefarbe überzogen hat, verunklärt das ursprüngliche Erscheinungsbild erheblich. Bei
der 1976 durchgeführten Restaurierung wurden lediglich Schwarzlotausbrüche in den Inschriften durch kalte Retuschen
ergänzt, die gefährdete Bemalung der alten Teile des purpurvioletten Ornaments gesichert.
Rekonstruktion, ikonographisches Programm, Komposition : Die Farbverglasung der Körkammer ist nicht voll-
ständig auf uns gekommen, ihre Komposition muß sich vielmehr auch auf die beiden oberen Felder erstreckt und
dort eine zur Mitte hin aufgipfelnde, vierteilige Architekturbekrönung mit Laubwerk gezeigt haben. In 2b/c könnten
— wie auf dem Leinwandbild über dem Kamin - zwei einander zugeneigte Stadtwappen in die Bekrönung einbezogen
gewesen sein. Vermutlich seit dem 18. Jh. enthalten die oberen Felder eine in Quadrate unterteilte Blankverglasung.
In den vier unteren Fensterflügeln stehen, von polygonalen Pfeilern flankiert, in ganzer Figur die vier 1490/91
gewählten Bürgermeister auf einer rundbogig vorkragenden, mit Fliesen bedeckten Standfläche, wie Propheten oder
Credo-Apostel von Spruchbändern umgeben, auf denen sie Grundsätze oder wesentliche Einsichten ihres politischen
Handelns kundtun. Durch ihre jeweils an den Sockel des linken Pfeilers gelehnten Wappen sind sie zweifelsfrei
zu identifizieren. Von links nach rechts sind dargestellt: Dietmar Sanckenstede (Ratsherr seit 1482, Bürgermeister
seit 1487), Cord Lange (Ratsherr seit 1474, Bürgermeister seit 1486), Nikolaus Sanckenstede (Ratsherr seit 1458,
Bürgermeister seit 1467) und Jakob Schomaker (Ratsherr seit 1479, Bürgermeister seit 1491)117. Als worthaltender,
d.h. regierender Bürgermeister des Jahres 1490 ist Cord Lange nicht nur durch eine Schriftrolle in der Linken,
dessen Text mit den Worten Omisse ... est (... unterlassen zu haben, ist...) beginnt, sondern auch dadurch ausgezeichnet,
daß er keine rote, sondern eine schwarze Amtstracht trägt. Ihre Form ist jedoch bei allen vier Bürgermeistern die
gleiche: Über einem wadenlangen Untergewand mit weißem Pelzbesatz am unteren Saum und einem geknöpften
Stehkragen am Hals liegt ein weit geschnittener, pelzgefütterter und -gesäumter Mantel, dessen Kapuze stets über
die rechte Schulter geworfen ist. An den Füßen tragen die solchermaßen gewandeten Amtspersonen schwarze Leder-
schuhe, die in kuhmäulig geschnittenen, mit Leder überzogenen Holzpantinen stecken. Die Beinkleider sind — der
Farbe der Amtstracht entsprechend — entweder schwarz oder rot118. Aus der 1955 wiederhergestellten ursprünglichen
Anordnung geht außerdem hervor, daß diese — in Übereinstimmung mit den überlieferten Daten der Ratslinie —
dem Anciennitätsprinzip unterworfen war, d.h. dem worthaltenden Bürgermeister in 1 b folgt auf den heraldisch
nachgeordneten Plätzen in 1 c zunächst der dienstälteste Bürgermeister, während der rangmäßig jüngste auf den
heraldisch letzten Platz in 1 d verwiesen wird.
Daß sich die vier Bürgermeister des Jahres 1490/91 in der damals gerade neu eingerichteten Körkammer in ganzer
Figur und — wie der einzige originale Kopf, derjenige Cord Langes (Textabb. 39) nahelegt — durchaus im Sinne
eines individuellen Abbildes, Fürsten gleich als lebende Amtsträger am Ort ihrer Wahl selbst darstellen ließen, ist
in der Tat höchst ungewöhnlich und setzt einen tiefgreifenden, in die Zukunft weisenden Wandel in der Auffassung
und Selbsteinschätzung der menschlichen Persönlichkeit voraus, für die es keine Vorbilder zu geben scheint119. Jeden-
falls gibt es im gesamten deutschen Sprachraum vor den 1504 gemalten Standfiguren der Frankfurter Patrizier Klaus
117 Die Angaben zu den Amtszeiten sind I. Stahl, Lüneburger Ratslinie
1290-1605, *n: Niedersächsisches Jb. 59, 1987, S. 170—173, entnommen.
Vgl. aber auch H.-J. v. Witzendorff, Stammtafeln Lüneburger Patri-
ziergeschlechter, Göttingen 1952, S. 71, 99b, 113.
118 Eine bis auf das fehlende Pelzfutter sehr ähnliche rote Amtstracht
zeigt das um 1482 ausgeführte Stifterbild des Heinrich Distelzweig, Bür-
germeister von Oberkirch, im Langhaus der Pfarr- und Wallfahrtskirche
zu Lautenbach im Renchtal. Vgl. hierzu R. Becksmann, Stifterbilder,
1975, Farbtaf. X, und CVMA Deutschland II, 1, 1979, S. 183f.
119 Als mögliche entwicklungsgeschichtliche Vorstufe soll jedoch auf
jene allerdings noch ganz in die mittelalterliche Memoria-Vorstellung
eingebundene Votivtafel aufmerksam gemacht werden, die der 1462 er-
mordete Gründer und erste Rektor der Greifswalder Universität, Hein-
rich Rubenow, zugleich Bürgermeister dieser Stadt, 1460 zum Andenken
LÜNEBURG • RATHAUS
Erhaltung: Trotz des großen Umfangs an neuen Gläsern sind alle für die Komposition wesentlichen Teile durch
alte Gläser gesichert. Dies gilt insbesondere für die Gewänder, die Wappen und die Spruchbandtexte, nicht jedoch
für die in toto erneuerte architektonische Rahmung. Doch könnte auch sie auf originalen Befund zurückgehen,
da ihre Formen den hölzernen Fensterpfosten entsprechen und die Form des Sockels durch die intakt erhaltenen
Standflächen weitgehend vorgegeben war. Warum Horn allerdings nicht nur den innenseitig stark verwitterten purpur-
violetten Ornamentteppich hinter der Figur Cord Langes zu großen Teilen ergänzt, sondern auch den grünen, mit
dem die beiden Sanckenstedes hinterlegt sind, einmal unberührt belassen, das andere Mal vollständig erneuert hat,
bleibt unerklärlich. Daß er hierzu außerdem weißes Glas lediglich auf der Außenseite mit einer grünen, inzwischen
weitgehend abgewitterten Emaillefarbe überzogen hat, verunklärt das ursprüngliche Erscheinungsbild erheblich. Bei
der 1976 durchgeführten Restaurierung wurden lediglich Schwarzlotausbrüche in den Inschriften durch kalte Retuschen
ergänzt, die gefährdete Bemalung der alten Teile des purpurvioletten Ornaments gesichert.
Rekonstruktion, ikonographisches Programm, Komposition : Die Farbverglasung der Körkammer ist nicht voll-
ständig auf uns gekommen, ihre Komposition muß sich vielmehr auch auf die beiden oberen Felder erstreckt und
dort eine zur Mitte hin aufgipfelnde, vierteilige Architekturbekrönung mit Laubwerk gezeigt haben. In 2b/c könnten
— wie auf dem Leinwandbild über dem Kamin - zwei einander zugeneigte Stadtwappen in die Bekrönung einbezogen
gewesen sein. Vermutlich seit dem 18. Jh. enthalten die oberen Felder eine in Quadrate unterteilte Blankverglasung.
In den vier unteren Fensterflügeln stehen, von polygonalen Pfeilern flankiert, in ganzer Figur die vier 1490/91
gewählten Bürgermeister auf einer rundbogig vorkragenden, mit Fliesen bedeckten Standfläche, wie Propheten oder
Credo-Apostel von Spruchbändern umgeben, auf denen sie Grundsätze oder wesentliche Einsichten ihres politischen
Handelns kundtun. Durch ihre jeweils an den Sockel des linken Pfeilers gelehnten Wappen sind sie zweifelsfrei
zu identifizieren. Von links nach rechts sind dargestellt: Dietmar Sanckenstede (Ratsherr seit 1482, Bürgermeister
seit 1487), Cord Lange (Ratsherr seit 1474, Bürgermeister seit 1486), Nikolaus Sanckenstede (Ratsherr seit 1458,
Bürgermeister seit 1467) und Jakob Schomaker (Ratsherr seit 1479, Bürgermeister seit 1491)117. Als worthaltender,
d.h. regierender Bürgermeister des Jahres 1490 ist Cord Lange nicht nur durch eine Schriftrolle in der Linken,
dessen Text mit den Worten Omisse ... est (... unterlassen zu haben, ist...) beginnt, sondern auch dadurch ausgezeichnet,
daß er keine rote, sondern eine schwarze Amtstracht trägt. Ihre Form ist jedoch bei allen vier Bürgermeistern die
gleiche: Über einem wadenlangen Untergewand mit weißem Pelzbesatz am unteren Saum und einem geknöpften
Stehkragen am Hals liegt ein weit geschnittener, pelzgefütterter und -gesäumter Mantel, dessen Kapuze stets über
die rechte Schulter geworfen ist. An den Füßen tragen die solchermaßen gewandeten Amtspersonen schwarze Leder-
schuhe, die in kuhmäulig geschnittenen, mit Leder überzogenen Holzpantinen stecken. Die Beinkleider sind — der
Farbe der Amtstracht entsprechend — entweder schwarz oder rot118. Aus der 1955 wiederhergestellten ursprünglichen
Anordnung geht außerdem hervor, daß diese — in Übereinstimmung mit den überlieferten Daten der Ratslinie —
dem Anciennitätsprinzip unterworfen war, d.h. dem worthaltenden Bürgermeister in 1 b folgt auf den heraldisch
nachgeordneten Plätzen in 1 c zunächst der dienstälteste Bürgermeister, während der rangmäßig jüngste auf den
heraldisch letzten Platz in 1 d verwiesen wird.
Daß sich die vier Bürgermeister des Jahres 1490/91 in der damals gerade neu eingerichteten Körkammer in ganzer
Figur und — wie der einzige originale Kopf, derjenige Cord Langes (Textabb. 39) nahelegt — durchaus im Sinne
eines individuellen Abbildes, Fürsten gleich als lebende Amtsträger am Ort ihrer Wahl selbst darstellen ließen, ist
in der Tat höchst ungewöhnlich und setzt einen tiefgreifenden, in die Zukunft weisenden Wandel in der Auffassung
und Selbsteinschätzung der menschlichen Persönlichkeit voraus, für die es keine Vorbilder zu geben scheint119. Jeden-
falls gibt es im gesamten deutschen Sprachraum vor den 1504 gemalten Standfiguren der Frankfurter Patrizier Klaus
117 Die Angaben zu den Amtszeiten sind I. Stahl, Lüneburger Ratslinie
1290-1605, *n: Niedersächsisches Jb. 59, 1987, S. 170—173, entnommen.
Vgl. aber auch H.-J. v. Witzendorff, Stammtafeln Lüneburger Patri-
ziergeschlechter, Göttingen 1952, S. 71, 99b, 113.
118 Eine bis auf das fehlende Pelzfutter sehr ähnliche rote Amtstracht
zeigt das um 1482 ausgeführte Stifterbild des Heinrich Distelzweig, Bür-
germeister von Oberkirch, im Langhaus der Pfarr- und Wallfahrtskirche
zu Lautenbach im Renchtal. Vgl. hierzu R. Becksmann, Stifterbilder,
1975, Farbtaf. X, und CVMA Deutschland II, 1, 1979, S. 183f.
119 Als mögliche entwicklungsgeschichtliche Vorstufe soll jedoch auf
jene allerdings noch ganz in die mittelalterliche Memoria-Vorstellung
eingebundene Votivtafel aufmerksam gemacht werden, die der 1462 er-
mordete Gründer und erste Rektor der Greifswalder Universität, Hein-
rich Rubenow, zugleich Bürgermeister dieser Stadt, 1460 zum Andenken