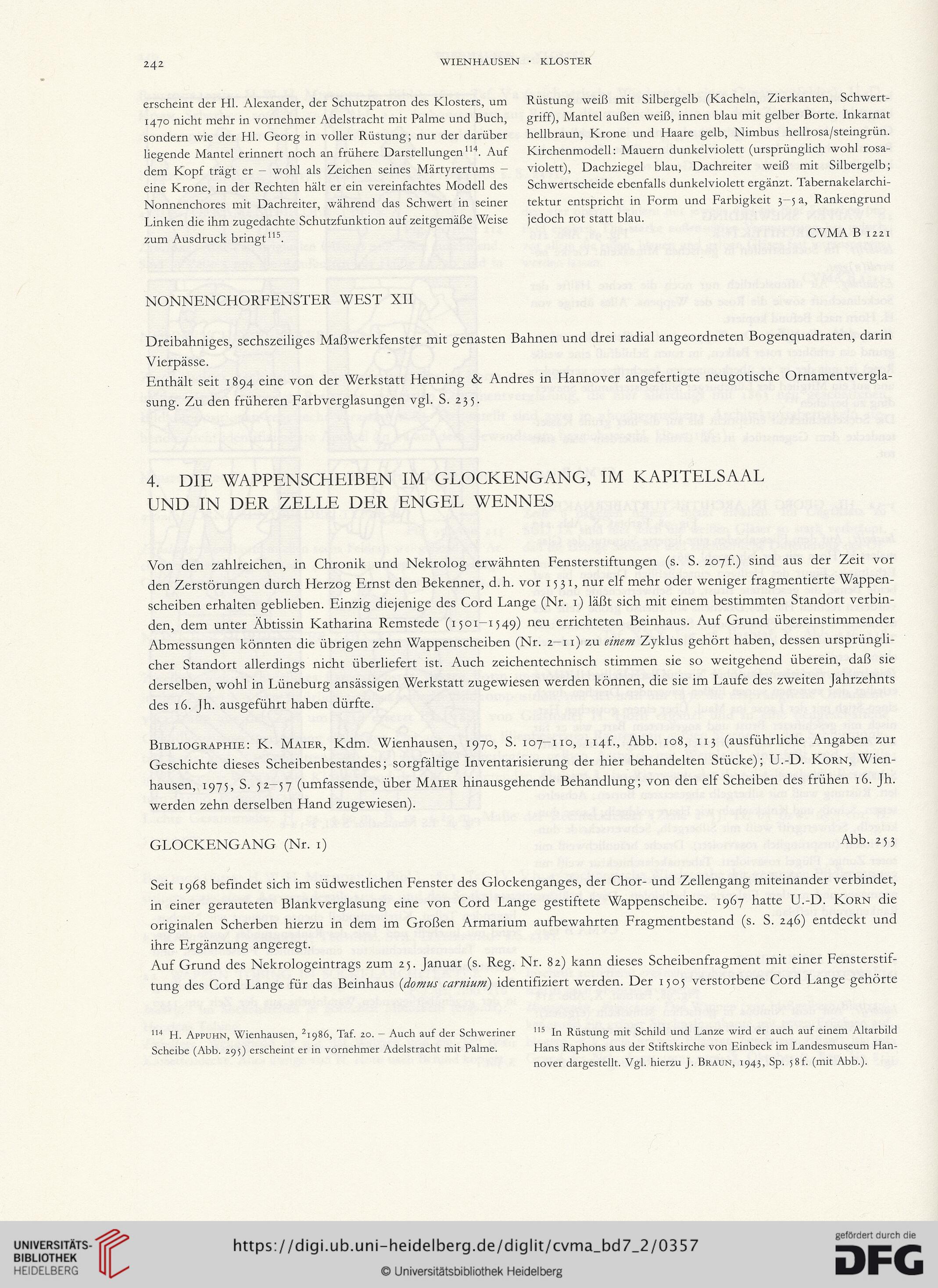242
WIENHAUSEN • KLOSTER
erscheint der Hl. Alexander, der Schutzpatron des Klosters, um
1470 nicht mehr in vornehmer Adelstracht mit Palme und Buch,
sondern wie der Hl. Georg in voller Rüstung; nur der darüber
liegende Mantel erinnert noch an frühere Darstellungen114. Auf
dem Kopf trägt er - wohl als Zeichen seines Märtyrertums —
eine Krone, in der Rechten hält er ein vereinfachtes Modell des
Nonnenchores mit Dachreiter, während das Schwert in seiner
Linken die ihm zugedachte Schutzfunktion auf zeitgemäße Weise
zum Ausdruck bringt115.
Rüstung weiß mit Silbergelb (Kacheln, Zierkanten, Schwert-
griff), Mantel außen weiß, innen blau mit gelber Borte. Inkarnat
hellbraun, Krone und Haare gelb, Nimbus hellrosa/steingrün.
Kirchenmodell: Mauern dunkelviolett (ursprünglich wohl rosa-
violett), Dachziegel blau, Dachreiter weiß mit Silbergelb;
Schwertscheide ebenfalls dunkelviolett ergänzt. Tabernakelarchi-
tektur entspricht in Form und Farbigkeit 3—5 a, Rankengrund
jedoch rot statt blau.
CVMA B 1221
NONNENCHORFENSTER WEST XII
Dreibahniges, sechszeiliges Maßwerkfenster mit genasten Bahnen und drei radial angeordneten Bogenquadraten, darin
Vierpässe.
Enthält seit 1894 eine von der Werkstatt Henning & Andres in Hannover angefertigte neugotische Ornamentvergla-
sung. Zu den früheren Farbverglasungen vgl. S. 235.
4. DIE WAPPEN SCHEIBEN IM GLOCKENGANG, IM KAPITELSAAL
UND IN DER ZELLE DER ENGEL WENNES
Von den zahlreichen, in Chronik und Nekrolog erwähnten Fensterstiftungen (s. S. 207f.) sind aus der Zeit vor
den Zerstörungen durch Herzog Ernst den Bekenner, d. h. vor 1531, nur elf mehr oder weniger fragmentierte Wappen-
scheiben erhalten geblieben. Einzig diejenige des Cord Lange (Nr. 1) läßt sich mit einem bestimmten Standort verbin-
den, dem unter Äbtissin Katharina Remstede (1501—1549) neu errichteten Beinhaus. Auf Grund übereinstimmender
Abmessungen könnten die übrigen zehn Wappenscheiben (Nr. 2—11) zu einem Zyklus gehört haben, dessen ursprüngli-
cher Standort allerdings nicht überliefert ist. Auch zeichentechnisch stimmen sie so weitgehend überein, daß sie
derselben, wohl in Lüneburg ansässigen Werkstatt zugewiesen werden können, die sie im Laufe des zweiten Jahrzehnts
des 16. Jh. ausgeführt haben dürfte.
Bibliographie: K. Maier, Kdm. Wienhausen, 1970, S. 107—110, ii4f., Abb. 108, 113 (ausführliche Angaben zur
Geschichte dieses Scheibenbestandes; sorgfältige Inventarisierung der hier behandelten Stücke); U.-D. Korn, Wien-
hausen, 1975, S. 52—57 (umfassende, über Maier hinausgehende Behandlung; von den elf Scheiben des frühen 16. Jh.
werden zehn derselben Hand zugewiesen).
GLOCKENGANG (Nr. 1) Abb. 253
Seit 1968 befindet sich im südwestlichen Fenster des Glockenganges, der Chor- und Zellengang miteinander verbindet,
in einer gerauteten Blankverglasung eine von Cord Lange gestiftete Wappenscheibe. 1967 hatte U.-D. Korn die
originalen Scherben hierzu in dem im Großen Armarium aufbewahrten Fragmentbestand (s. S. 246) entdeckt und
ihre Ergänzung angeregt.
Auf Grund des Nekrologeintrags zum 25. Januar (s. Reg. Nr. 82) kann dieses Scheibenfragment mit einer Fensterstif-
tung des Cord Lange für das Beinhaus (domus carnium) identifiziert werden. Der 1505 verstorbene Cord Lange gehörte
114 H. Appuhn, Wienhausen, 2i986, Taf. 20. — Auch auf der Schweriner
Scheibe (Abb. 295) erscheint er in vornehmer Adelstracht mit Palme.
115 In Rüstung mit Schild und Lanze wird er auch auf einem Altarbild
Hans Raphons aus der Stiftskirche von Einbeck im Landesmuseum Han-
nover dargestellt. Vgl. hierzu J. Braun, 1943, Sp. 5 8 f. (mit Abb.).
WIENHAUSEN • KLOSTER
erscheint der Hl. Alexander, der Schutzpatron des Klosters, um
1470 nicht mehr in vornehmer Adelstracht mit Palme und Buch,
sondern wie der Hl. Georg in voller Rüstung; nur der darüber
liegende Mantel erinnert noch an frühere Darstellungen114. Auf
dem Kopf trägt er - wohl als Zeichen seines Märtyrertums —
eine Krone, in der Rechten hält er ein vereinfachtes Modell des
Nonnenchores mit Dachreiter, während das Schwert in seiner
Linken die ihm zugedachte Schutzfunktion auf zeitgemäße Weise
zum Ausdruck bringt115.
Rüstung weiß mit Silbergelb (Kacheln, Zierkanten, Schwert-
griff), Mantel außen weiß, innen blau mit gelber Borte. Inkarnat
hellbraun, Krone und Haare gelb, Nimbus hellrosa/steingrün.
Kirchenmodell: Mauern dunkelviolett (ursprünglich wohl rosa-
violett), Dachziegel blau, Dachreiter weiß mit Silbergelb;
Schwertscheide ebenfalls dunkelviolett ergänzt. Tabernakelarchi-
tektur entspricht in Form und Farbigkeit 3—5 a, Rankengrund
jedoch rot statt blau.
CVMA B 1221
NONNENCHORFENSTER WEST XII
Dreibahniges, sechszeiliges Maßwerkfenster mit genasten Bahnen und drei radial angeordneten Bogenquadraten, darin
Vierpässe.
Enthält seit 1894 eine von der Werkstatt Henning & Andres in Hannover angefertigte neugotische Ornamentvergla-
sung. Zu den früheren Farbverglasungen vgl. S. 235.
4. DIE WAPPEN SCHEIBEN IM GLOCKENGANG, IM KAPITELSAAL
UND IN DER ZELLE DER ENGEL WENNES
Von den zahlreichen, in Chronik und Nekrolog erwähnten Fensterstiftungen (s. S. 207f.) sind aus der Zeit vor
den Zerstörungen durch Herzog Ernst den Bekenner, d. h. vor 1531, nur elf mehr oder weniger fragmentierte Wappen-
scheiben erhalten geblieben. Einzig diejenige des Cord Lange (Nr. 1) läßt sich mit einem bestimmten Standort verbin-
den, dem unter Äbtissin Katharina Remstede (1501—1549) neu errichteten Beinhaus. Auf Grund übereinstimmender
Abmessungen könnten die übrigen zehn Wappenscheiben (Nr. 2—11) zu einem Zyklus gehört haben, dessen ursprüngli-
cher Standort allerdings nicht überliefert ist. Auch zeichentechnisch stimmen sie so weitgehend überein, daß sie
derselben, wohl in Lüneburg ansässigen Werkstatt zugewiesen werden können, die sie im Laufe des zweiten Jahrzehnts
des 16. Jh. ausgeführt haben dürfte.
Bibliographie: K. Maier, Kdm. Wienhausen, 1970, S. 107—110, ii4f., Abb. 108, 113 (ausführliche Angaben zur
Geschichte dieses Scheibenbestandes; sorgfältige Inventarisierung der hier behandelten Stücke); U.-D. Korn, Wien-
hausen, 1975, S. 52—57 (umfassende, über Maier hinausgehende Behandlung; von den elf Scheiben des frühen 16. Jh.
werden zehn derselben Hand zugewiesen).
GLOCKENGANG (Nr. 1) Abb. 253
Seit 1968 befindet sich im südwestlichen Fenster des Glockenganges, der Chor- und Zellengang miteinander verbindet,
in einer gerauteten Blankverglasung eine von Cord Lange gestiftete Wappenscheibe. 1967 hatte U.-D. Korn die
originalen Scherben hierzu in dem im Großen Armarium aufbewahrten Fragmentbestand (s. S. 246) entdeckt und
ihre Ergänzung angeregt.
Auf Grund des Nekrologeintrags zum 25. Januar (s. Reg. Nr. 82) kann dieses Scheibenfragment mit einer Fensterstif-
tung des Cord Lange für das Beinhaus (domus carnium) identifiziert werden. Der 1505 verstorbene Cord Lange gehörte
114 H. Appuhn, Wienhausen, 2i986, Taf. 20. — Auch auf der Schweriner
Scheibe (Abb. 295) erscheint er in vornehmer Adelstracht mit Palme.
115 In Rüstung mit Schild und Lanze wird er auch auf einem Altarbild
Hans Raphons aus der Stiftskirche von Einbeck im Landesmuseum Han-
nover dargestellt. Vgl. hierzu J. Braun, 1943, Sp. 5 8 f. (mit Abb.).