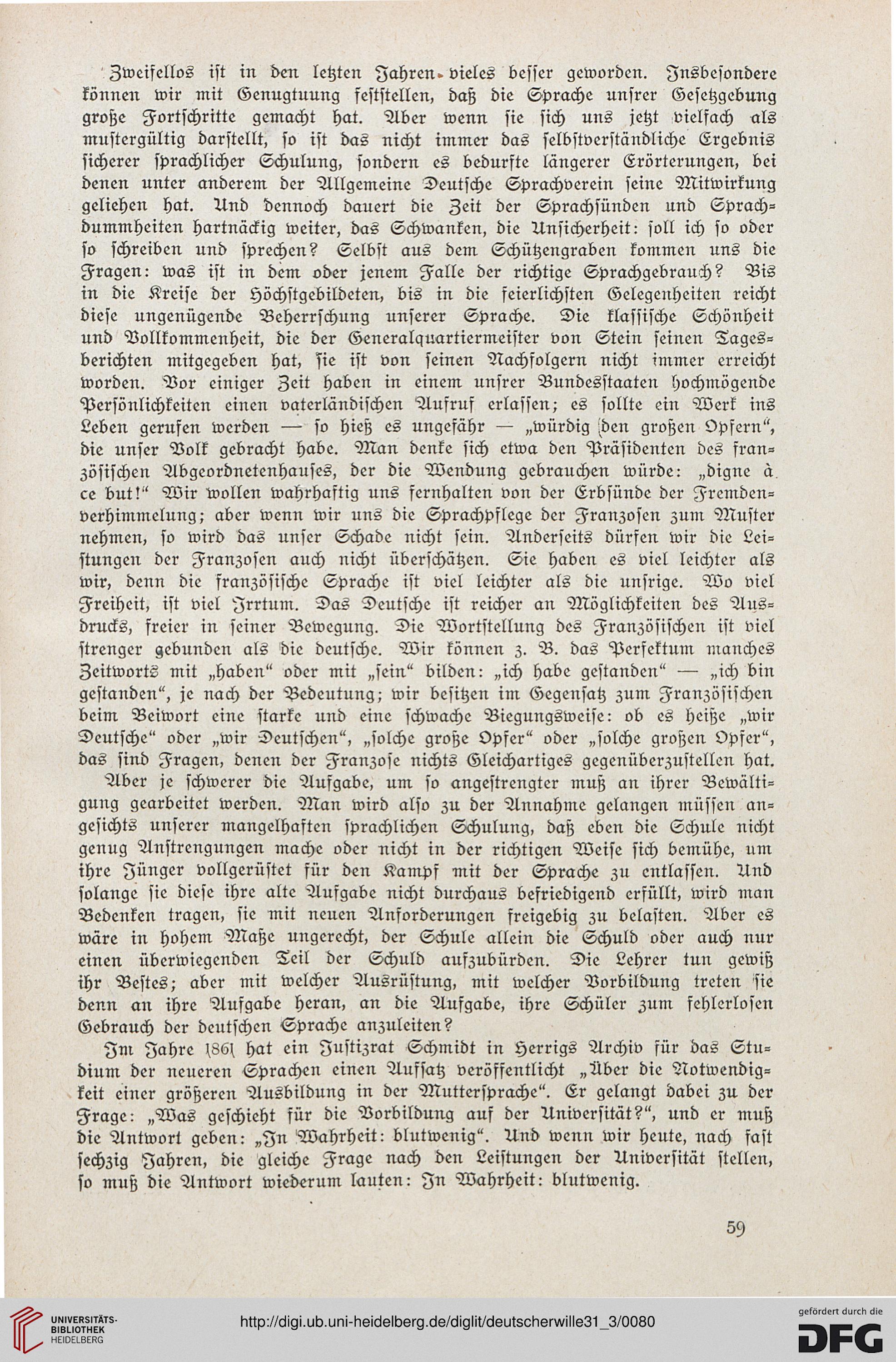Zweifcllos ist in den letzten Iahren» vieles besser geworden. Insbesondere
können wir mit Genugtnung seststellen, daß die Sprache unsrer Gesetzgebung
große Fortschritte gemacht hat. Aber wenn sie sich uns jetzt vielfach als
mustergültig darstellt, so ist das nicht immer das selbstverständliche Ergebnis
sicherer sprachlicher Schulung, sondern es bedurfte längerer Erörteruugen, bei
denen unter anderem der Allgemeine Deutsche Sprachverein seine Mitwirknng
geliehen hat. Und dennoch dauert die Zeit der Sprachsünden und Sprach-
dummheiten hartnäckig weiter, das Schwanken, die Unsicherheit: soll ich so oder
so schreiben und sprechen? Selbst aus dem Schützengraben kommen uns die
Fragen: was ist in dem oder jenem Falle der richtige Sprachgebrauch? Bis
in die Kreise der Höchstgebildeten, bis in die feierlichsten Gelegenheiten reicht
diese ungenügende Beherrschung unserer Sprache. Die klassische Schönheit
und Vollkommenheit, die der Generalquartiermeister von Stein seinen Tages-
berichten mitgegeben hat, sie ist von seinen Nachfolgern nicht immer erreicht
worden. Vor einiger Zeit haben in einem unsrer Bundesstaaten hochmögende
Persönlichkeiten einen vaterländischen Aufruf erlassen; es sollte ein Werk ins
Leben gerufen Werden — so hieß es ungefähr — „würdig jden großen Opfern",
die unser Volk gebracht habe. Man denke sich etwa den Präsidenten des fran-
zösischen Abgeordnetenhauses, der die Wendung gebrauchen würde: „digne ä
ce but!" Wir wollen wahrhaftig uns fernhalten von der Erbsünde der Fremden-
verhimmelung; aber wenn wir uns die Sprachpflege der Franzosen zum Muster
nehmen, so wird das nnser Schade nicht sein. Anderseits dürfen wir die Lei-
stungen der Franzosen auch nicht überschätzen. Sie haben es viel leichter als
wir, denn die sranzösische Sprache ist viel leichter als die unsrige. Wo viel
Freiheit, ist viel Irrtum. Das Deutsche ist reicher an Möglichkeiten des Aus-
drucks, freier in seiner Bewegung. Die Wortstellung des Französischen ist viel
strenger gcbnnden als die deutsche. Wir können z. B. das Perfektum manches
Zeitworts mit „haben" oder mit „sein" bilden: „ich habe gestanden" — „ich bin
gestanden", je nach der Pedeutung; wir besitzen im Gegensatz zum Französischen
beim Beiwort eine starkc nnd eine schwache Biegungsweise: ob es heiße „wir
Deutsche" oder „wir Deutschen", „solche große Opfer" oder „solche großen Opfer",
das sind Fragen, denen der Franzose nichts Gleichartiges gegenüberzustellen hat.
Aber je schwerer die Aufgabe, um so angestrengter muß an ihrer Bewälti-
gung gearbeitet werden. Man wird also zu der Annahme gelangen müssen an-
gesichts unserer mangelhaften sprachlichen Schulung, daß eben die Schule nicht
genug Anstrengungen mache oder nicht in der richtigen Weise sich bemühe, um
ihre Iünger vollgerüstet für den Kampf mit der Sprache zu entlassen. Und
solange sie dicse ihre alte Aufgabe nicht durchaus befriedigend erfüllt, wird man
Bedenken tragen, sie mit neuen Anforderungen freigebig zu belasten. Aber es
wäre in hohem Maße ungerecht, der Schule allein die Schuld oder auch nur
einen überwiegeuden Teil der Schuld aufzubürden. Die Lehrer tun gewiß
ihr Bestes; aber mit welcher Ausrüstung, mit welcher Vorbildung treten 'sie
denn an ihre Aufgabe heran, an die Aufgabe, ihre Schüler zum fehlerlosen
Gebrauch der deutscheu Sprache anzuleiten?
Im Iahre Ms hat ein Iustizrat Schmidt in Herrigs Archiv für das Stu-
dium der neueren Sprachen einen Aufsatz veröffentlicht „Aber die Aotwendig-
keit eincr größeren Ausbildung in der Muttersprache". Er gelangt dabei zu der
Frage: „Was geschieht für die Vorbildung auf der Aniversität?", und er muß
die Antwort geben: „In Wahrheit: blutwenig". And wenn wir heute, nach fast
sechzig Iahren, die gleiche Frage nach den Leistungen der Universität stellen,
so muß die Antwort Wiederum lauten: In Wahrheit: blutwenig.
59
können wir mit Genugtnung seststellen, daß die Sprache unsrer Gesetzgebung
große Fortschritte gemacht hat. Aber wenn sie sich uns jetzt vielfach als
mustergültig darstellt, so ist das nicht immer das selbstverständliche Ergebnis
sicherer sprachlicher Schulung, sondern es bedurfte längerer Erörteruugen, bei
denen unter anderem der Allgemeine Deutsche Sprachverein seine Mitwirknng
geliehen hat. Und dennoch dauert die Zeit der Sprachsünden und Sprach-
dummheiten hartnäckig weiter, das Schwanken, die Unsicherheit: soll ich so oder
so schreiben und sprechen? Selbst aus dem Schützengraben kommen uns die
Fragen: was ist in dem oder jenem Falle der richtige Sprachgebrauch? Bis
in die Kreise der Höchstgebildeten, bis in die feierlichsten Gelegenheiten reicht
diese ungenügende Beherrschung unserer Sprache. Die klassische Schönheit
und Vollkommenheit, die der Generalquartiermeister von Stein seinen Tages-
berichten mitgegeben hat, sie ist von seinen Nachfolgern nicht immer erreicht
worden. Vor einiger Zeit haben in einem unsrer Bundesstaaten hochmögende
Persönlichkeiten einen vaterländischen Aufruf erlassen; es sollte ein Werk ins
Leben gerufen Werden — so hieß es ungefähr — „würdig jden großen Opfern",
die unser Volk gebracht habe. Man denke sich etwa den Präsidenten des fran-
zösischen Abgeordnetenhauses, der die Wendung gebrauchen würde: „digne ä
ce but!" Wir wollen wahrhaftig uns fernhalten von der Erbsünde der Fremden-
verhimmelung; aber wenn wir uns die Sprachpflege der Franzosen zum Muster
nehmen, so wird das nnser Schade nicht sein. Anderseits dürfen wir die Lei-
stungen der Franzosen auch nicht überschätzen. Sie haben es viel leichter als
wir, denn die sranzösische Sprache ist viel leichter als die unsrige. Wo viel
Freiheit, ist viel Irrtum. Das Deutsche ist reicher an Möglichkeiten des Aus-
drucks, freier in seiner Bewegung. Die Wortstellung des Französischen ist viel
strenger gcbnnden als die deutsche. Wir können z. B. das Perfektum manches
Zeitworts mit „haben" oder mit „sein" bilden: „ich habe gestanden" — „ich bin
gestanden", je nach der Pedeutung; wir besitzen im Gegensatz zum Französischen
beim Beiwort eine starkc nnd eine schwache Biegungsweise: ob es heiße „wir
Deutsche" oder „wir Deutschen", „solche große Opfer" oder „solche großen Opfer",
das sind Fragen, denen der Franzose nichts Gleichartiges gegenüberzustellen hat.
Aber je schwerer die Aufgabe, um so angestrengter muß an ihrer Bewälti-
gung gearbeitet werden. Man wird also zu der Annahme gelangen müssen an-
gesichts unserer mangelhaften sprachlichen Schulung, daß eben die Schule nicht
genug Anstrengungen mache oder nicht in der richtigen Weise sich bemühe, um
ihre Iünger vollgerüstet für den Kampf mit der Sprache zu entlassen. Und
solange sie dicse ihre alte Aufgabe nicht durchaus befriedigend erfüllt, wird man
Bedenken tragen, sie mit neuen Anforderungen freigebig zu belasten. Aber es
wäre in hohem Maße ungerecht, der Schule allein die Schuld oder auch nur
einen überwiegeuden Teil der Schuld aufzubürden. Die Lehrer tun gewiß
ihr Bestes; aber mit welcher Ausrüstung, mit welcher Vorbildung treten 'sie
denn an ihre Aufgabe heran, an die Aufgabe, ihre Schüler zum fehlerlosen
Gebrauch der deutscheu Sprache anzuleiten?
Im Iahre Ms hat ein Iustizrat Schmidt in Herrigs Archiv für das Stu-
dium der neueren Sprachen einen Aufsatz veröffentlicht „Aber die Aotwendig-
keit eincr größeren Ausbildung in der Muttersprache". Er gelangt dabei zu der
Frage: „Was geschieht für die Vorbildung auf der Aniversität?", und er muß
die Antwort geben: „In Wahrheit: blutwenig". And wenn wir heute, nach fast
sechzig Iahren, die gleiche Frage nach den Leistungen der Universität stellen,
so muß die Antwort Wiederum lauten: In Wahrheit: blutwenig.
59