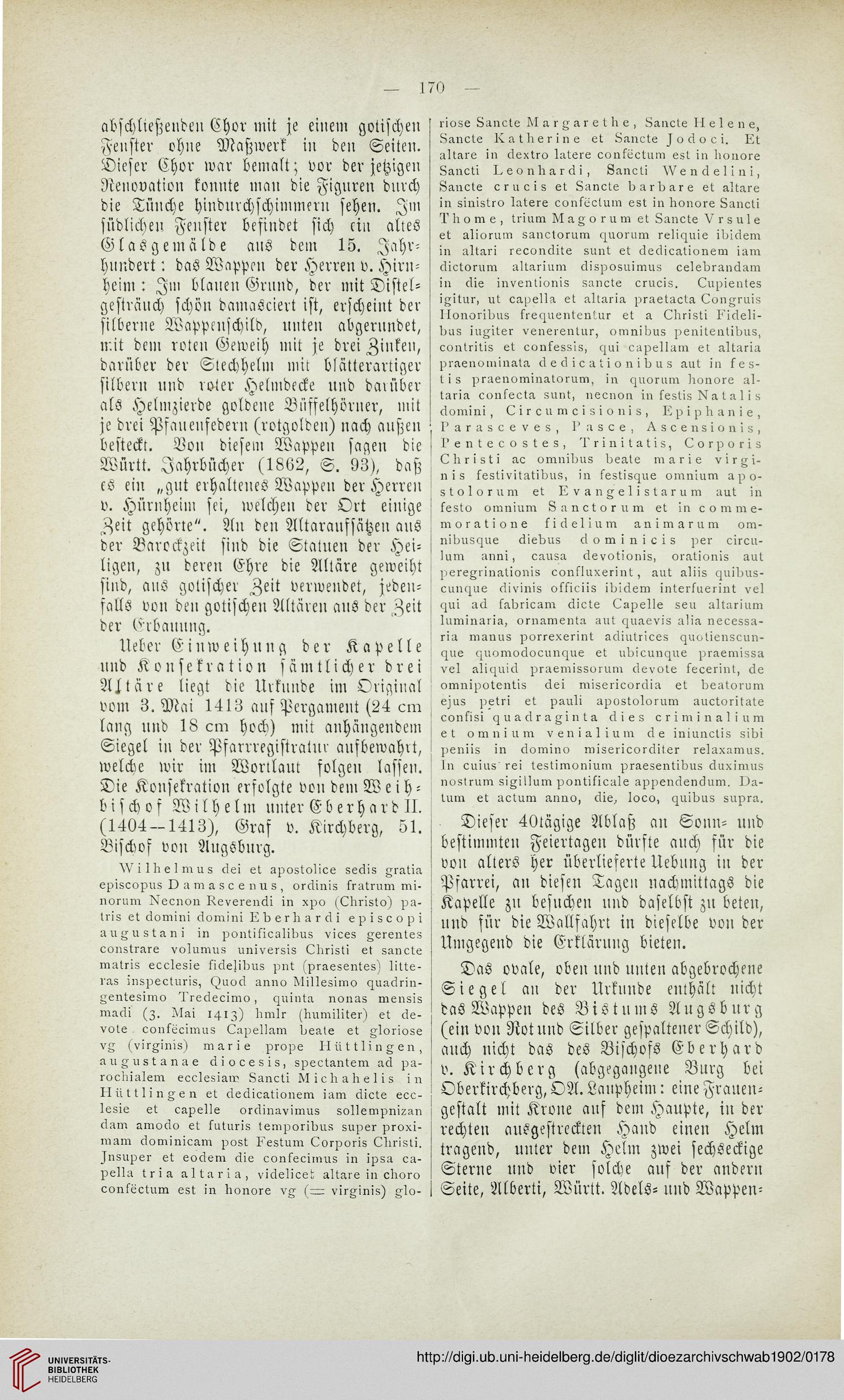170
abschließenden Chor mit je einem gotischen
Fenster ohne Maßwerk in den Seiten.
Dieser Chor war bemalt; vor der jetzigen
Renovation konnte man die Figuren durch
die Tünche hindnrchschimmern sehen. Im
südlicher: Fenster befindet sich ein alles
Glasgemälde ans dem 15. Jahr-
hundert : das Wappen der Herren v. Hirn-
heim : Im blauen Grund, der mit Distel-
gesträuch schön damasciert ist, erscheint der
silberne Wappenschild, unten abgerundet,
mit dem roten Geweih mit je drei Zinken,
darüber der Stechhelm mit bläiterartiger
silbern und roter Helmdecke und darüber
als Helmzierde goldene Büffelhörner, mit
je drei Pfauenfedern (rotgolden) nach außen
besteckt. Von diesen: Wappen sagen die -
Württ. Jahrbücher (1862, S. 93), daß
cs ein „gut erhaltenes Wappen der Herren
v. Hürnheim sei, welchen der Ort einige
Zeit gehörte". An den Altaranfsätzen aus
der Barockzeit sind die Statuen der Hei-
ligen, zu deren Chre die Altäre geweiht
sind, ans gotischer Zeit verwendet, jeden-
falls von den gotischen Altären ans der Zeit
der Crbannng.
lieber Einweihung der Kapelle
und Konsekration sämtlicher drei
Altäre liegt die Urkunde im Original
vom 3. Mai 1413 ans Pergament (24 cm
lang und 18 cm hoch) mit anhängendem
Siegel in der Pfarrregistratur anfbewahrt,
welche wir im Wortlaut folgen lassen.
Die Konsekration erfolgte von den: Weih-
bischof Wilhelm unter Eberhard II.
(1404-1413), Graf v. Kirchberg, 51.
Bischof von Augsburg.
V/i l li e l IN u 8 ctei et axo8tolice seNis gratis.
epi8copu8 O a in a 8 c s n u 8 , or<lini8 fratruin rni-
noruin l>iecnon Ileverencli in xpo (LNri8io) pa-
M8 et ilornini cloinioi Lverliarcli epi 8 eopi
au§u8tani in pontikicalilni8 vice8 §erentS3
coiMrare voluinu8 univer8i3 LNri8ti et 8s.ncte
inatri3 eccle3is 1iclelivn8 pnt Iprae8snts8) litte-
i'L8 in8pecturi8, ()uoct anno lUiIls8imo c^uaUrin-
§ent68imo Irecleciino, Quinta nona8 rnen3i3
inaili (z. I^lai 141z) Nmlr (lininiliter) et ile-
vote con1eciinu8 Lapeliarn Veale et §lorio8s
v§ (virAin!8) inaris props l4nttliii§en,
auAN8tanae cl i o c s 8 i 3, 8peclantein aci ^a-
rocliialsin eecls3iaw Lancti i c li a li e l i 8 in
INüttlinZen et clsclicationein iain Niete eec-
Ie8ie et capelie orclinaviinu8 8oliempniran
clain ainoclo et snturi3 teniporivn8 super proxi-
main cloininicain p08t l?e8tuin Lorpori8 LNir>8ti.
1n8Uper et eoclsm Nie consscimu3 in ip8a ca-
pella tria altaria, viäelicet altare in clioro
conlecturn e8t in lionore v§ (— virAini8) §Io-
rio8e 8ancte k»larALrsrIi6, 8aneie NisIsns,
8ancts Xatlrerins et 8anels 1 o ä o c i. Lt
altare in clsxtro latere conlectum esl in lionors
8ancti l^eonliaräi, 8ancü ^Venäelini,
8ancte cruci8 et 8ancte dar da re et altare
in 8ini8tro latere confeetuin e8t in Nonore 8ancti
^l' Noin e , triurn lVlaA o ruin st 8ancts V r 8 uls
et aliorum 8anetorum c^uorurn reli^uis ivictern
iHtur, nt capeila et altaria praetacta Lon§rni8
Ilonoril>u8 krei^usntentur et a Olrri8ti Nicteli-
1>N8 iu^iter venerentur, omnil)U8 peniientil>u3,
contrit>8 et eonkes8i8, c^ui capellana et altaria
prasnoiuinaia cleNieationil>u8 aut in fe 3-
taria conlecta 8nnt, nscnon in ks8ti8 Nla ta l i 8
cloinini, Lirenrnci8ioni8, p i p li a n ! e ,
Nara8eeve8, ? a 3 e e , ^3cen8ioni3,
Nenteco3te3, 1 r i n i t a tis, Lorpori 3
<7liri8ti ae ornnil>u8 veate rnarie v i r A i-
ni8 5s8tivitatidn8, in fe8ti8ciue oinniuin apo-
8toloruin et lüvan§eli8taruin ant in
fe3to ornniurn 8anctornrn et in c o in in e-
no8trurn 8iAiilnrn pontilicals appenclenönm. Oa-
tnni et aetnrn anno, clie^ loco, Hnivn8 8upra.
Dieser 40tägige Ablaß an Sonn- und
bestimmten Feiertagen dürfte auch für die
von aliers her überlieferte Uebnng in der
Pfarrei, an diesen Tagen nachmittags die
Kapelle zu besuchen und daselbst zu beteu,
und für die Wallfahrt in dieselbe von der
Umgegend die Erklärung bieten.
Das ovale, oben und unten abgebrochene
Siegel an der Urkunde enthält nicht
das Wappen des Bistums Augsburg
(ein von Rot und Silber gespaltener Schild),
auch nicht das des Bischofs Eberhard
v. Kirchberg (abgegangene Burg bei
Oberkirchberg, OA. Lanpheim: eine Frauen-
gestalt mit Krone auf dem Haupte, in der
rechten ausgestreckren Hand einen Helm
tragend, unter dem Helm zwei sechseckige
Sterne und vier solche auf der andern
Seite, Alberti, Württ. Adels- und Wappen-
abschließenden Chor mit je einem gotischen
Fenster ohne Maßwerk in den Seiten.
Dieser Chor war bemalt; vor der jetzigen
Renovation konnte man die Figuren durch
die Tünche hindnrchschimmern sehen. Im
südlicher: Fenster befindet sich ein alles
Glasgemälde ans dem 15. Jahr-
hundert : das Wappen der Herren v. Hirn-
heim : Im blauen Grund, der mit Distel-
gesträuch schön damasciert ist, erscheint der
silberne Wappenschild, unten abgerundet,
mit dem roten Geweih mit je drei Zinken,
darüber der Stechhelm mit bläiterartiger
silbern und roter Helmdecke und darüber
als Helmzierde goldene Büffelhörner, mit
je drei Pfauenfedern (rotgolden) nach außen
besteckt. Von diesen: Wappen sagen die -
Württ. Jahrbücher (1862, S. 93), daß
cs ein „gut erhaltenes Wappen der Herren
v. Hürnheim sei, welchen der Ort einige
Zeit gehörte". An den Altaranfsätzen aus
der Barockzeit sind die Statuen der Hei-
ligen, zu deren Chre die Altäre geweiht
sind, ans gotischer Zeit verwendet, jeden-
falls von den gotischen Altären ans der Zeit
der Crbannng.
lieber Einweihung der Kapelle
und Konsekration sämtlicher drei
Altäre liegt die Urkunde im Original
vom 3. Mai 1413 ans Pergament (24 cm
lang und 18 cm hoch) mit anhängendem
Siegel in der Pfarrregistratur anfbewahrt,
welche wir im Wortlaut folgen lassen.
Die Konsekration erfolgte von den: Weih-
bischof Wilhelm unter Eberhard II.
(1404-1413), Graf v. Kirchberg, 51.
Bischof von Augsburg.
V/i l li e l IN u 8 ctei et axo8tolice seNis gratis.
epi8copu8 O a in a 8 c s n u 8 , or<lini8 fratruin rni-
noruin l>iecnon Ileverencli in xpo (LNri8io) pa-
M8 et ilornini cloinioi Lverliarcli epi 8 eopi
au§u8tani in pontikicalilni8 vice8 §erentS3
coiMrare voluinu8 univer8i3 LNri8ti et 8s.ncte
inatri3 eccle3is 1iclelivn8 pnt Iprae8snts8) litte-
i'L8 in8pecturi8, ()uoct anno lUiIls8imo c^uaUrin-
§ent68imo Irecleciino, Quinta nona8 rnen3i3
inaili (z. I^lai 141z) Nmlr (lininiliter) et ile-
vote con1eciinu8 Lapeliarn Veale et §lorio8s
v§ (virAin!8) inaris props l4nttliii§en,
auAN8tanae cl i o c s 8 i 3, 8peclantein aci ^a-
rocliialsin eecls3iaw Lancti i c li a li e l i 8 in
INüttlinZen et clsclicationein iain Niete eec-
Ie8ie et capelie orclinaviinu8 8oliempniran
clain ainoclo et snturi3 teniporivn8 super proxi-
main cloininicain p08t l?e8tuin Lorpori8 LNir>8ti.
1n8Uper et eoclsm Nie consscimu3 in ip8a ca-
pella tria altaria, viäelicet altare in clioro
conlecturn e8t in lionore v§ (— virAini8) §Io-
rio8e 8ancte k»larALrsrIi6, 8aneie NisIsns,
8ancts Xatlrerins et 8anels 1 o ä o c i. Lt
altare in clsxtro latere conlectum esl in lionors
8ancti l^eonliaräi, 8ancü ^Venäelini,
8ancte cruci8 et 8ancte dar da re et altare
in 8ini8tro latere confeetuin e8t in Nonore 8ancti
^l' Noin e , triurn lVlaA o ruin st 8ancts V r 8 uls
et aliorum 8anetorum c^uorurn reli^uis ivictern
iHtur, nt capeila et altaria praetacta Lon§rni8
Ilonoril>u8 krei^usntentur et a Olrri8ti Nicteli-
1>N8 iu^iter venerentur, omnil)U8 peniientil>u3,
contrit>8 et eonkes8i8, c^ui capellana et altaria
prasnoiuinaia cleNieationil>u8 aut in fe 3-
taria conlecta 8nnt, nscnon in ks8ti8 Nla ta l i 8
cloinini, Lirenrnci8ioni8, p i p li a n ! e ,
Nara8eeve8, ? a 3 e e , ^3cen8ioni3,
Nenteco3te3, 1 r i n i t a tis, Lorpori 3
<7liri8ti ae ornnil>u8 veate rnarie v i r A i-
ni8 5s8tivitatidn8, in fe8ti8ciue oinniuin apo-
8toloruin et lüvan§eli8taruin ant in
fe3to ornniurn 8anctornrn et in c o in in e-
no8trurn 8iAiilnrn pontilicals appenclenönm. Oa-
tnni et aetnrn anno, clie^ loco, Hnivn8 8upra.
Dieser 40tägige Ablaß an Sonn- und
bestimmten Feiertagen dürfte auch für die
von aliers her überlieferte Uebnng in der
Pfarrei, an diesen Tagen nachmittags die
Kapelle zu besuchen und daselbst zu beteu,
und für die Wallfahrt in dieselbe von der
Umgegend die Erklärung bieten.
Das ovale, oben und unten abgebrochene
Siegel an der Urkunde enthält nicht
das Wappen des Bistums Augsburg
(ein von Rot und Silber gespaltener Schild),
auch nicht das des Bischofs Eberhard
v. Kirchberg (abgegangene Burg bei
Oberkirchberg, OA. Lanpheim: eine Frauen-
gestalt mit Krone auf dem Haupte, in der
rechten ausgestreckren Hand einen Helm
tragend, unter dem Helm zwei sechseckige
Sterne und vier solche auf der andern
Seite, Alberti, Württ. Adels- und Wappen-