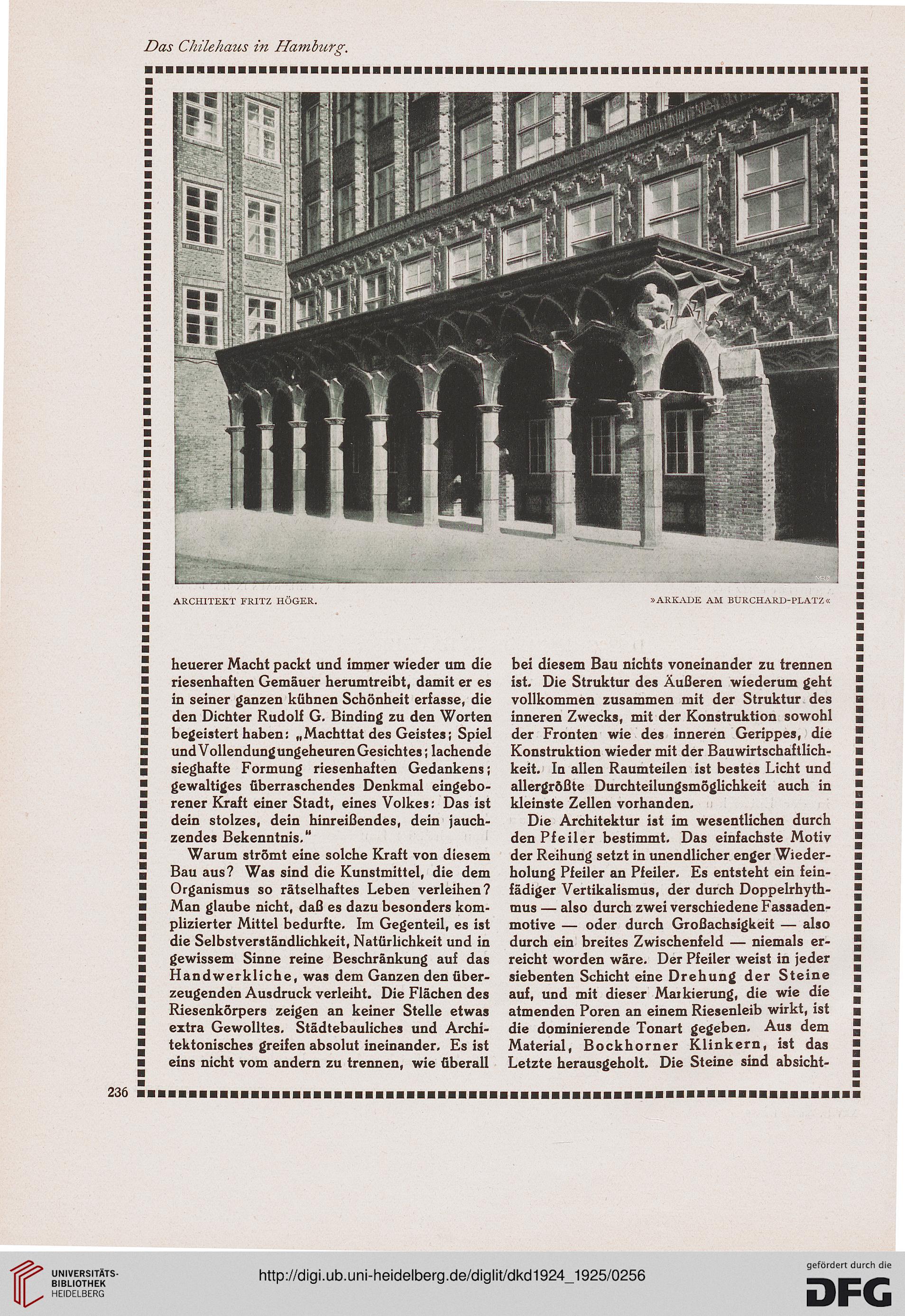Das Chilehaus in Hamburg.
ARCHITEKT FRITZ HOGER.
»ARKADE AM BURCHARD-PLATZ«
heuerer Macht packt und immer wieder um die
riesenhaften Gemäuer herumtreibt, damit er es
in seiner ganzen kühnen Schönheit erfasse, die
den Dichter Rudolf G. Binding zu den Worten
begeistert haben: „Machttat des Geistes; Spiel
und Vollendung ungeheuren Gesichtes; lachende
sieghafte Formung riesenhaften Gedankens;
gewaltiges überraschendes Denkmal eingebo-
rener Kraft einer Stadt, eines Volkes: Das ist
dein stolzes, dein hinreißendes, dein jauch-
zendes Bekenntnis."
Warum strömt eine solche Kraft von diesem
Bau aus? Was sind die Kunstmittel, die dem
Organismus so rätselhaftes Leben verleihen?
Man glaube nicht, daß es dazu besonders kom-
plizierter Mittel bedurfte. Im Gegenteil, es ist
die Selbstverständlichkeit, Natürlichkeit und in
gewissem Sinne reine Beschränkung auf das
Handwerkliche, was dem Ganzen den über-
zeugenden Ausdruck verleiht. Die Flächen des
Riesenkörpers zeigen an keiner Stelle etwas
extra Gewolltes. Städtebauliches und Archi-
tektonisches greifen absolut ineinander. Es ist
eins nicht vom andern zu trennen, wie überall
bei diesem Bau nichts voneinander zu trennen
ist. Die Struktur des Äußeren wiederum geht
vollkommen zusammen mit der Struktur des
inneren Zwecks, mit der Konstruktion sowohl
der Fronten wie des inneren Gerippes, die
Konstruktion wieder mit der Bauwirtschaftlich-
keit. In allen Raumteilen ist bestes Licht und
allergrößte Durchteilungsmöglichkeit auch in
kleinste Zellen vorhanden.
Die Architektur ist im wesentlichen durch
den Pfeiler bestimmt. Das einfachste Motiv
der Reihung setzt in unendlicher enger Wieder-
holung Pfeiler an Pfeiler. Es entsteht ein fein-
fädiger Vertikalismus, der durch Doppelrhyth-
mus — also durch zwei verschiedene Fassaden-
motive — oder durch Großachsigkeit — also
durch ein breites Zwischenfeld — niemals er-
reicht worden wäre. Der Pfeiler weist in jeder
siebenten Schicht eine Drehung der Steine
auf, und mit dieser Markierung, die wie die
atmenden Poren an einem Riesenleib wirkt, ist
die dominierende Tonart gegeben. Aus dem
Material, Bockhorner Klinkern, ist das
Letzte herausgeholt. Die Steine sind absieht-
ARCHITEKT FRITZ HOGER.
»ARKADE AM BURCHARD-PLATZ«
heuerer Macht packt und immer wieder um die
riesenhaften Gemäuer herumtreibt, damit er es
in seiner ganzen kühnen Schönheit erfasse, die
den Dichter Rudolf G. Binding zu den Worten
begeistert haben: „Machttat des Geistes; Spiel
und Vollendung ungeheuren Gesichtes; lachende
sieghafte Formung riesenhaften Gedankens;
gewaltiges überraschendes Denkmal eingebo-
rener Kraft einer Stadt, eines Volkes: Das ist
dein stolzes, dein hinreißendes, dein jauch-
zendes Bekenntnis."
Warum strömt eine solche Kraft von diesem
Bau aus? Was sind die Kunstmittel, die dem
Organismus so rätselhaftes Leben verleihen?
Man glaube nicht, daß es dazu besonders kom-
plizierter Mittel bedurfte. Im Gegenteil, es ist
die Selbstverständlichkeit, Natürlichkeit und in
gewissem Sinne reine Beschränkung auf das
Handwerkliche, was dem Ganzen den über-
zeugenden Ausdruck verleiht. Die Flächen des
Riesenkörpers zeigen an keiner Stelle etwas
extra Gewolltes. Städtebauliches und Archi-
tektonisches greifen absolut ineinander. Es ist
eins nicht vom andern zu trennen, wie überall
bei diesem Bau nichts voneinander zu trennen
ist. Die Struktur des Äußeren wiederum geht
vollkommen zusammen mit der Struktur des
inneren Zwecks, mit der Konstruktion sowohl
der Fronten wie des inneren Gerippes, die
Konstruktion wieder mit der Bauwirtschaftlich-
keit. In allen Raumteilen ist bestes Licht und
allergrößte Durchteilungsmöglichkeit auch in
kleinste Zellen vorhanden.
Die Architektur ist im wesentlichen durch
den Pfeiler bestimmt. Das einfachste Motiv
der Reihung setzt in unendlicher enger Wieder-
holung Pfeiler an Pfeiler. Es entsteht ein fein-
fädiger Vertikalismus, der durch Doppelrhyth-
mus — also durch zwei verschiedene Fassaden-
motive — oder durch Großachsigkeit — also
durch ein breites Zwischenfeld — niemals er-
reicht worden wäre. Der Pfeiler weist in jeder
siebenten Schicht eine Drehung der Steine
auf, und mit dieser Markierung, die wie die
atmenden Poren an einem Riesenleib wirkt, ist
die dominierende Tonart gegeben. Aus dem
Material, Bockhorner Klinkern, ist das
Letzte herausgeholt. Die Steine sind absieht-