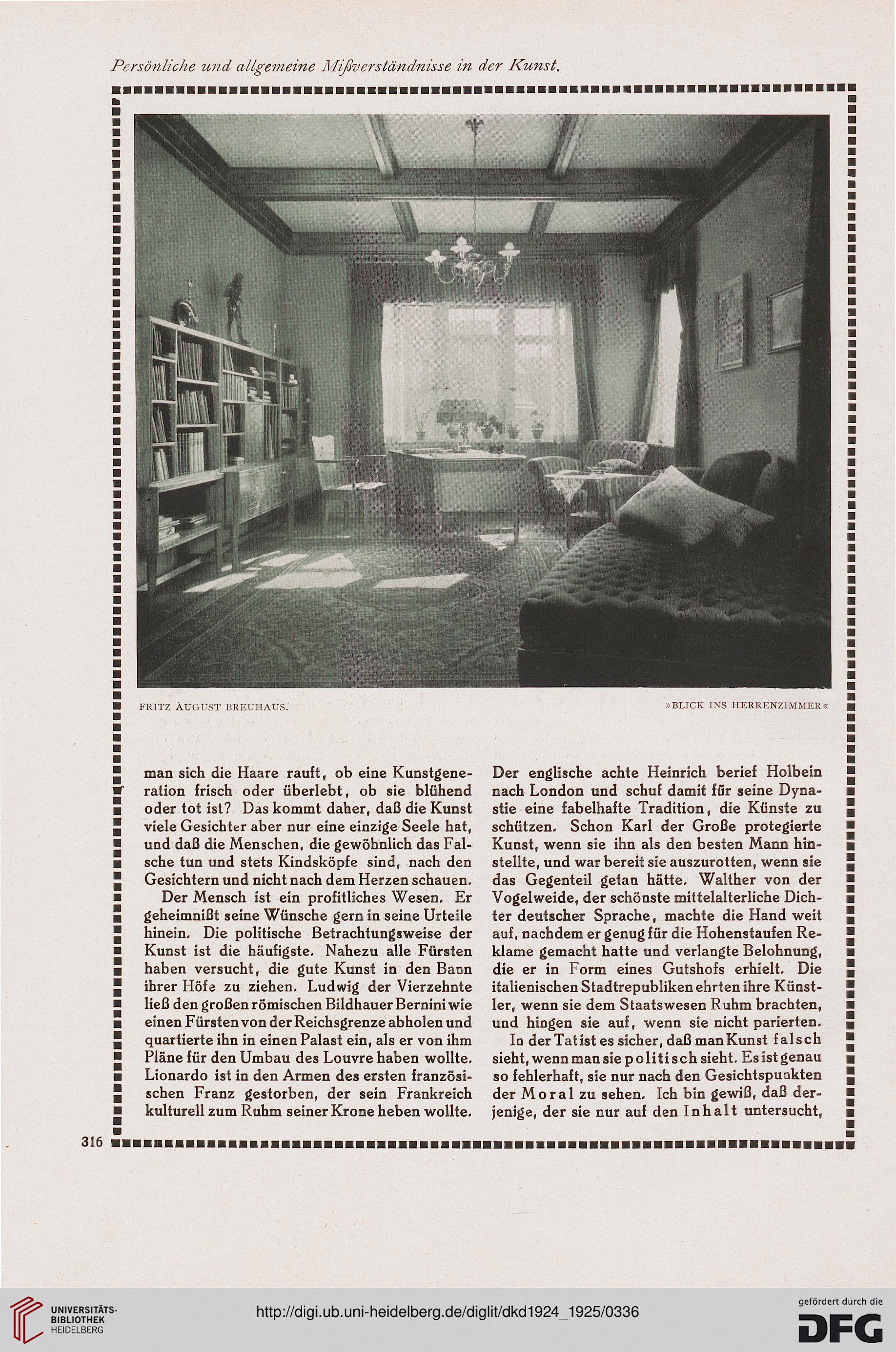Persönliche und allgemeine Alißverständnisse in der Kunst.
FRITZ AUC.rST liRKUHAUS.
»BLrCK INS HERRENZIMMER«
man sich die Haare rauft, ob eine Kunstgene-
ration frisch oder überlebt, ob sie blühend
oder tot ist? Das kommt daher, daß die Kunst
viele Gesichter aber nur eine einzige Seele hat,
und daß die Menschen, die gewöhnlich das Fal-
sche tun und stets Kindsköpfe sind, nach den
Gesichtern und nicht nach dem Herzen schauen.
Der Mensch ist ein profitliches Wesen. Er
geheimnißt seine Wünsche gern in seine Urteile
hinein. Die politische Betrachtungsweise der
Kunst ist die häufigste. Nahezu alle Fürsten
haben versucht, die gute Kunst in den Bann
ihrer Höfe zu ziehen. Ludwig der Vierzehnte
ließ den großen römischen Bildhauer Bernini wie
einen Fürsten von der Reichsgrenze abholen und
quartierte ihn in einen Palast ein, als er von ihm
Pläne für den Umbau des Louvre haben wollte.
Lionardo ist in den Armen des ersten französi-
schen Franz gestorben, der sein Frankreich
kulturell zum Ruhm seiner Krone heben wollte.
Der englische achte Heinrich berief Holbein
nach London und schuf damit für seine Dyna-
stie eine fabelhafte Tradition, die Künste zu
schützen. Schon Karl der Große protegierte
Kunst, wenn sie ihn als den besten Mann hin-
stellte, und war bereit sie auszurotten, wenn sie
das Gegenteil getan hätte. Walther von der
Vogelweide, der schönste mittelalterliche Dich-
ter deutscher Sprache, machte die Hand weit
auf, nachdem er genug für die Hohenstaufen Re-
klame gemacht hatte und verlangte Belohnung,
die er in Form eines Gutshofs erhielt. Die
italienischen Stadtrepubliken ehrten ihre Künst-
ler, wenn sie dem Staatswesen Ruhm brachten,
und hingen sie auf, wenn sie nicht parierten.
In der Tat ist es sicher, daß man Kunst falsch
sieht, wenn man sie politisch sieht. Es ist genau
so fehlerhaft, sie nur nach den Gesichtspunkten
der Moral zu sehen. Ich bin gewiß, daß der-
jenige, der sie nur auf den Inhalt untersucht,
FRITZ AUC.rST liRKUHAUS.
»BLrCK INS HERRENZIMMER«
man sich die Haare rauft, ob eine Kunstgene-
ration frisch oder überlebt, ob sie blühend
oder tot ist? Das kommt daher, daß die Kunst
viele Gesichter aber nur eine einzige Seele hat,
und daß die Menschen, die gewöhnlich das Fal-
sche tun und stets Kindsköpfe sind, nach den
Gesichtern und nicht nach dem Herzen schauen.
Der Mensch ist ein profitliches Wesen. Er
geheimnißt seine Wünsche gern in seine Urteile
hinein. Die politische Betrachtungsweise der
Kunst ist die häufigste. Nahezu alle Fürsten
haben versucht, die gute Kunst in den Bann
ihrer Höfe zu ziehen. Ludwig der Vierzehnte
ließ den großen römischen Bildhauer Bernini wie
einen Fürsten von der Reichsgrenze abholen und
quartierte ihn in einen Palast ein, als er von ihm
Pläne für den Umbau des Louvre haben wollte.
Lionardo ist in den Armen des ersten französi-
schen Franz gestorben, der sein Frankreich
kulturell zum Ruhm seiner Krone heben wollte.
Der englische achte Heinrich berief Holbein
nach London und schuf damit für seine Dyna-
stie eine fabelhafte Tradition, die Künste zu
schützen. Schon Karl der Große protegierte
Kunst, wenn sie ihn als den besten Mann hin-
stellte, und war bereit sie auszurotten, wenn sie
das Gegenteil getan hätte. Walther von der
Vogelweide, der schönste mittelalterliche Dich-
ter deutscher Sprache, machte die Hand weit
auf, nachdem er genug für die Hohenstaufen Re-
klame gemacht hatte und verlangte Belohnung,
die er in Form eines Gutshofs erhielt. Die
italienischen Stadtrepubliken ehrten ihre Künst-
ler, wenn sie dem Staatswesen Ruhm brachten,
und hingen sie auf, wenn sie nicht parierten.
In der Tat ist es sicher, daß man Kunst falsch
sieht, wenn man sie politisch sieht. Es ist genau
so fehlerhaft, sie nur nach den Gesichtspunkten
der Moral zu sehen. Ich bin gewiß, daß der-
jenige, der sie nur auf den Inhalt untersucht,