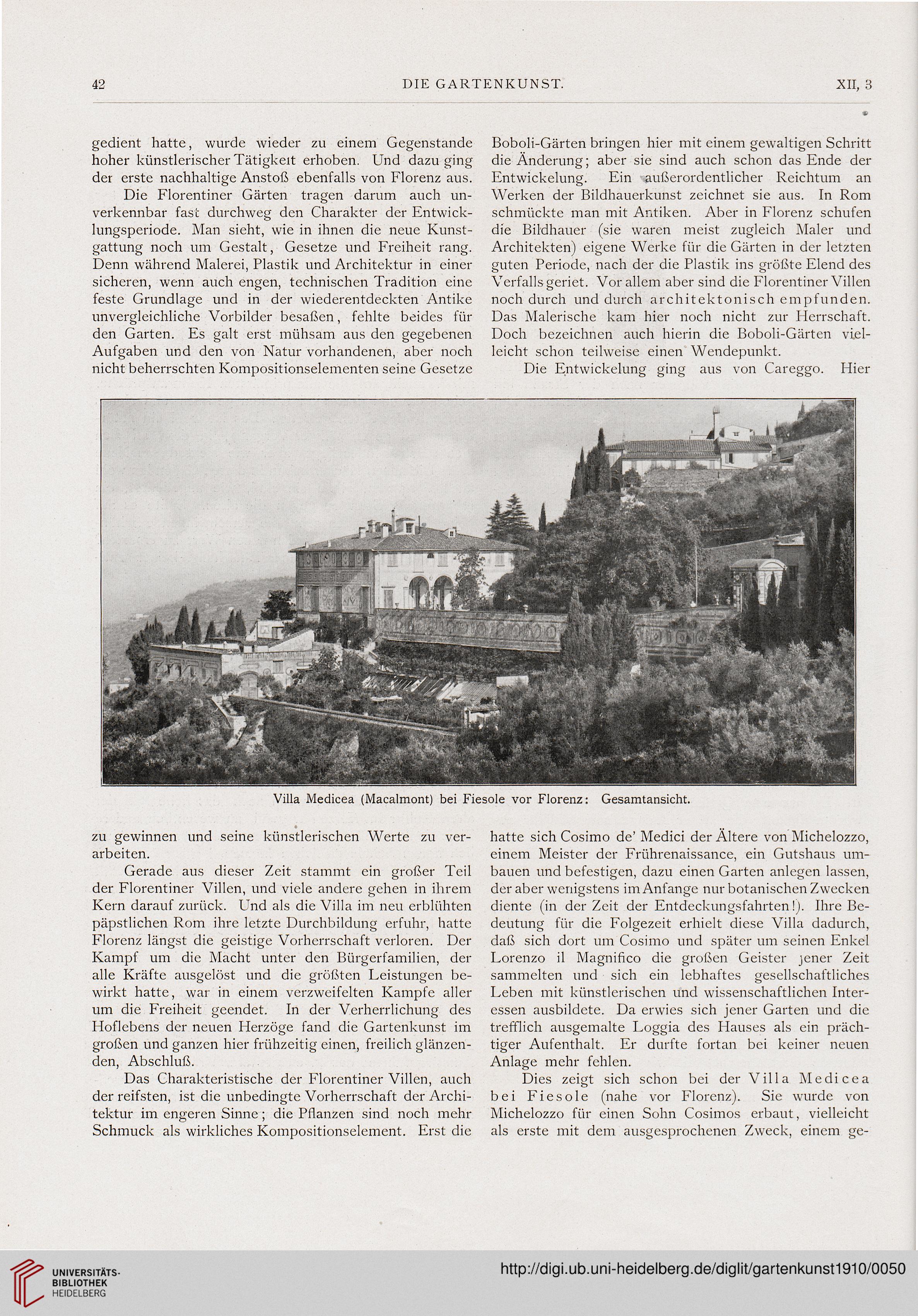42
DIE GARTENKUNST.
XII, 3
gedient hatte, wurde wieder zu einem Gegenstande
hoher künstlerischer Tätigkeit erhoben. Und dazu ging
der erste nachhaltige Anstoß ebenfalls von Florenz aus.
Die Florentiner Gärten tragen darum auch un-
verkennbar fast durchweg den Charakter der Entwick-
lungsperiode. Man sieht, wie in ihnen die neue Kunst-
gattung noch um Gestalt, Gesetze und Freiheit rang.
Denn während Malerei, Plastik und Architektur in einer
sicheren, wenn auch engen, technischen Tradition eine
feste Grundlage und in der wiederentdeckten Antike
unvergleichliche Vorbilder besaßen, fehlte beides für
den Garten. Es galt erst mühsam aus den gegebenen
Aufgaben und den von Natur vorhandenen, aber noch
nicht beherrschten Kompositionselementen seine Gesetze
zu gewinnen und seine künstlerischen Werte zu ver-
arbeiten.
Gerade aus dieser Zeit stammt ein großer Teil
der Florentiner Villen, und viele andere gehen in ihrem
Kern darauf zurück. Und als die Villa im neu erblühten
päpstlichen Rom ihre letzte Durchbildung erfuhr, hatte
Florenz längst die geistige Vorherrschaft verloren. Der
Kampf um die Macht unter den Bürgerfamilien, der
alle Kräfte ausgelöst und die größten Leistungen be-
wirkt hatte, war in einem verzweifelten Kampfe aller
um die Freiheit geendet. In der Verherrlichung des
Hoflebens der neuen Herzöge fand die Gartenkunst im
großen und ganzen hier frühzeitig einen, freilich glänzen-
den, Abschluß.
Das Charakteristische der Florentiner Villen, auch
der reifsten, ist die unbedingte Vorherrschaft der Archi-
tektur im engeren Sinne; die Pflanzen sind noch mehr
Schmuck als wirkliches Kompositionselement. Erst die
Boboli-Gärten bringen hier mit einem gewaltigen Schritt
die Änderung; aber sie sind auch schon das Ende der
Entwickelung. Ein 'außerordentlicher Reichtum an
Werken der Bildhauerkunst zeichnet sie aus. In Rom
schmückte man mit Antiken. Aber in Florenz schufen
die Bildhauer (sie waren meist zugleich Maler und
Architekten) eigene Werke für die Gärten in der letzten
guten Periode, nach der die Plastik ins größte Elend des
Verfalls geriet. Vor allem aber sind die Florentiner Villen
noch durch und durch architektonisch empfunden.
Das Malerische kam hier noch nicht zur Herrschaft.
Doch bezeichnen auch hierin die Boboli-Gärten viel-
leicht schon teilweise einen Wendepunkt.
Die Entwickelung ging aus von Careggo. Hier
hatte sich Cosimo de' Medici der Ältere von Michelozzo,
einem Meister der Frührenaissance, ein Gutshaus um-
bauen und befestigen, dazu einen Garten anlegen lassen,
der aber wenigstens im Anfange nur botanischen Zwecken
diente (in der Zeit der Entdeckungsfahrten!). Ihre Be-
deutung für die Folgezeit erhielt diese Villa dadurch,
daß sich dort um Cosimo und später um seinen Enkel
Lorenzo il Magnifico die großen Geister jener Zeit
sammelten und sich ein lebhaftes gesellschaftliches
Leben mit künstlerischen und wissenschaftlichen Inter-
essen ausbildete. Da erwies sich jener Garten und die
trefflich ausgemalte Loggia des Hauses als ein präch-
tiger Aufenthalt. Er durfte fortan bei keiner neuen
Anlage mehr fehlen.
Dies zeigt sich schon bei der Villa Medicea
bei Fiesole (nahe vor Florenz). Sie wurde von
Michelozzo für einen Sohn Cosimos erbaut, vielleicht
als erste mit dem ausgesprochenen Zweck, einem ge-
Villa Medicea (Macalmont) bei Fiesole vor Florenz: Gesamtansicht.
DIE GARTENKUNST.
XII, 3
gedient hatte, wurde wieder zu einem Gegenstande
hoher künstlerischer Tätigkeit erhoben. Und dazu ging
der erste nachhaltige Anstoß ebenfalls von Florenz aus.
Die Florentiner Gärten tragen darum auch un-
verkennbar fast durchweg den Charakter der Entwick-
lungsperiode. Man sieht, wie in ihnen die neue Kunst-
gattung noch um Gestalt, Gesetze und Freiheit rang.
Denn während Malerei, Plastik und Architektur in einer
sicheren, wenn auch engen, technischen Tradition eine
feste Grundlage und in der wiederentdeckten Antike
unvergleichliche Vorbilder besaßen, fehlte beides für
den Garten. Es galt erst mühsam aus den gegebenen
Aufgaben und den von Natur vorhandenen, aber noch
nicht beherrschten Kompositionselementen seine Gesetze
zu gewinnen und seine künstlerischen Werte zu ver-
arbeiten.
Gerade aus dieser Zeit stammt ein großer Teil
der Florentiner Villen, und viele andere gehen in ihrem
Kern darauf zurück. Und als die Villa im neu erblühten
päpstlichen Rom ihre letzte Durchbildung erfuhr, hatte
Florenz längst die geistige Vorherrschaft verloren. Der
Kampf um die Macht unter den Bürgerfamilien, der
alle Kräfte ausgelöst und die größten Leistungen be-
wirkt hatte, war in einem verzweifelten Kampfe aller
um die Freiheit geendet. In der Verherrlichung des
Hoflebens der neuen Herzöge fand die Gartenkunst im
großen und ganzen hier frühzeitig einen, freilich glänzen-
den, Abschluß.
Das Charakteristische der Florentiner Villen, auch
der reifsten, ist die unbedingte Vorherrschaft der Archi-
tektur im engeren Sinne; die Pflanzen sind noch mehr
Schmuck als wirkliches Kompositionselement. Erst die
Boboli-Gärten bringen hier mit einem gewaltigen Schritt
die Änderung; aber sie sind auch schon das Ende der
Entwickelung. Ein 'außerordentlicher Reichtum an
Werken der Bildhauerkunst zeichnet sie aus. In Rom
schmückte man mit Antiken. Aber in Florenz schufen
die Bildhauer (sie waren meist zugleich Maler und
Architekten) eigene Werke für die Gärten in der letzten
guten Periode, nach der die Plastik ins größte Elend des
Verfalls geriet. Vor allem aber sind die Florentiner Villen
noch durch und durch architektonisch empfunden.
Das Malerische kam hier noch nicht zur Herrschaft.
Doch bezeichnen auch hierin die Boboli-Gärten viel-
leicht schon teilweise einen Wendepunkt.
Die Entwickelung ging aus von Careggo. Hier
hatte sich Cosimo de' Medici der Ältere von Michelozzo,
einem Meister der Frührenaissance, ein Gutshaus um-
bauen und befestigen, dazu einen Garten anlegen lassen,
der aber wenigstens im Anfange nur botanischen Zwecken
diente (in der Zeit der Entdeckungsfahrten!). Ihre Be-
deutung für die Folgezeit erhielt diese Villa dadurch,
daß sich dort um Cosimo und später um seinen Enkel
Lorenzo il Magnifico die großen Geister jener Zeit
sammelten und sich ein lebhaftes gesellschaftliches
Leben mit künstlerischen und wissenschaftlichen Inter-
essen ausbildete. Da erwies sich jener Garten und die
trefflich ausgemalte Loggia des Hauses als ein präch-
tiger Aufenthalt. Er durfte fortan bei keiner neuen
Anlage mehr fehlen.
Dies zeigt sich schon bei der Villa Medicea
bei Fiesole (nahe vor Florenz). Sie wurde von
Michelozzo für einen Sohn Cosimos erbaut, vielleicht
als erste mit dem ausgesprochenen Zweck, einem ge-
Villa Medicea (Macalmont) bei Fiesole vor Florenz: Gesamtansicht.