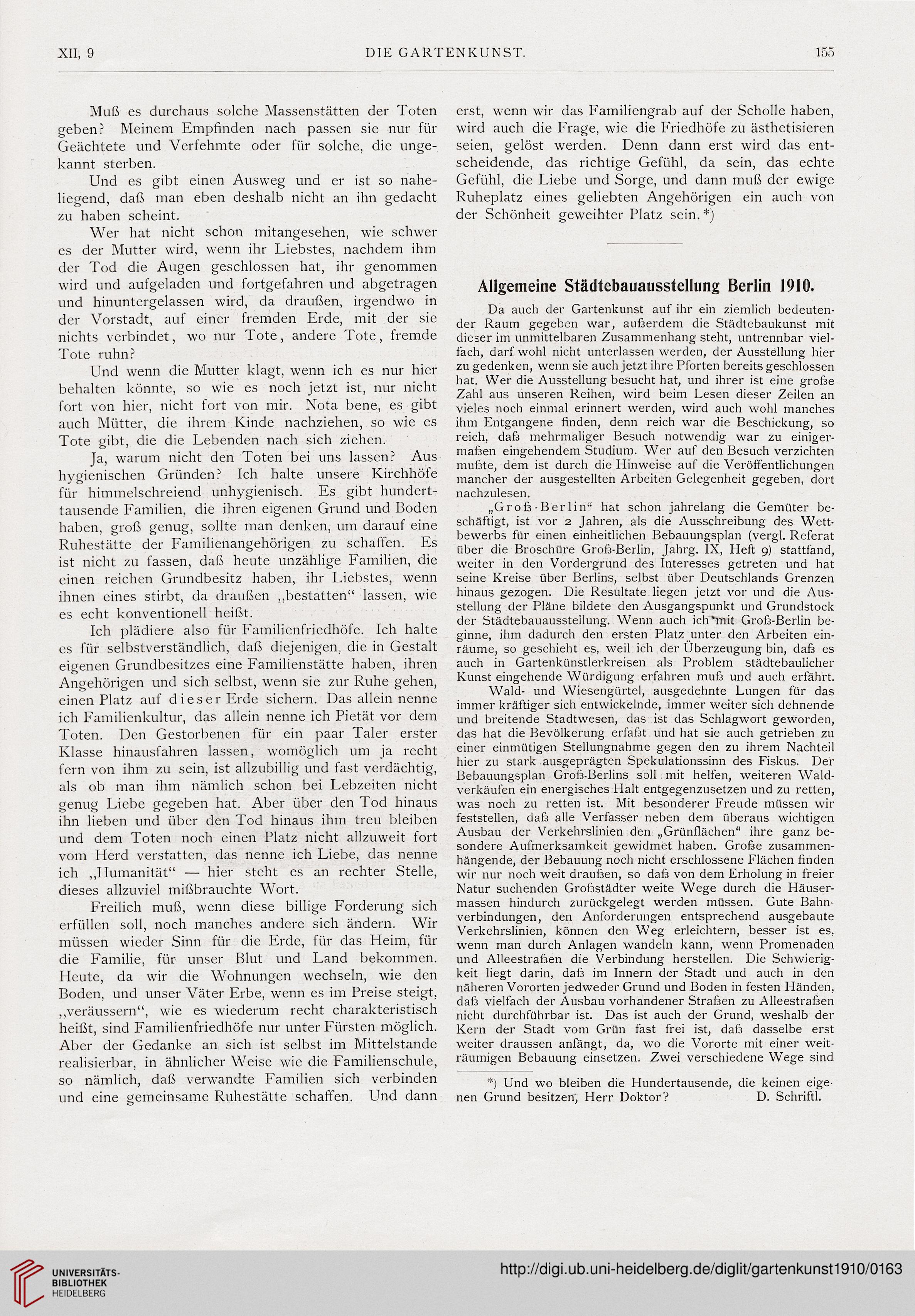XII, 9
DIE GARTENKUNST.
155
Muß es durchaus solche Massenstätten der Toten
geben? Meinem Empfinden nach passen sie nur für
Geächtete und Verfehmte oder für solche, die unge-
kannt sterben.
Und es gibt einen Ausweg und er ist so nahe-
liegend, daß man eben deshalb nicht an ihn gedacht
zu haben scheint.
Wer hat nicht schon mitangesehen, wie schwer
es der Mutter wird, wenn ihr Liebstes, nachdem ihm
der Tod die Augen geschlossen hat, ihr genommen
wird und aufgeladen und fortgefahren und abgetragen
und hinuntergelassen wird, da draußen, irgendwo in
der Vorstadt, auf einer fremden Erde, mit der sie
nichts verbindet, wo nur Tote, andere Tote, fremde
Tote ruhn?
Und wenn die Mutter klagt, wenn ich es nur hier
behalten könnte, so wie es noch jetzt ist, nur nicht
fort von hier, nicht fort von mir. Nota bene, es gibt
auch Mütter, die ihrem Kinde nachziehen, so wie es
Tote gibt, die die Lebenden nach sich ziehen.
Ja, warum nicht den Toten bei uns lassen? Aus
hygienischen Gründen? Ich halte unsere Kirchhöfe
für himmelschreiend unhygienisch. Es gibt hundert-
tausende Familien, die ihren eigenen Grund und Boden
haben, groß genug, sollte man denken, um darauf eine
Ruhestätte der Familienangehörigen zu schaffen. Es
ist nicht zu fassen, daß heute unzählige Familien, die
einen reichen Grundbesitz haben, ihr Liebstes, wenn
ihnen eines stirbt, da draußen ,,bestatten" lassen, wie
es echt konventionell heißt.
Ich plädiere also für Familienfriedhöfe. Ich halte
es für selbstverständlich, daß diejenigen, die in Gestalt
eigenen Grundbesitzes eine Familienstätte haben, ihren
Angehörigen und sich selbst, wenn sie zur Ruhe gehen,
einen Platz auf dieser Erde sichern. Das allein nenne
ich Familienkultur, das allein nenne ich Pietät vor dem
Toten. Den Gestorbenen für ein paar Taler erster
Klasse hinausfahren lassen, womöglich um ja recht
fern von ihm zu sein, ist allzubillig und fast verdächtig,
als ob man ihm nämlich schon bei Lebzeiten nicht
genug Liebe gegeben hat. Aber über den Tod hinaus
ihn lieben und über den Tod hinaus ihm treu bleiben
und dem Toten noch einen Platz nicht allzuweit fort
vom Herd verstatten, das nenne ich Liebe, das nenne
ich „Humanität" — hier steht es an rechter Stelle,
dieses allzuviel mißbrauchte Wort.
Freilich muß, wenn diese billige Forderung sich
erfüllen soll, noch manches andere sich ändern. Wir
müssen wieder Sinn für die Erde, für das Heim, für
die Familie, für unser Blut und Land bekommen.
Heute, da wir die Wohnungen wechseln, wie den
Boden, und unser Väter Erbe, wenn es im Preise steigt,
„veräussern", wie es wiederum recht charakteristisch
heißt, sind Familienfriedhöfe nur unter Fürsten möglich.
Aber der Gedanke an sich ist selbst im Mittelstande
realisierbar, in ähnlicher Weise wie die Familienschule,
so nämlich, daß verwandte Familien sich verbinden
und eine gemeinsame Ruhestätte schaffen. Und dann
erst, wenn wir das Familiengrab auf der Scholle haben,
wird auch die Frage, wie die Friedhöfe zu ästhetisieren
seien, gelöst werden. Denn dann erst wird das ent-
scheidende, das richtige Gefühl, da sein, das echte
Gefühl, die Liebe und Sorge, und dann muß der ewige
Ruheplatz eines geliebten Angehörigen ein auch von
der Schönheit geweihter Platz sein. *)
Allgemeine Städtebauausstellung Berlin 1910.
Da auch der Gartenkunst auf ihr ein ziemlich bedeuten-
der Raum gegeben war, außerdem die Städtebaukunst mit
dieser im unmittelbaren Zusammenhang steht, untrennbar viel-
fach, darf wohl nicht unterlassen werden, der Ausstellung hier
zu gedenken, wenn sie auch jetzt ihre Pforten bereits geschlossen
hat. Wer die Ausstellung besucht hat, und ihrer ist eine große
Zahl aus unseren Reihen, wird beim Lesen dieser Zeilen an
vieles noch einmal erinnert werden, wird auch wohl manches
ihm Entgangene finden, denn reich war die Beschickung, so
reich, daß mehrmaliger Besuch notwendig war zu einiger-
maßen eingehendem Studium. Wer auf den Besuch verzichten
mußte, dem ist durch die Hinweise auf die Veröffentlichungen
mancher der ausgestellten Arbeiten Gelegenheit gegeben, dort
nachzulesen.
„Groß - Berlin" hat schon jahrelang die Gemüter be-
schäftigt, ist vor 2 Jahren, als die Ausschreibung des Wett-
bewerbs für einen einheitlichen Bebauungsplan (vergl. Referat
über die Broschüre Groß-Berlin, Jahrg. IX, Heft 9) stattfand,
weiter in den Vordergrund des Interesses getreten und hat
seine Kreise über Berlins, selbst über Deutschlands Grenzen
hinaus gezogen. Die Resultate liegen jetzt vor und die Aus-
stellung der Pläne bildete den Ausgangspunkt und Grundstock
der Städtebauausstellung. Wenn auch ich'mit Groß-Berlin be-
ginne, ihm dadurch den ersten Platz unter den Arbeiten ein-
räume, so geschieht es, weil ich der Uberzeugung bin, daß es
auch in Gartenkünstlerkreisen als Problem städtebaulicher
Kunst eingehende Würdigung erfahren muß und auch erfährt.
Wald- und Wiesengürtel, ausgedehnte Lungen für das
immer kräftiger sich entwickelnde, immer weiter sich dehnende
und breitende Stadtwesen, das ist das Schlagwort geworden,
das hat die Bevölkerung erfaßt und hat sie auch getrieben zu
einer einmütigen Stellungnahme gegen den zu ihrem Nachteil
hier zu stark ausgeprägten Spekulationssinn des Fiskus. Der
Bebauungsplan Groß-Berlins soll mit helfen, weiteren Wald-
verkäufen ein energisches Halt entgegenzusetzen und zu retten,
was noch zu retten ist. Mit besonderer Freude müssen wir
feststellen, daß alle Verfasser neben dem überaus wichtigen
Ausbau der Verkehrslinien den „Grünflächen" ihre ganz be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet haben. Große zusammen-
hängende, der Bebauung noch nicht erschlossene Flächen finden
wir nur noch weit draußen, so daß von dem Erholung in freier
Natur suchenden Großstädter weite Wege durch die Häuser-
massen hindurch zurückgelegt werden müssen. Gute Bahn-
verbindungen, den Anforderungen entsprechend ausgebaute
Verkehrslinien, können den Weg erleichtern, besser ist es,
wenn man durch Anlagen wandeln kann, wenn Promenaden
und Alleestraßen die Verbindung herstellen. Die Schwierig-
keit liegt darin, daß im Innern der Stadt und auch in den
näheren Vororten jedweder Grund und Boden in festen Händen,
daß vielfach der Ausbau vorhandener Straßen zu Alleestraßen
nicht durchführbar ist. Das ist auch der Grund, weshalb der
Kern der Stadt vom Grün fast frei ist, daß dasselbe erst
weiter draussen anfängt, da, wo die Vororte mit einer weit-
räumigen Bebauung einsetzen. Zwei verschiedene Wege sind
*) Und wo bleiben die Hundertausende, die keinen eige-
nen Grund besitzen, Herr Doktor? D. Schriftl.
DIE GARTENKUNST.
155
Muß es durchaus solche Massenstätten der Toten
geben? Meinem Empfinden nach passen sie nur für
Geächtete und Verfehmte oder für solche, die unge-
kannt sterben.
Und es gibt einen Ausweg und er ist so nahe-
liegend, daß man eben deshalb nicht an ihn gedacht
zu haben scheint.
Wer hat nicht schon mitangesehen, wie schwer
es der Mutter wird, wenn ihr Liebstes, nachdem ihm
der Tod die Augen geschlossen hat, ihr genommen
wird und aufgeladen und fortgefahren und abgetragen
und hinuntergelassen wird, da draußen, irgendwo in
der Vorstadt, auf einer fremden Erde, mit der sie
nichts verbindet, wo nur Tote, andere Tote, fremde
Tote ruhn?
Und wenn die Mutter klagt, wenn ich es nur hier
behalten könnte, so wie es noch jetzt ist, nur nicht
fort von hier, nicht fort von mir. Nota bene, es gibt
auch Mütter, die ihrem Kinde nachziehen, so wie es
Tote gibt, die die Lebenden nach sich ziehen.
Ja, warum nicht den Toten bei uns lassen? Aus
hygienischen Gründen? Ich halte unsere Kirchhöfe
für himmelschreiend unhygienisch. Es gibt hundert-
tausende Familien, die ihren eigenen Grund und Boden
haben, groß genug, sollte man denken, um darauf eine
Ruhestätte der Familienangehörigen zu schaffen. Es
ist nicht zu fassen, daß heute unzählige Familien, die
einen reichen Grundbesitz haben, ihr Liebstes, wenn
ihnen eines stirbt, da draußen ,,bestatten" lassen, wie
es echt konventionell heißt.
Ich plädiere also für Familienfriedhöfe. Ich halte
es für selbstverständlich, daß diejenigen, die in Gestalt
eigenen Grundbesitzes eine Familienstätte haben, ihren
Angehörigen und sich selbst, wenn sie zur Ruhe gehen,
einen Platz auf dieser Erde sichern. Das allein nenne
ich Familienkultur, das allein nenne ich Pietät vor dem
Toten. Den Gestorbenen für ein paar Taler erster
Klasse hinausfahren lassen, womöglich um ja recht
fern von ihm zu sein, ist allzubillig und fast verdächtig,
als ob man ihm nämlich schon bei Lebzeiten nicht
genug Liebe gegeben hat. Aber über den Tod hinaus
ihn lieben und über den Tod hinaus ihm treu bleiben
und dem Toten noch einen Platz nicht allzuweit fort
vom Herd verstatten, das nenne ich Liebe, das nenne
ich „Humanität" — hier steht es an rechter Stelle,
dieses allzuviel mißbrauchte Wort.
Freilich muß, wenn diese billige Forderung sich
erfüllen soll, noch manches andere sich ändern. Wir
müssen wieder Sinn für die Erde, für das Heim, für
die Familie, für unser Blut und Land bekommen.
Heute, da wir die Wohnungen wechseln, wie den
Boden, und unser Väter Erbe, wenn es im Preise steigt,
„veräussern", wie es wiederum recht charakteristisch
heißt, sind Familienfriedhöfe nur unter Fürsten möglich.
Aber der Gedanke an sich ist selbst im Mittelstande
realisierbar, in ähnlicher Weise wie die Familienschule,
so nämlich, daß verwandte Familien sich verbinden
und eine gemeinsame Ruhestätte schaffen. Und dann
erst, wenn wir das Familiengrab auf der Scholle haben,
wird auch die Frage, wie die Friedhöfe zu ästhetisieren
seien, gelöst werden. Denn dann erst wird das ent-
scheidende, das richtige Gefühl, da sein, das echte
Gefühl, die Liebe und Sorge, und dann muß der ewige
Ruheplatz eines geliebten Angehörigen ein auch von
der Schönheit geweihter Platz sein. *)
Allgemeine Städtebauausstellung Berlin 1910.
Da auch der Gartenkunst auf ihr ein ziemlich bedeuten-
der Raum gegeben war, außerdem die Städtebaukunst mit
dieser im unmittelbaren Zusammenhang steht, untrennbar viel-
fach, darf wohl nicht unterlassen werden, der Ausstellung hier
zu gedenken, wenn sie auch jetzt ihre Pforten bereits geschlossen
hat. Wer die Ausstellung besucht hat, und ihrer ist eine große
Zahl aus unseren Reihen, wird beim Lesen dieser Zeilen an
vieles noch einmal erinnert werden, wird auch wohl manches
ihm Entgangene finden, denn reich war die Beschickung, so
reich, daß mehrmaliger Besuch notwendig war zu einiger-
maßen eingehendem Studium. Wer auf den Besuch verzichten
mußte, dem ist durch die Hinweise auf die Veröffentlichungen
mancher der ausgestellten Arbeiten Gelegenheit gegeben, dort
nachzulesen.
„Groß - Berlin" hat schon jahrelang die Gemüter be-
schäftigt, ist vor 2 Jahren, als die Ausschreibung des Wett-
bewerbs für einen einheitlichen Bebauungsplan (vergl. Referat
über die Broschüre Groß-Berlin, Jahrg. IX, Heft 9) stattfand,
weiter in den Vordergrund des Interesses getreten und hat
seine Kreise über Berlins, selbst über Deutschlands Grenzen
hinaus gezogen. Die Resultate liegen jetzt vor und die Aus-
stellung der Pläne bildete den Ausgangspunkt und Grundstock
der Städtebauausstellung. Wenn auch ich'mit Groß-Berlin be-
ginne, ihm dadurch den ersten Platz unter den Arbeiten ein-
räume, so geschieht es, weil ich der Uberzeugung bin, daß es
auch in Gartenkünstlerkreisen als Problem städtebaulicher
Kunst eingehende Würdigung erfahren muß und auch erfährt.
Wald- und Wiesengürtel, ausgedehnte Lungen für das
immer kräftiger sich entwickelnde, immer weiter sich dehnende
und breitende Stadtwesen, das ist das Schlagwort geworden,
das hat die Bevölkerung erfaßt und hat sie auch getrieben zu
einer einmütigen Stellungnahme gegen den zu ihrem Nachteil
hier zu stark ausgeprägten Spekulationssinn des Fiskus. Der
Bebauungsplan Groß-Berlins soll mit helfen, weiteren Wald-
verkäufen ein energisches Halt entgegenzusetzen und zu retten,
was noch zu retten ist. Mit besonderer Freude müssen wir
feststellen, daß alle Verfasser neben dem überaus wichtigen
Ausbau der Verkehrslinien den „Grünflächen" ihre ganz be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet haben. Große zusammen-
hängende, der Bebauung noch nicht erschlossene Flächen finden
wir nur noch weit draußen, so daß von dem Erholung in freier
Natur suchenden Großstädter weite Wege durch die Häuser-
massen hindurch zurückgelegt werden müssen. Gute Bahn-
verbindungen, den Anforderungen entsprechend ausgebaute
Verkehrslinien, können den Weg erleichtern, besser ist es,
wenn man durch Anlagen wandeln kann, wenn Promenaden
und Alleestraßen die Verbindung herstellen. Die Schwierig-
keit liegt darin, daß im Innern der Stadt und auch in den
näheren Vororten jedweder Grund und Boden in festen Händen,
daß vielfach der Ausbau vorhandener Straßen zu Alleestraßen
nicht durchführbar ist. Das ist auch der Grund, weshalb der
Kern der Stadt vom Grün fast frei ist, daß dasselbe erst
weiter draussen anfängt, da, wo die Vororte mit einer weit-
räumigen Bebauung einsetzen. Zwei verschiedene Wege sind
*) Und wo bleiben die Hundertausende, die keinen eige-
nen Grund besitzen, Herr Doktor? D. Schriftl.