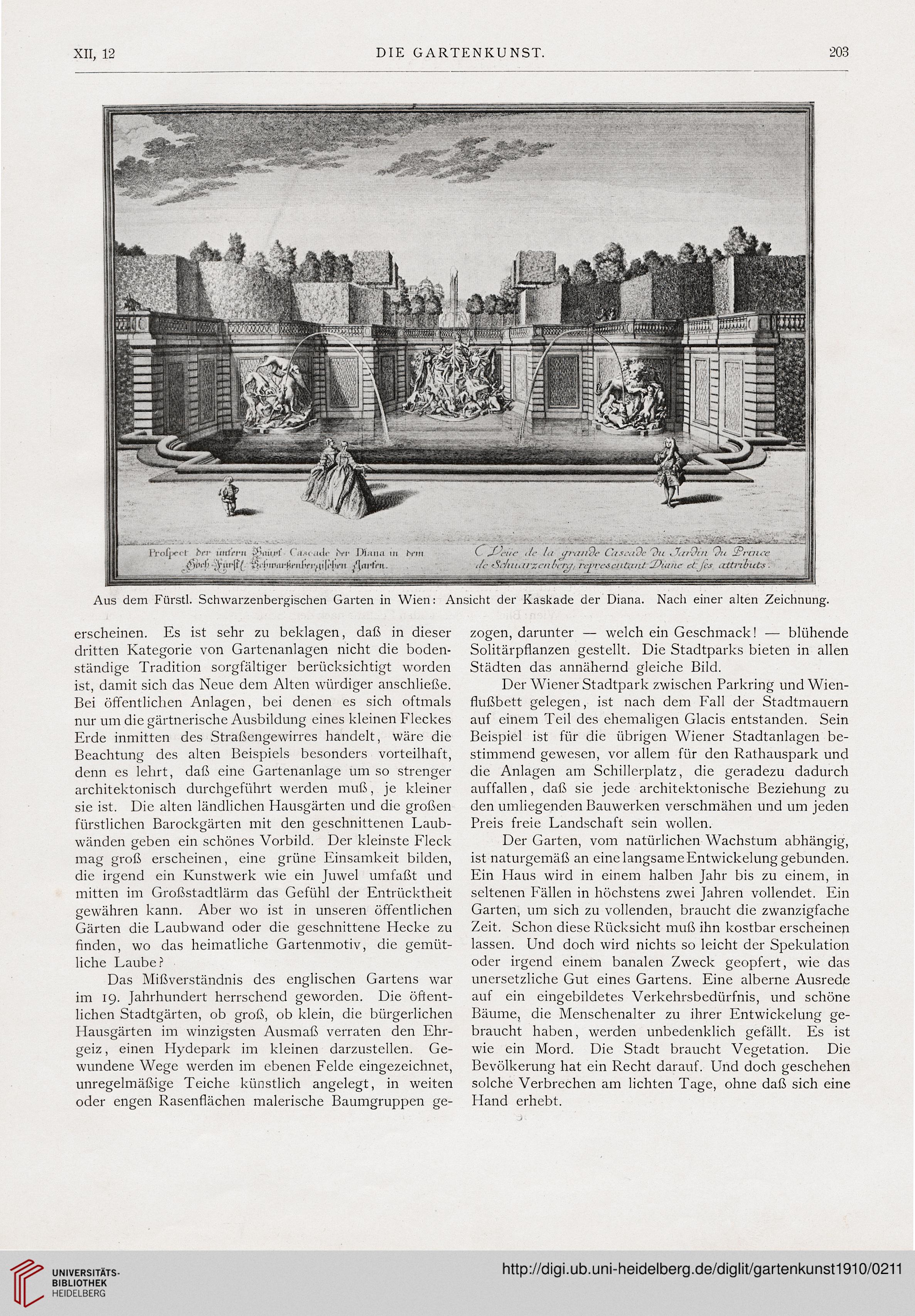xn, 12
DIE GARTENKUNST.
203
Aus dem Fürstl. Schvvarzenbergischen Garten in Wien: Ansicht der Kaskade der Diana. Nach einer alten Zeichnung.
erscheinen. Es ist sehr zu beklagen, daß in dieser
dritten Kategorie von Gartenanlagen nicht die boden-
ständige Tradition sorgfältiger berücksichtigt worden
ist, damit sich das Neue dem Alten würdiger anschließe.
Bei öffentlichen Anlagen, bei denen es sich oftmals
nur um die gärtnerische Ausbildung eines kleinen Fleckes
Erde inmitten des Straßengewirres handelt, wäre die
Beachtung des alten Beispiels besonders vorteilhaft,
denn es lehrt, daß eine Gartenanlage um so strenger
architektonisch durchgeführt werden muß, je kleiner
sie ist. Die alten ländlichen Hausgärten und die großen
fürstlichen Barockgärten mit den geschnittenen Laub-
wänden geben ein schönes Vorbild. Der kleinste Fleck
mag groß erscheinen, eine grüne Einsamkeit bilden,
die irgend ein Kunstwerk wie ein Juwel umfaßt und
mitten im Großstadtlärm das Gefühl der Entrücktheit
gewähren kann. Aber wo ist in unseren öffentlichen
Gärten die Laubwand oder die geschnittene Hecke zu
finden, wo das heimatliche Gartenmotiv, die gemüt-
liche Laube?
Das Mißverständnis des englischen Gartens war
im 19. Jahrhundert herrschend geworden. Die öffent-
lichen Stadtgärten, ob groß, ob klein, die bürgerlichen
Hausgärten im winzigsten Ausmaß verraten den Ehr-
geiz , einen Hydepark im kleinen darzustellen. Ge-
wundene Wege werden im ebenen Felde eingezeichnet,
unregelmäßige Teiche künstlich angelegt, in weiten
oder engen Rasenflächen malerische Baumgruppen ge-
zogen, darunter — welch ein Geschmack! — blühende
Solitärpflanzen gestellt. Die Stadtparks bieten in allen
Städten das annähernd gleiche Bild.
Der Wiener Stadtpark zwischen Parkring und Wien-
flußbett gelegen, ist nach dem Fall der Stadtmauern
auf einem Teil des ehemaligen Glacis entstanden. Sein
Beispiel ist für die übrigen Wiener Stadtanlagen be-
stimmend gewesen, vor allem für den Rathauspark und
die Anlagen am Schillerplatz, die geradezu dadurch
auffallen , daß sie jede architektonische Beziehung zu
den umliegenden Bauwerken verschmähen und um jeden
Preis freie Landschaft sein wollen.
Der Garten, vom natürlichen Wachstum abhängig,
ist naturgemäß an eine langsame Entwicklung gebunden.
Ein Haus wird in einem halben Jahr bis zu einem, in
seltenen Fällen in höchstens zwei Jahren vollendet. Ein
Garten, um sich zu vollenden, braucht die zwanzigfache
Zeit. Schon diese Rücksicht muß ihn kostbar erscheinen
lassen. Und doch wird nichts so leicht der Spekulation
oder irgend einem banalen Zweck geopfert, wie das
unersetzliche Gut eines Gartens. Eine alberne Ausrede
auf ein eingebildetes Verkehrsbedürfnis, und schöne
Bäume, die Menschenalter zu ihrer Entwicklung ge-
braucht haben, werden unbedenklich gefällt. Es ist
wie ein Mord. Die Stadt braucht Vegetation. Die
Bevölkerung hat ein Recht darauf. Und doch geschehen
solche Verbrechen am lichten Tage, ohne daß sich eine
Hand erhebt.
DIE GARTENKUNST.
203
Aus dem Fürstl. Schvvarzenbergischen Garten in Wien: Ansicht der Kaskade der Diana. Nach einer alten Zeichnung.
erscheinen. Es ist sehr zu beklagen, daß in dieser
dritten Kategorie von Gartenanlagen nicht die boden-
ständige Tradition sorgfältiger berücksichtigt worden
ist, damit sich das Neue dem Alten würdiger anschließe.
Bei öffentlichen Anlagen, bei denen es sich oftmals
nur um die gärtnerische Ausbildung eines kleinen Fleckes
Erde inmitten des Straßengewirres handelt, wäre die
Beachtung des alten Beispiels besonders vorteilhaft,
denn es lehrt, daß eine Gartenanlage um so strenger
architektonisch durchgeführt werden muß, je kleiner
sie ist. Die alten ländlichen Hausgärten und die großen
fürstlichen Barockgärten mit den geschnittenen Laub-
wänden geben ein schönes Vorbild. Der kleinste Fleck
mag groß erscheinen, eine grüne Einsamkeit bilden,
die irgend ein Kunstwerk wie ein Juwel umfaßt und
mitten im Großstadtlärm das Gefühl der Entrücktheit
gewähren kann. Aber wo ist in unseren öffentlichen
Gärten die Laubwand oder die geschnittene Hecke zu
finden, wo das heimatliche Gartenmotiv, die gemüt-
liche Laube?
Das Mißverständnis des englischen Gartens war
im 19. Jahrhundert herrschend geworden. Die öffent-
lichen Stadtgärten, ob groß, ob klein, die bürgerlichen
Hausgärten im winzigsten Ausmaß verraten den Ehr-
geiz , einen Hydepark im kleinen darzustellen. Ge-
wundene Wege werden im ebenen Felde eingezeichnet,
unregelmäßige Teiche künstlich angelegt, in weiten
oder engen Rasenflächen malerische Baumgruppen ge-
zogen, darunter — welch ein Geschmack! — blühende
Solitärpflanzen gestellt. Die Stadtparks bieten in allen
Städten das annähernd gleiche Bild.
Der Wiener Stadtpark zwischen Parkring und Wien-
flußbett gelegen, ist nach dem Fall der Stadtmauern
auf einem Teil des ehemaligen Glacis entstanden. Sein
Beispiel ist für die übrigen Wiener Stadtanlagen be-
stimmend gewesen, vor allem für den Rathauspark und
die Anlagen am Schillerplatz, die geradezu dadurch
auffallen , daß sie jede architektonische Beziehung zu
den umliegenden Bauwerken verschmähen und um jeden
Preis freie Landschaft sein wollen.
Der Garten, vom natürlichen Wachstum abhängig,
ist naturgemäß an eine langsame Entwicklung gebunden.
Ein Haus wird in einem halben Jahr bis zu einem, in
seltenen Fällen in höchstens zwei Jahren vollendet. Ein
Garten, um sich zu vollenden, braucht die zwanzigfache
Zeit. Schon diese Rücksicht muß ihn kostbar erscheinen
lassen. Und doch wird nichts so leicht der Spekulation
oder irgend einem banalen Zweck geopfert, wie das
unersetzliche Gut eines Gartens. Eine alberne Ausrede
auf ein eingebildetes Verkehrsbedürfnis, und schöne
Bäume, die Menschenalter zu ihrer Entwicklung ge-
braucht haben, werden unbedenklich gefällt. Es ist
wie ein Mord. Die Stadt braucht Vegetation. Die
Bevölkerung hat ein Recht darauf. Und doch geschehen
solche Verbrechen am lichten Tage, ohne daß sich eine
Hand erhebt.