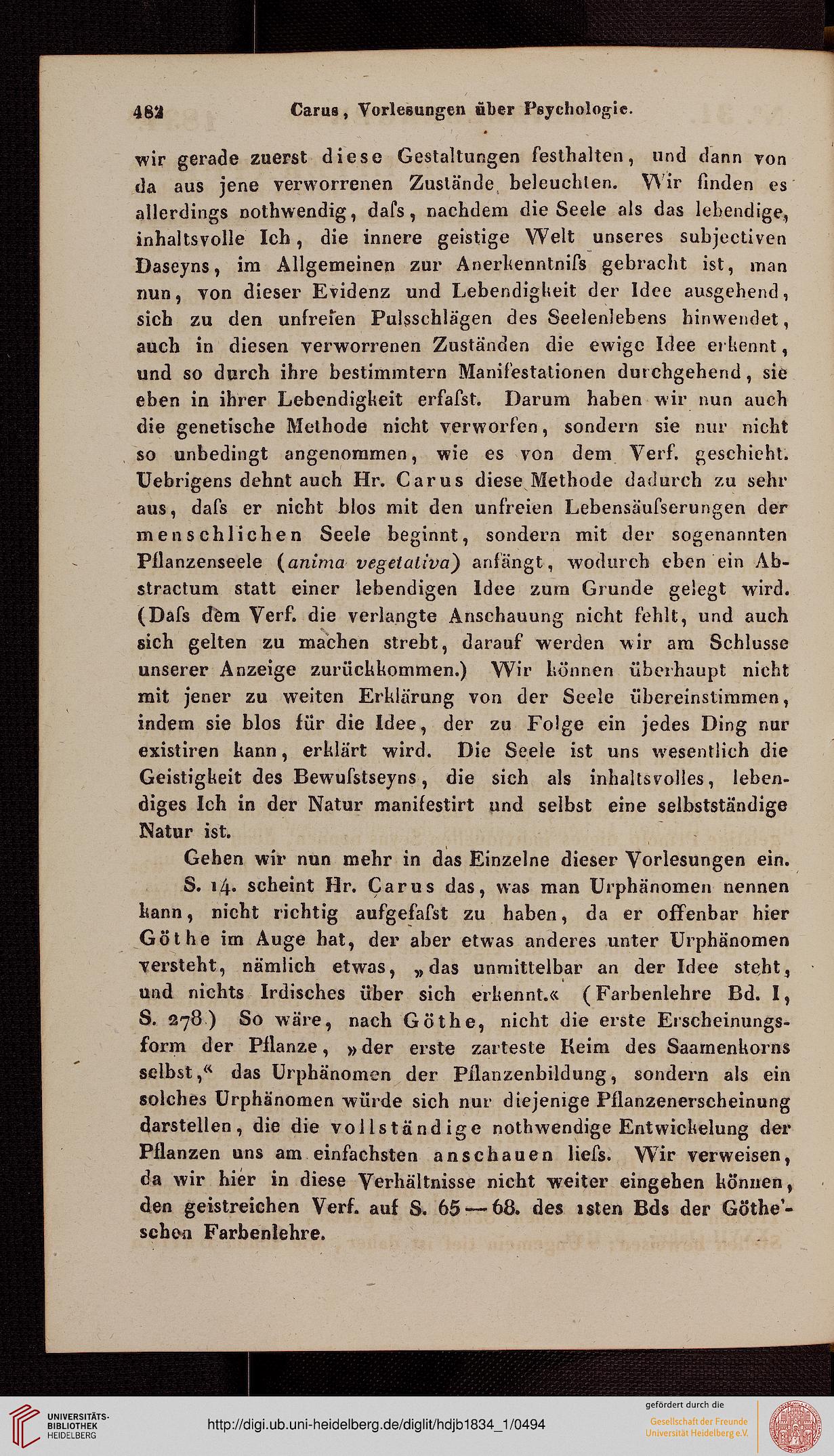483t Carua, Vorlegungen über Psychologie.
wir gerade zuerst diese Gestaltungen festhalten, und dann von
da aus jene verworrenen Zustände beleuchten. Wir linden es
allerdings nothwendig, dafs, nachdem die Seele als das lebendige,
inhaltsvolle Ich, die innere geistige Welt unseres subjectiven
Daseyns, im Allgemeinen zur Anerkenntnis gebracht ist, man
nun, von dieser Evidenz und Lebendigkeit der Idee ausgehend,
sieb zu den unfreien Pulsschlägen des Seelenlebens hinwendet,
auch in diesen verworrenen Zuständen die ewige Idee erhennt,
und so durch ihre bestimmtem Manifestationen durchgehend, sie
eben in ihrer Lebendigheit erfafst. Darum haben wir nun auch
die genetische Methode nicht verworfen, sondern sie nur nicht
so unbedingt angenommen, wie es von dem Verf. geschieht.
Uebrigens dehnt auch Hr. Carus diese Methode dadurch zu sehr
aus, dals er nicht blos mit den unfreien Lebensäufserungen der
menschlichen Seele beginnt, sondern mit der sogenannten
Pflanzenseele (animn anfängt, wodurch eben ein Ab-
stractum statt einer lebendigen Idee zum Grunde gelegt wird.
(Dals d§m Verf die verlangte Anschauung nicht fehlt, und auch
sich gelten zu machen strebt, darauf werden wir am Schlüsse
unserer Anzeige zurüchhommen.) Wir hönnen überhaupt nicht
mit jener zu weiten Erklärung von der Seele übereinstimmen,
indem sie blos für die Idee, der zu Folge ein jedes Ding nur
existiren kann, erklärt wird. Die Seele ist uns wesentlich die
Geistigkeit des Bewufstseyns, die sich als inhaltsvolles, leben-
diges Ich in der Natur manifestirt und selbst eine selbstständige
Natur ist.
Gehen wir nun mehr in das Einzelne dieser Vorlesungen ein.
S. scheint Hr. Carus das, was man Urphänomen nennen
kann, nicht richtig aufgefafst zu haben, da er offenbar hier
Göthe im Auge hat, der aber etwas anderes unter Urphänomen
versteht, nämlich etwas, „das unmittelbar an der Idee steht,
und nichts Irdisches über sich erkennt.« (Farbenlehre Bd. I,
8. 278) So wäre, nach Göthe, nicht die erste Erscheinungs-
form der Pflanze, »der erste zarteste Beim des Saamenkorns
selbst," das Urphänomen der Pflanzenbildung, sondern als ein
solches Urphänomen würde sich nur diejenige Pflanzenerscheinung
darstellen, die die vollständige nothwendige Entwickelung der
Pflanzen uns am einfachsten anschauen liefs. Wir verweisen,
da wir hier in diese Verhältnisse nicht weiter eingehen können,
den geistreichen Verf. auf 8. 65 — 68. des ;sten Bds der Göthe'-
schen Farbenlehre.
wir gerade zuerst diese Gestaltungen festhalten, und dann von
da aus jene verworrenen Zustände beleuchten. Wir linden es
allerdings nothwendig, dafs, nachdem die Seele als das lebendige,
inhaltsvolle Ich, die innere geistige Welt unseres subjectiven
Daseyns, im Allgemeinen zur Anerkenntnis gebracht ist, man
nun, von dieser Evidenz und Lebendigkeit der Idee ausgehend,
sieb zu den unfreien Pulsschlägen des Seelenlebens hinwendet,
auch in diesen verworrenen Zuständen die ewige Idee erhennt,
und so durch ihre bestimmtem Manifestationen durchgehend, sie
eben in ihrer Lebendigheit erfafst. Darum haben wir nun auch
die genetische Methode nicht verworfen, sondern sie nur nicht
so unbedingt angenommen, wie es von dem Verf. geschieht.
Uebrigens dehnt auch Hr. Carus diese Methode dadurch zu sehr
aus, dals er nicht blos mit den unfreien Lebensäufserungen der
menschlichen Seele beginnt, sondern mit der sogenannten
Pflanzenseele (animn anfängt, wodurch eben ein Ab-
stractum statt einer lebendigen Idee zum Grunde gelegt wird.
(Dals d§m Verf die verlangte Anschauung nicht fehlt, und auch
sich gelten zu machen strebt, darauf werden wir am Schlüsse
unserer Anzeige zurüchhommen.) Wir hönnen überhaupt nicht
mit jener zu weiten Erklärung von der Seele übereinstimmen,
indem sie blos für die Idee, der zu Folge ein jedes Ding nur
existiren kann, erklärt wird. Die Seele ist uns wesentlich die
Geistigkeit des Bewufstseyns, die sich als inhaltsvolles, leben-
diges Ich in der Natur manifestirt und selbst eine selbstständige
Natur ist.
Gehen wir nun mehr in das Einzelne dieser Vorlesungen ein.
S. scheint Hr. Carus das, was man Urphänomen nennen
kann, nicht richtig aufgefafst zu haben, da er offenbar hier
Göthe im Auge hat, der aber etwas anderes unter Urphänomen
versteht, nämlich etwas, „das unmittelbar an der Idee steht,
und nichts Irdisches über sich erkennt.« (Farbenlehre Bd. I,
8. 278) So wäre, nach Göthe, nicht die erste Erscheinungs-
form der Pflanze, »der erste zarteste Beim des Saamenkorns
selbst," das Urphänomen der Pflanzenbildung, sondern als ein
solches Urphänomen würde sich nur diejenige Pflanzenerscheinung
darstellen, die die vollständige nothwendige Entwickelung der
Pflanzen uns am einfachsten anschauen liefs. Wir verweisen,
da wir hier in diese Verhältnisse nicht weiter eingehen können,
den geistreichen Verf. auf 8. 65 — 68. des ;sten Bds der Göthe'-
schen Farbenlehre.