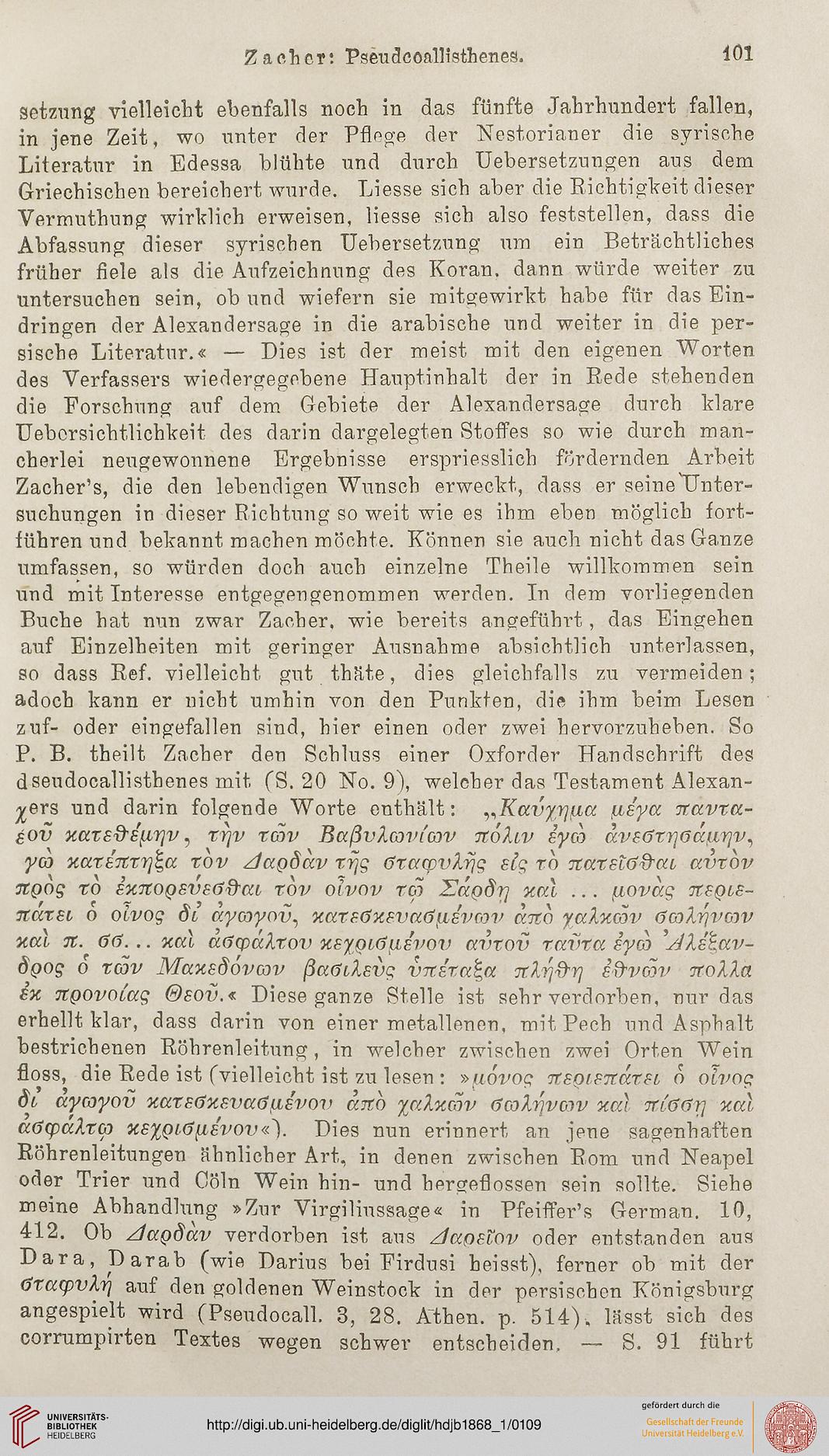Zaeher: PseudcealHsthenes.
101
Setzung vielleicht ebenfalls noch in das fünfte Jahrhundert fallen,
in jene Zeit, wo unter der Pflege der Nestorianer die syrische
Literatur in Edessa blühte und durch üebersetzungen aus dem
Griechischen bereichert wurde. Liesse sich aber die Richtigkeit dieser
Vermuthung wirklich erweisen, liesse sich also feststellen, dass die
Abfassung dieser syrischen Übersetzung um ein Beträchtliches
früher fiele als die Aufzeichnung des Koran, dann würde weiter zu
untersuchen sein, ob und wiefern sie mitgewirkt habe für das Ein-
dringen der Alexandersage in die arabische und weiter in die per-
sische Literatur.« — Dies ist der meist mit den eigenen Worten
des Verfassers wiedergegebene Hauptinhalt der in Rede stehenden
die Forschung auf dem Gebiete der Alexandersage durch klare
Ueborsichtlichkeit des darin dargelegten Stoffes so wie durch man-
cherlei neugewonnene Ergebnisse erspriesslich fördernden Arbeit
Zacher’s, die den lebendigen Wunsch erweckt, dass er seineHnter-
suchungen in dieser Richtung so weit wie es ihm eben möglich fort-
führen und bekannt machen möchte. Können sie auch nicht das Ganze
umfassen, so würden doch auch einzelne Theile willkommen sein
und mit Interesse entgegengenommen werden. In dem vorliegenden
Buche hat nun zwar Zacher, wie bereits angeführt, das Eingehen
auf Einzelheiten mit geringer Ausnahme absichtlich unterlassen,
so dass Ref. vielleicht gut thäte, dies gleichfalls zu vermeiden;
adoch kann er nicht umhin von den Punkten, die ihm beim Lesen
zuf- oder eingefallen sind, hier einen oder zwei hervorzuheben. So
P. B. theilt Zacher den Schluss einer Oxforder Handschrift des
dseudocallisthenes mit ('S. 20 No. 9), welcher das Testament Alexan-
ders und darin folgende Worte enthält: ,,Καύχημα μέγα παντα-
sov κατε&ε'μην, την των Βαβυλωνίων πόλί,ν εγώ άνεΰτηΰάμην^
γω κατέπτηζα τον Λαρδαν της Σταφυλής εις το πατεΐ6&αί αυτόν
προς το έκπορενε6&αι τον οίνον τώ Σάρδη και ... μονας περιε-
πατει ο οίνος δι αγωγού, κατε6κευα6μένων από χαλκών 6ωληνων
και π. 66... και αΰφάλτον κεχρι6μένου αυτόν ταύτα εγώ ’Λλέζαν-
δρος ο των Μακεδονων βαΰιλεύς υπέταξα πλή&η έ&νών πολλά
εκ προνοίας Θεόν.* Diese ganze Stelle ist sehr verdorben, nur das
erhellt klar, dass darin von einer metallenen, mit Pech und Asphalt
bestrichenen Röhrenleitung, in welcher zwischen zwei Orten Wein
floss, die Rede ist (vielleicht ist zu lesen : »μόνος περιεπάτει δ οίνος
όι αγωγόν κατε6κενα6μενον από χαλκών 6ωληνων και πί66η και
α6φαλτω κεχρι.6μένον«Υ Dies nun erinnert an jene sagenhaften
Röhrenleitungen ähnlicher Art, in denen zwischen Rom und Neapel
oder Trier und Cöln Wein hin- und hergeflossen sein sollte. Siehe
meine Abhandlung »Zur Virgiliussage« in Pfeiffer’s German. 10,
412. Ob Λαρδαν verdorben ist aus Λαρεΐον oder entstanden aus
Dara, Darab (wie Darius bei Firdusi heisst), ferner ob mit der
6ταφνλη auf den goldenen Weinstock in der persischen Königsburg
angespielt wird (Pseudocall. 3, 28. Athen, p. 514). lässt sich des
corrumpirten Textes wegen schwer entscheiden. — S. 91 führt
101
Setzung vielleicht ebenfalls noch in das fünfte Jahrhundert fallen,
in jene Zeit, wo unter der Pflege der Nestorianer die syrische
Literatur in Edessa blühte und durch üebersetzungen aus dem
Griechischen bereichert wurde. Liesse sich aber die Richtigkeit dieser
Vermuthung wirklich erweisen, liesse sich also feststellen, dass die
Abfassung dieser syrischen Übersetzung um ein Beträchtliches
früher fiele als die Aufzeichnung des Koran, dann würde weiter zu
untersuchen sein, ob und wiefern sie mitgewirkt habe für das Ein-
dringen der Alexandersage in die arabische und weiter in die per-
sische Literatur.« — Dies ist der meist mit den eigenen Worten
des Verfassers wiedergegebene Hauptinhalt der in Rede stehenden
die Forschung auf dem Gebiete der Alexandersage durch klare
Ueborsichtlichkeit des darin dargelegten Stoffes so wie durch man-
cherlei neugewonnene Ergebnisse erspriesslich fördernden Arbeit
Zacher’s, die den lebendigen Wunsch erweckt, dass er seineHnter-
suchungen in dieser Richtung so weit wie es ihm eben möglich fort-
führen und bekannt machen möchte. Können sie auch nicht das Ganze
umfassen, so würden doch auch einzelne Theile willkommen sein
und mit Interesse entgegengenommen werden. In dem vorliegenden
Buche hat nun zwar Zacher, wie bereits angeführt, das Eingehen
auf Einzelheiten mit geringer Ausnahme absichtlich unterlassen,
so dass Ref. vielleicht gut thäte, dies gleichfalls zu vermeiden;
adoch kann er nicht umhin von den Punkten, die ihm beim Lesen
zuf- oder eingefallen sind, hier einen oder zwei hervorzuheben. So
P. B. theilt Zacher den Schluss einer Oxforder Handschrift des
dseudocallisthenes mit ('S. 20 No. 9), welcher das Testament Alexan-
ders und darin folgende Worte enthält: ,,Καύχημα μέγα παντα-
sov κατε&ε'μην, την των Βαβυλωνίων πόλί,ν εγώ άνεΰτηΰάμην^
γω κατέπτηζα τον Λαρδαν της Σταφυλής εις το πατεΐ6&αί αυτόν
προς το έκπορενε6&αι τον οίνον τώ Σάρδη και ... μονας περιε-
πατει ο οίνος δι αγωγού, κατε6κευα6μένων από χαλκών 6ωληνων
και π. 66... και αΰφάλτον κεχρι6μένου αυτόν ταύτα εγώ ’Λλέζαν-
δρος ο των Μακεδονων βαΰιλεύς υπέταξα πλή&η έ&νών πολλά
εκ προνοίας Θεόν.* Diese ganze Stelle ist sehr verdorben, nur das
erhellt klar, dass darin von einer metallenen, mit Pech und Asphalt
bestrichenen Röhrenleitung, in welcher zwischen zwei Orten Wein
floss, die Rede ist (vielleicht ist zu lesen : »μόνος περιεπάτει δ οίνος
όι αγωγόν κατε6κενα6μενον από χαλκών 6ωληνων και πί66η και
α6φαλτω κεχρι.6μένον«Υ Dies nun erinnert an jene sagenhaften
Röhrenleitungen ähnlicher Art, in denen zwischen Rom und Neapel
oder Trier und Cöln Wein hin- und hergeflossen sein sollte. Siehe
meine Abhandlung »Zur Virgiliussage« in Pfeiffer’s German. 10,
412. Ob Λαρδαν verdorben ist aus Λαρεΐον oder entstanden aus
Dara, Darab (wie Darius bei Firdusi heisst), ferner ob mit der
6ταφνλη auf den goldenen Weinstock in der persischen Königsburg
angespielt wird (Pseudocall. 3, 28. Athen, p. 514). lässt sich des
corrumpirten Textes wegen schwer entscheiden. — S. 91 führt