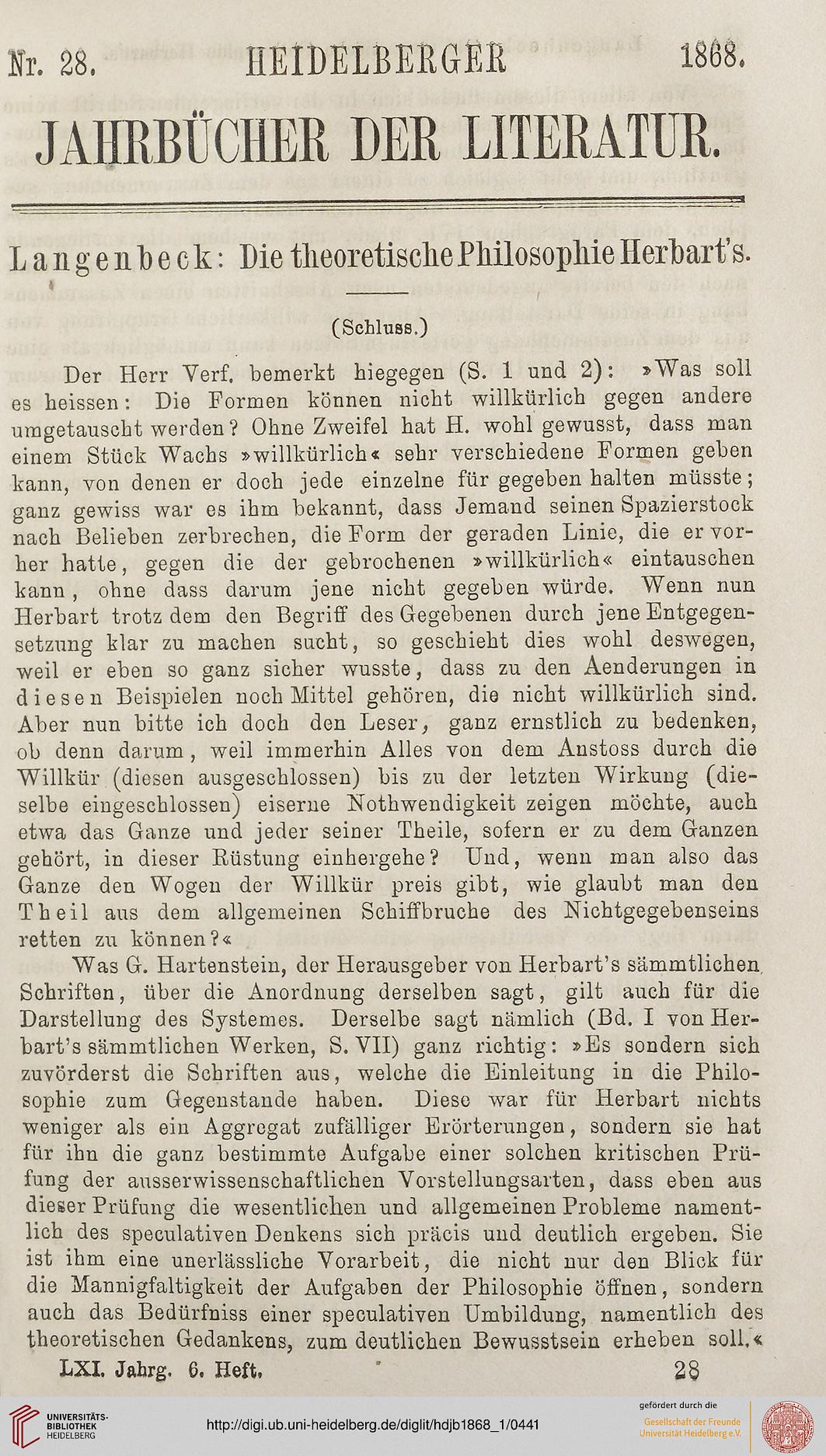S>. 2S. UKIDELBEliCl'll 1SBS.
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
L a n g e n b e c k: Die theoretische Philosophie Ilerbart’s.
(Schluss.)
Der Herr Verf. bemerkt hiegegen (S. 1 und 2): »Was soll
es beissen: Die Formen können nicht willkürlich gegen andere
umgetauscht werden ? Ohne Zweifel hat H. wohl gewusst, dass man
einem Stück Wachs »willkürlich« sehr verschiedene Formen geben
kann, von denen er doch jede einzelne für gegeben halten müsste;
ganz gewiss war es ihm bekannt, dass Jemand seinen Spazierstock
nach Belieben zerbrechen, die Form der geraden Linie, die er vor-
her hatte, gegen die der gebrochenen »willkürlich« eintauschen
kann , ohne dass darum jene nicht gegeben würde. Wenn nun
Herbart trotzdem den Begriff des Gegebenen durch jene Entgegen-
setzung klar zu machen sucht, so geschieht dies wohl deswegen,
weil er eben so ganz sicher wusste, dass zu den Aenderungen in
diesen Beispielen noch Mittel gehören, die nicht willkürlich sind.
Aber nun bitte ich doch den Leser, ganz ernstlich zu bedenken,
ob denn darum , weil immerhin Alles von dem Anstoss durch die
Willkür (diesen ausgeschlossen) bis zu der letzten Wirkung (die-
selbe eingeschlossen) eiserne Nothwendigkeit zeigen möchte, auch
etwa das Ganze und jeder seiner Theile, sofern er zu dem Ganzen
gehört, in dieser Rüstung einhergehe? ünd, wenn man also das
Ganze den Wogen der Willkür preis gibt, wie glaubt man den
Th eil aus dem allgemeinen Schiffbruche des Nichtgegebenseins
retten zu können?«
Was G. Hartenstein, der Herausgeber von Herbart’s sämmtlichen
Schriften, über die Anordnung derselben sagt, gilt auch für die
Darstellung des Systemes. Derselbe sagt nämlich (Bd. I von Her-
bart’s sämmtlichen Werken, S. VII) ganz richtig: »Es sondern sich
zuvörderst die Schriften aus, welche die Einleitung in die Philo-
sophie zum Gegenstände haben. Diese war für Herbart nichts
weniger als ein Aggregat zufälliger Erörterungen, sondern sie hat
für ihn die ganz bestimmte Aufgabe einer solchen kritischen Prü-
fung der ausserwissenschaftlichen Vorstellungsarten, dass eben aus
dieser Prüfung die wesentlichen und allgemeinen Probleme nament-
lich des speculativen Denkens sich präcis und deutlich ergeben. Sie
ist ihm eine unerlässliche Vorarbeit, die nicht nur den Blick für
die Mannigfaltigkeit der Aufgaben der Philosophie öffnen, sondern
auch das Bedürfniss einer speculativen Umbildung, namentlich des
theoretischen Gedankens, zum deutlichen Bewusstsein erheben soll.«
LXI. Jahrg. 6, Heft, ' 28
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
L a n g e n b e c k: Die theoretische Philosophie Ilerbart’s.
(Schluss.)
Der Herr Verf. bemerkt hiegegen (S. 1 und 2): »Was soll
es beissen: Die Formen können nicht willkürlich gegen andere
umgetauscht werden ? Ohne Zweifel hat H. wohl gewusst, dass man
einem Stück Wachs »willkürlich« sehr verschiedene Formen geben
kann, von denen er doch jede einzelne für gegeben halten müsste;
ganz gewiss war es ihm bekannt, dass Jemand seinen Spazierstock
nach Belieben zerbrechen, die Form der geraden Linie, die er vor-
her hatte, gegen die der gebrochenen »willkürlich« eintauschen
kann , ohne dass darum jene nicht gegeben würde. Wenn nun
Herbart trotzdem den Begriff des Gegebenen durch jene Entgegen-
setzung klar zu machen sucht, so geschieht dies wohl deswegen,
weil er eben so ganz sicher wusste, dass zu den Aenderungen in
diesen Beispielen noch Mittel gehören, die nicht willkürlich sind.
Aber nun bitte ich doch den Leser, ganz ernstlich zu bedenken,
ob denn darum , weil immerhin Alles von dem Anstoss durch die
Willkür (diesen ausgeschlossen) bis zu der letzten Wirkung (die-
selbe eingeschlossen) eiserne Nothwendigkeit zeigen möchte, auch
etwa das Ganze und jeder seiner Theile, sofern er zu dem Ganzen
gehört, in dieser Rüstung einhergehe? ünd, wenn man also das
Ganze den Wogen der Willkür preis gibt, wie glaubt man den
Th eil aus dem allgemeinen Schiffbruche des Nichtgegebenseins
retten zu können?«
Was G. Hartenstein, der Herausgeber von Herbart’s sämmtlichen
Schriften, über die Anordnung derselben sagt, gilt auch für die
Darstellung des Systemes. Derselbe sagt nämlich (Bd. I von Her-
bart’s sämmtlichen Werken, S. VII) ganz richtig: »Es sondern sich
zuvörderst die Schriften aus, welche die Einleitung in die Philo-
sophie zum Gegenstände haben. Diese war für Herbart nichts
weniger als ein Aggregat zufälliger Erörterungen, sondern sie hat
für ihn die ganz bestimmte Aufgabe einer solchen kritischen Prü-
fung der ausserwissenschaftlichen Vorstellungsarten, dass eben aus
dieser Prüfung die wesentlichen und allgemeinen Probleme nament-
lich des speculativen Denkens sich präcis und deutlich ergeben. Sie
ist ihm eine unerlässliche Vorarbeit, die nicht nur den Blick für
die Mannigfaltigkeit der Aufgaben der Philosophie öffnen, sondern
auch das Bedürfniss einer speculativen Umbildung, namentlich des
theoretischen Gedankens, zum deutlichen Bewusstsein erheben soll.«
LXI. Jahrg. 6, Heft, ' 28