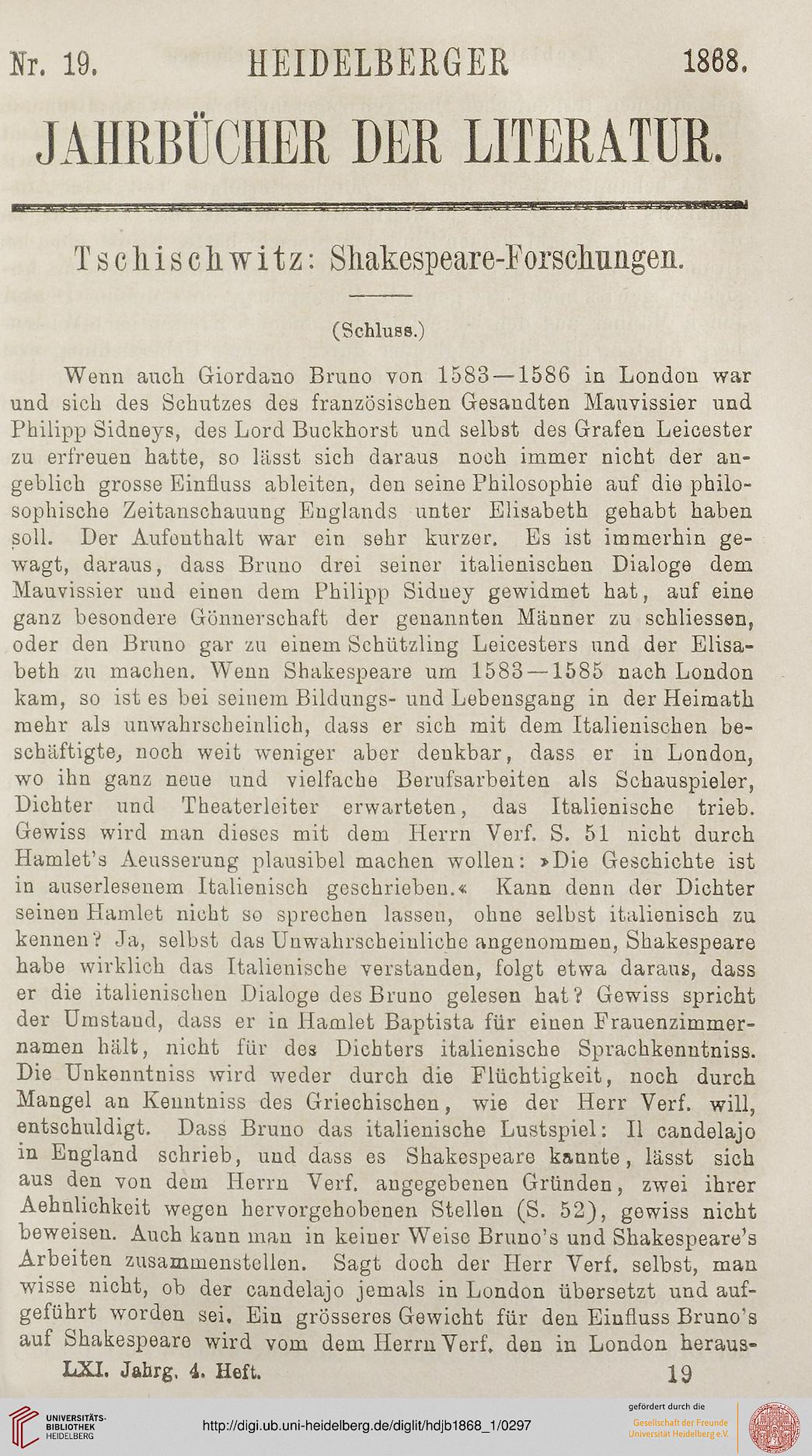Nr. 19. HEIDELBERGER 1368.
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
»■■II. i l »'''/·'·—»■■?■ „ 11 ■ ' ■ I .Λ-21Λ, .J Jll_ Ι,,ίΙΜΒΙ
Tschischwitz: Shakespeare-Forschungen.
(Schluss.)
Wenn auch Giordano Bruno von 1583 —1586 in London war
und sich des Schutzes des französischen Gesandten Mauvissier und
Philipp Sidneys, des Lord Buckhorst und selbst des Grafen Leicester
zu erfreuen hatte, so lässt sich daraus noch immer nicht der an-
geblich grosse Einfluss ableiten, den seine Philosophie auf die philo-
sophische Zeitanschauung Englands unter Elisabeth gehabt haben
soll. Der Aufenthalt war ein sehr kurzer. Es ist immerhin ge-
wagt, daraus, dass Bruno drei seiner italienischen Dialoge dem
Mauvissier und einen dem Philipp Sidney gewidmet hat, auf eine
ganz besondere Gönnerschaft der genannten Männer zu schliessen,
oder den Bruno gar zu einem Schützling Leicesters und der Elisa-
beth zu machen. Wenn Shakespeare um 1583 —1585 nach London
kam, so ist es bei seinem Bildungs- und Lebensgang in der Heimath
mehr als unwahrscheinlich, dass er sich mit dem Italienischen be-
schäftigte, noch weit weniger aber denkbar, dass er in London,
wo ihn ganz neue und vielfache Berufsarbeiten als Schauspieler,
Dichter und Theaterleiter erwarteten, das Italienische trieb.
Gewiss wird man dieses mit dem Herrn Verf. S. 51 nicht durch
Hamlet’s Aeusserung plausibel machen wollen: >Die Geschichte ist
in auserlesenem Italienisch geschrieben.« Kann denn der Dichter
seinen Hamlet nicht so sprechen lassen, ohne selbst italienisch zu
kennen? Ja, selbst das Unwahrscheinliche angenommen, Shakespeare
habe wirklich das Italienische verstanden, folgt etwa daraus, dass
er die italienischen Dialoge des Bruno gelesen hat? Gewiss spricht
der Umstand, dass er in Hamlet Baptista für einen Frauenzimmer-
namen hält, nicht für des Dichters italienische Sprachkenntniss.
Die Unkenntniss wird weder durch die Flüchtigkeit, noch durch
Mangel an Keuntniss des Griechischen, wie der Herr Verf. will,
entschuldigt. Dass Bruno das italienische Lustspiel: II candelajo
in England schrieb, und dass es Shakespeare kannte, lässt sich
aus den von dem Herrn Verf. angegebenen Gründen, zwei ihrer
Aehnlichkeit wegen hervorgehobenen Stellen (S. 52), gewiss nicht
beweisen. Auch kann man in keiner Weise Bruno’s und Shakespeare’s
Arbeiten zusammenstellen. Sagt doch der Herr Verf. selbst, man
wisse nicht, ob der candelajo jemals in London übersetzt und auf-
geführt worden sei. Ein grösseres Gewicht für den Einfluss Bruno’s
auf Shakespeare wird vom dem Herrn Verf. den in London heraus-
LXL Jahrg. 4. Heft. 19
JAHRBÜCHER DER LITERATUR.
»■■II. i l »'''/·'·—»■■?■ „ 11 ■ ' ■ I .Λ-21Λ, .J Jll_ Ι,,ίΙΜΒΙ
Tschischwitz: Shakespeare-Forschungen.
(Schluss.)
Wenn auch Giordano Bruno von 1583 —1586 in London war
und sich des Schutzes des französischen Gesandten Mauvissier und
Philipp Sidneys, des Lord Buckhorst und selbst des Grafen Leicester
zu erfreuen hatte, so lässt sich daraus noch immer nicht der an-
geblich grosse Einfluss ableiten, den seine Philosophie auf die philo-
sophische Zeitanschauung Englands unter Elisabeth gehabt haben
soll. Der Aufenthalt war ein sehr kurzer. Es ist immerhin ge-
wagt, daraus, dass Bruno drei seiner italienischen Dialoge dem
Mauvissier und einen dem Philipp Sidney gewidmet hat, auf eine
ganz besondere Gönnerschaft der genannten Männer zu schliessen,
oder den Bruno gar zu einem Schützling Leicesters und der Elisa-
beth zu machen. Wenn Shakespeare um 1583 —1585 nach London
kam, so ist es bei seinem Bildungs- und Lebensgang in der Heimath
mehr als unwahrscheinlich, dass er sich mit dem Italienischen be-
schäftigte, noch weit weniger aber denkbar, dass er in London,
wo ihn ganz neue und vielfache Berufsarbeiten als Schauspieler,
Dichter und Theaterleiter erwarteten, das Italienische trieb.
Gewiss wird man dieses mit dem Herrn Verf. S. 51 nicht durch
Hamlet’s Aeusserung plausibel machen wollen: >Die Geschichte ist
in auserlesenem Italienisch geschrieben.« Kann denn der Dichter
seinen Hamlet nicht so sprechen lassen, ohne selbst italienisch zu
kennen? Ja, selbst das Unwahrscheinliche angenommen, Shakespeare
habe wirklich das Italienische verstanden, folgt etwa daraus, dass
er die italienischen Dialoge des Bruno gelesen hat? Gewiss spricht
der Umstand, dass er in Hamlet Baptista für einen Frauenzimmer-
namen hält, nicht für des Dichters italienische Sprachkenntniss.
Die Unkenntniss wird weder durch die Flüchtigkeit, noch durch
Mangel an Keuntniss des Griechischen, wie der Herr Verf. will,
entschuldigt. Dass Bruno das italienische Lustspiel: II candelajo
in England schrieb, und dass es Shakespeare kannte, lässt sich
aus den von dem Herrn Verf. angegebenen Gründen, zwei ihrer
Aehnlichkeit wegen hervorgehobenen Stellen (S. 52), gewiss nicht
beweisen. Auch kann man in keiner Weise Bruno’s und Shakespeare’s
Arbeiten zusammenstellen. Sagt doch der Herr Verf. selbst, man
wisse nicht, ob der candelajo jemals in London übersetzt und auf-
geführt worden sei. Ein grösseres Gewicht für den Einfluss Bruno’s
auf Shakespeare wird vom dem Herrn Verf. den in London heraus-
LXL Jahrg. 4. Heft. 19