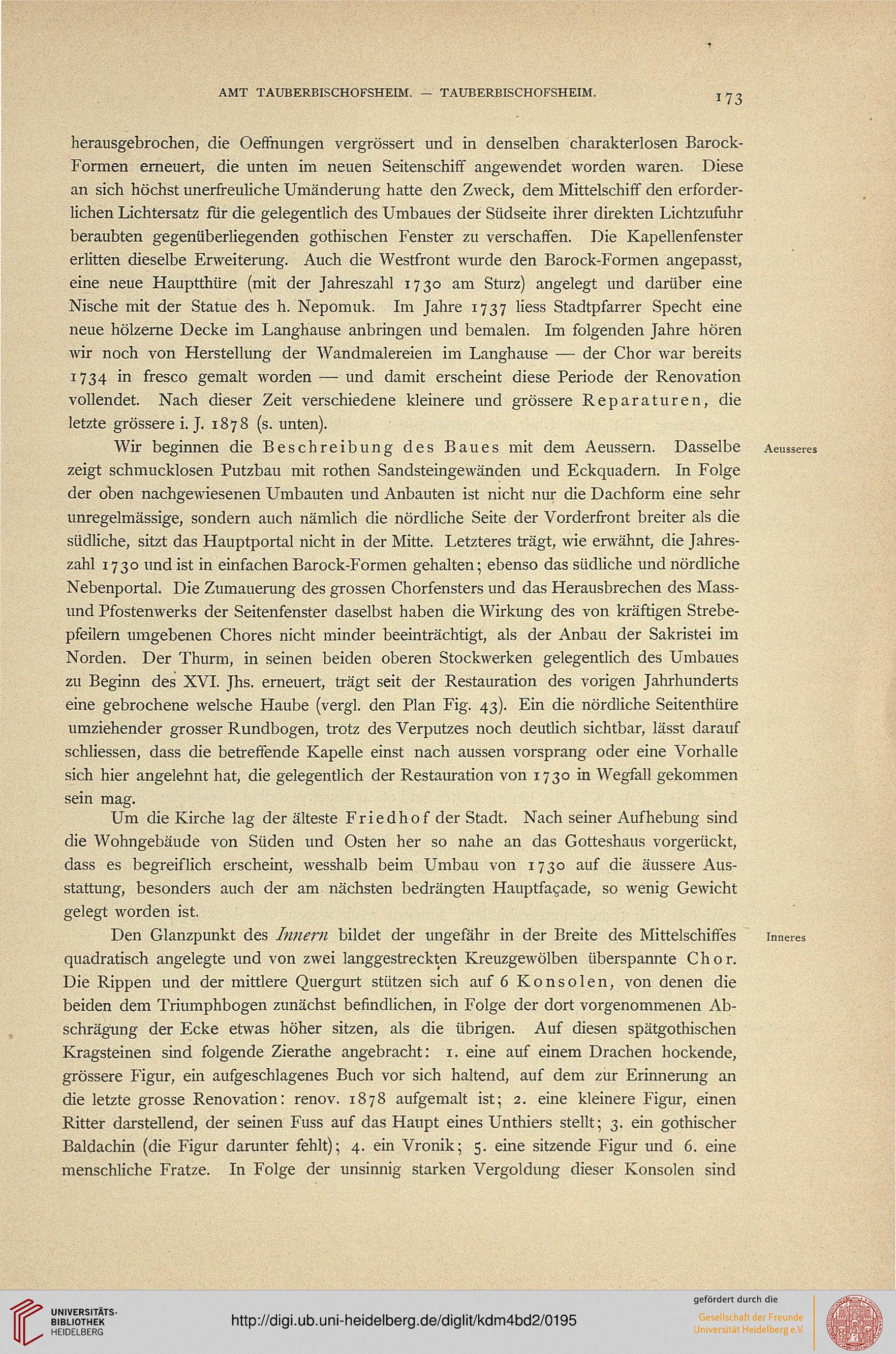AMT TAUBERBISCHOFSHEIM. — TAUBERBISCHOFSHEIM. j » ,
herausgebrochen, die Oeffnungen vergrössert und in denselben charakterlosen Barock-
Formen erneuert, die unten im neuen Seitenschiff angewendet worden waren. Diese
an sich höchst unerfreuliche Umänderung hatte den Zweck, dem Mittelschiff den erforder-
lichen Lichtersatz für die gelegentlich des Umbaues der Südseite ihrer direkten Lichtzufuhr
beraubten gegenüberliegenden gothischen Fenster zu verschaffen. Die Kapellenfenster
erlitten dieselbe Erweiterung. Auch die Westfront wurde den Barock-Formen angepasst,
eine neue Hauptthüre (mit der Jahreszahl 1730 am Sturz) angelegt und darüber eine
Nische mit der Statue des h. Nepomuk. Im Jahre 1737 Hess Stadtpfarrer Specht eine
neue hölzerne Decke im Langhause anbringen und bemalen. Im folgenden Jahre hören
wir noch von Herstellung der Wandmalereien im Langhause — der Chor war bereits
1734 in fresco gemalt worden — und damit erscheint diese Periode der Renovation
vollendet. Nach dieser Zeit verschiedene kleinere und grössere Reparaturen, die
letzte grössere i. J. 1878 (s. unten).
Wir beginnen die Beschreibung des Baues mit dem Aeussern. Dasselbe Aeusseres
zeigt schmucklosen Putzbau mit rothen Sandsteingewänden und Eckquadern. In Folge
der oben nachgewiesenen Umbauten und Anbauten ist nicht nur die Dachform eine sehr
unregelmässige, sondern auch nämlich die nördliche Seite der Vorderfront breiter als die
südliche, sitzt das Hauptportal nicht in der Mitte. Letzteres trägt, wie erwähnt, die Jahres-
zahl 1730 und ist in einfachen Barock-Formen gehalten; ebenso das südliche und nördliche
Nebenportal. Die Zumauerung des grossen Chorfensters und das Herausbrechen des Mass-
und Pfostenwerks der Seitenfenster daselbst haben die Wirkung des von kräftigen Strebe-
pfeilern umgebenen Chores nicht minder beeinträchtigt, als der Anbau der Sakristei im
Norden. Der Thurm, in seinen beiden oberen Stockwerken gelegentlich des Umbaues
zu Beginn des XVI. Jhs. erneuert, trägt seit der Restauration des vorigen Jahrhunderts
eine gebrochene welsche Haube (vergl. den Plan Fig. 43). Ein die nördliche Seitenthüre
umziehender grosser Rundbogen, trotz des Verputzes noch deutlich sichtbar, lässt darauf
schliessen, dass die betreffende Kapelle einst nach aussen vorsprang oder eine Vorhalle
sich hier angelehnt hat, die gelegentlich der Restauration von 1730 in Wegfall gekommen
sein mag.
Um die Kirche lag der älteste Friedhof der Stadt. Nach seiner Aufhebung sind
die Wohngebäude von Süden und Osten her so nahe an das Gotteshaus vorgerückt,
dass es begreiflich erscheint, wesshalb beim Umbau von 1730 auf die äussere Aus-
stattung, besonders auch der am nächsten bedrängten Hauptfagade, so wenig Gewicht
gelegt worden ist.
Den Glanzpunkt des Innern bildet der ungefähr in der Breite des Mittelschiffes inneres
quadratisch angelegte und von zwei langgestreckten Kreuzgewölben überspannte Chor.
Die Rippen und der mittlere Quergurt stützen sich auf 6 Konsolen, von denen die
beiden dem Triumphbogen zunächst befindlichen, in Folge der dort vorgenommenen Ab-
schrägung der Ecke etwas höher sitzen, als die übrigen. Auf diesen spätgothischen
Kragsteinen sind folgende Zierathe angebracht: 1. eine auf einem Drachen hockende,
grössere Figur, ein aufgeschlagenes Buch vor sich haltend, auf dem zur Erinnerung an
die letzte grosse Renovation: renov. 1878 aufgemalt ist; 2. eine kleinere Figur, einen
Ritter darstellend, der seinen Fuss auf das Haupt eines Unthiers stellt; 3. ein gothischer
Baldachin (die Figur darunter fehlt); 4. ein Vronik; 5. eine sitzende Figur und 6. eine
menschliche Fratze. In Folge der unsinnig starken Vergoldung dieser Konsolen sind
herausgebrochen, die Oeffnungen vergrössert und in denselben charakterlosen Barock-
Formen erneuert, die unten im neuen Seitenschiff angewendet worden waren. Diese
an sich höchst unerfreuliche Umänderung hatte den Zweck, dem Mittelschiff den erforder-
lichen Lichtersatz für die gelegentlich des Umbaues der Südseite ihrer direkten Lichtzufuhr
beraubten gegenüberliegenden gothischen Fenster zu verschaffen. Die Kapellenfenster
erlitten dieselbe Erweiterung. Auch die Westfront wurde den Barock-Formen angepasst,
eine neue Hauptthüre (mit der Jahreszahl 1730 am Sturz) angelegt und darüber eine
Nische mit der Statue des h. Nepomuk. Im Jahre 1737 Hess Stadtpfarrer Specht eine
neue hölzerne Decke im Langhause anbringen und bemalen. Im folgenden Jahre hören
wir noch von Herstellung der Wandmalereien im Langhause — der Chor war bereits
1734 in fresco gemalt worden — und damit erscheint diese Periode der Renovation
vollendet. Nach dieser Zeit verschiedene kleinere und grössere Reparaturen, die
letzte grössere i. J. 1878 (s. unten).
Wir beginnen die Beschreibung des Baues mit dem Aeussern. Dasselbe Aeusseres
zeigt schmucklosen Putzbau mit rothen Sandsteingewänden und Eckquadern. In Folge
der oben nachgewiesenen Umbauten und Anbauten ist nicht nur die Dachform eine sehr
unregelmässige, sondern auch nämlich die nördliche Seite der Vorderfront breiter als die
südliche, sitzt das Hauptportal nicht in der Mitte. Letzteres trägt, wie erwähnt, die Jahres-
zahl 1730 und ist in einfachen Barock-Formen gehalten; ebenso das südliche und nördliche
Nebenportal. Die Zumauerung des grossen Chorfensters und das Herausbrechen des Mass-
und Pfostenwerks der Seitenfenster daselbst haben die Wirkung des von kräftigen Strebe-
pfeilern umgebenen Chores nicht minder beeinträchtigt, als der Anbau der Sakristei im
Norden. Der Thurm, in seinen beiden oberen Stockwerken gelegentlich des Umbaues
zu Beginn des XVI. Jhs. erneuert, trägt seit der Restauration des vorigen Jahrhunderts
eine gebrochene welsche Haube (vergl. den Plan Fig. 43). Ein die nördliche Seitenthüre
umziehender grosser Rundbogen, trotz des Verputzes noch deutlich sichtbar, lässt darauf
schliessen, dass die betreffende Kapelle einst nach aussen vorsprang oder eine Vorhalle
sich hier angelehnt hat, die gelegentlich der Restauration von 1730 in Wegfall gekommen
sein mag.
Um die Kirche lag der älteste Friedhof der Stadt. Nach seiner Aufhebung sind
die Wohngebäude von Süden und Osten her so nahe an das Gotteshaus vorgerückt,
dass es begreiflich erscheint, wesshalb beim Umbau von 1730 auf die äussere Aus-
stattung, besonders auch der am nächsten bedrängten Hauptfagade, so wenig Gewicht
gelegt worden ist.
Den Glanzpunkt des Innern bildet der ungefähr in der Breite des Mittelschiffes inneres
quadratisch angelegte und von zwei langgestreckten Kreuzgewölben überspannte Chor.
Die Rippen und der mittlere Quergurt stützen sich auf 6 Konsolen, von denen die
beiden dem Triumphbogen zunächst befindlichen, in Folge der dort vorgenommenen Ab-
schrägung der Ecke etwas höher sitzen, als die übrigen. Auf diesen spätgothischen
Kragsteinen sind folgende Zierathe angebracht: 1. eine auf einem Drachen hockende,
grössere Figur, ein aufgeschlagenes Buch vor sich haltend, auf dem zur Erinnerung an
die letzte grosse Renovation: renov. 1878 aufgemalt ist; 2. eine kleinere Figur, einen
Ritter darstellend, der seinen Fuss auf das Haupt eines Unthiers stellt; 3. ein gothischer
Baldachin (die Figur darunter fehlt); 4. ein Vronik; 5. eine sitzende Figur und 6. eine
menschliche Fratze. In Folge der unsinnig starken Vergoldung dieser Konsolen sind