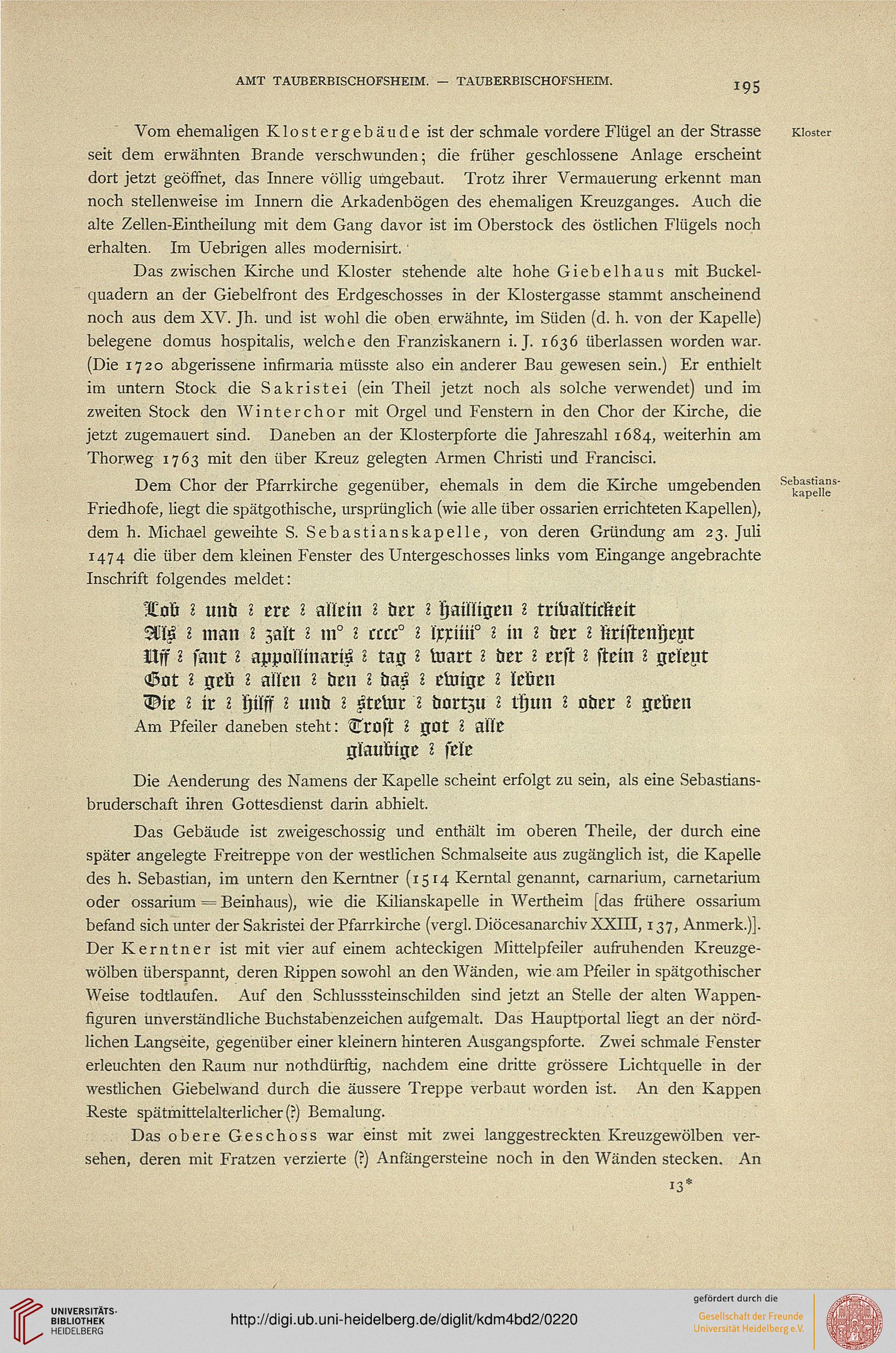AMT TAUBERBISCHOFSHEIM. — TAUBERBISCHOFSHEIM.
195
Vom ehemaligen Klostergebäude ist der schmale vordere Flügel an der Strasse
seit dem erwähnten Brande verschwunden; die früher geschlossene Anlage erscheint
dort jetzt geöffnet, das Innere völlig umgebaut. Trotz ihrer Vermauerung erkennt man
noch stellenweise im Innern die Arkadenbögen des ehemaligen Kreuzganges. Auch die
alte Zellen-Eintheilung mit dem Gang davor ist im Oberstock des östlichen Flügels noch
erhalten. Im Uebrigen alles modernisirt.'
Das zwischen Kirche und Kloster stehende alte hohe Giebelhaus mit Buckel-
quadern an der Giebelfront des Erdgeschosses in der Klostergasse stammt anscheinend
noch aus dem XV. Jh. und ist wohl die oben, erwähnte, im Süden (d. h. von der Kapelle)
belegene domus hospitalis, welche den Franziskanern i. J. 1636 überlassen worden war.
(Die 1720 abgerissene infirmaria müsste also ein anderer Bau gewesen sein.) Er enthielt
im untern Stock die Sakristei (ein Theil jetzt noch als solche verwendet) und im
zweiten Stock den Winterchor mit Orgel und Fenstern in den Chor der Kirche, die
jetzt zugemauert sind. Daneben an der Klosterpforte die Jahreszahl 1684, weiterhin am
Thorweg 1763 mit den über Kreuz gelegten Armen Christi und Francisci.
Dem Chor der Pfarrkirche gegenüber, ehemals in dem die Kirche umgebenden
Friedhofe, liegt die spätgothische, ursprünglich (wie alle über ossarien errichteten Kapellen),
dem h. Michael geweihte S. Sebastianskapelle, von deren Gründung am 23. Juli
1474 die über dem kleinen Fenster des Untergeschosses links vom Eingange angebrachte
Inschrift folgendes meldet:
KCnn 1 unn i ere 1 aiiein i ner i fjafrrigen i triualticfteit
%\f 1 man i salt i m° % tat i irpiii0 i in i oer i Htijtenljent
Jltff 1 fant 1 appoliinaril i tag i taart i ner i erft i ftein i gelent
<J5nt i gen i allen i oen i üa£ i einige i lenen
Wiz 1 \t 1 öüff 1 uno 1 |tetar i nortju i tgun i nnec i genen
Am Pfeiler daneben steht: ^Truft l gOt l alle
gtauuige i feie
Die Aenderung des Namens der Kapelle scheint erfolgt zu sein, als eine Sebastians-
bruderschaft ihren Gottesdienst darin abhielt.
Das Gebäude ist zweigeschossig und enthält im oberen Theile, der durch eine
später angelegte Freitreppe von der westlichen Schmalseite aus zugänglich ist, die Kapelle
des h. Sebastian, im untern den Kerntner (isr4 Kerntal genannt, carnarium, carnetarium
oder ossarium = Beinhaus), wie die Kilianskapelle in Wertheim [das frühere ossarium
befand sich unter der Sakristei der Pfarrkirche (vergl. Diöcesanarchiv XXIII, 137, Anmerk.)].
Der Kerntner ist mit vier auf einem achteckigen Mittelpfeiler aufruhenden Kreuzge-
wölben überspannt, deren Rippen sowohl an den Wänden, wie am Pfeiler in spätgothischer
Weise todtlaufen. Auf den Schlusssteinschilden sind jetzt an Stelle der alten Wappen-
figuren unverständliche Buchstabenzeichen aufgemalt. Das Hauptportal liegt an der nörd-
lichen Langseite, gegenüber einer kleinern hinteren Ausgangspforte. Zwei schmale Fenster
erleuchten den Raum nur nothdürftig, nachdem eine dritte grössere Lichtquelle in der
westlichen Giebelwand durch die äussere Treppe verbaut worden ist. An den Kappen
Reste spätmittelalterlicher (?) Bemalung.
Das obere Geschoss war einst mit zwei langgestreckten Kreuzgewölben ver-
sehen, deren mit Fratzen verzierte (?) Anfängersteine noch in den Wänden stecken. An
13*
Sebastians-
kapelle
195
Vom ehemaligen Klostergebäude ist der schmale vordere Flügel an der Strasse
seit dem erwähnten Brande verschwunden; die früher geschlossene Anlage erscheint
dort jetzt geöffnet, das Innere völlig umgebaut. Trotz ihrer Vermauerung erkennt man
noch stellenweise im Innern die Arkadenbögen des ehemaligen Kreuzganges. Auch die
alte Zellen-Eintheilung mit dem Gang davor ist im Oberstock des östlichen Flügels noch
erhalten. Im Uebrigen alles modernisirt.'
Das zwischen Kirche und Kloster stehende alte hohe Giebelhaus mit Buckel-
quadern an der Giebelfront des Erdgeschosses in der Klostergasse stammt anscheinend
noch aus dem XV. Jh. und ist wohl die oben, erwähnte, im Süden (d. h. von der Kapelle)
belegene domus hospitalis, welche den Franziskanern i. J. 1636 überlassen worden war.
(Die 1720 abgerissene infirmaria müsste also ein anderer Bau gewesen sein.) Er enthielt
im untern Stock die Sakristei (ein Theil jetzt noch als solche verwendet) und im
zweiten Stock den Winterchor mit Orgel und Fenstern in den Chor der Kirche, die
jetzt zugemauert sind. Daneben an der Klosterpforte die Jahreszahl 1684, weiterhin am
Thorweg 1763 mit den über Kreuz gelegten Armen Christi und Francisci.
Dem Chor der Pfarrkirche gegenüber, ehemals in dem die Kirche umgebenden
Friedhofe, liegt die spätgothische, ursprünglich (wie alle über ossarien errichteten Kapellen),
dem h. Michael geweihte S. Sebastianskapelle, von deren Gründung am 23. Juli
1474 die über dem kleinen Fenster des Untergeschosses links vom Eingange angebrachte
Inschrift folgendes meldet:
KCnn 1 unn i ere 1 aiiein i ner i fjafrrigen i triualticfteit
%\f 1 man i salt i m° % tat i irpiii0 i in i oer i Htijtenljent
Jltff 1 fant 1 appoliinaril i tag i taart i ner i erft i ftein i gelent
<J5nt i gen i allen i oen i üa£ i einige i lenen
Wiz 1 \t 1 öüff 1 uno 1 |tetar i nortju i tgun i nnec i genen
Am Pfeiler daneben steht: ^Truft l gOt l alle
gtauuige i feie
Die Aenderung des Namens der Kapelle scheint erfolgt zu sein, als eine Sebastians-
bruderschaft ihren Gottesdienst darin abhielt.
Das Gebäude ist zweigeschossig und enthält im oberen Theile, der durch eine
später angelegte Freitreppe von der westlichen Schmalseite aus zugänglich ist, die Kapelle
des h. Sebastian, im untern den Kerntner (isr4 Kerntal genannt, carnarium, carnetarium
oder ossarium = Beinhaus), wie die Kilianskapelle in Wertheim [das frühere ossarium
befand sich unter der Sakristei der Pfarrkirche (vergl. Diöcesanarchiv XXIII, 137, Anmerk.)].
Der Kerntner ist mit vier auf einem achteckigen Mittelpfeiler aufruhenden Kreuzge-
wölben überspannt, deren Rippen sowohl an den Wänden, wie am Pfeiler in spätgothischer
Weise todtlaufen. Auf den Schlusssteinschilden sind jetzt an Stelle der alten Wappen-
figuren unverständliche Buchstabenzeichen aufgemalt. Das Hauptportal liegt an der nörd-
lichen Langseite, gegenüber einer kleinern hinteren Ausgangspforte. Zwei schmale Fenster
erleuchten den Raum nur nothdürftig, nachdem eine dritte grössere Lichtquelle in der
westlichen Giebelwand durch die äussere Treppe verbaut worden ist. An den Kappen
Reste spätmittelalterlicher (?) Bemalung.
Das obere Geschoss war einst mit zwei langgestreckten Kreuzgewölben ver-
sehen, deren mit Fratzen verzierte (?) Anfängersteine noch in den Wänden stecken. An
13*
Sebastians-
kapelle