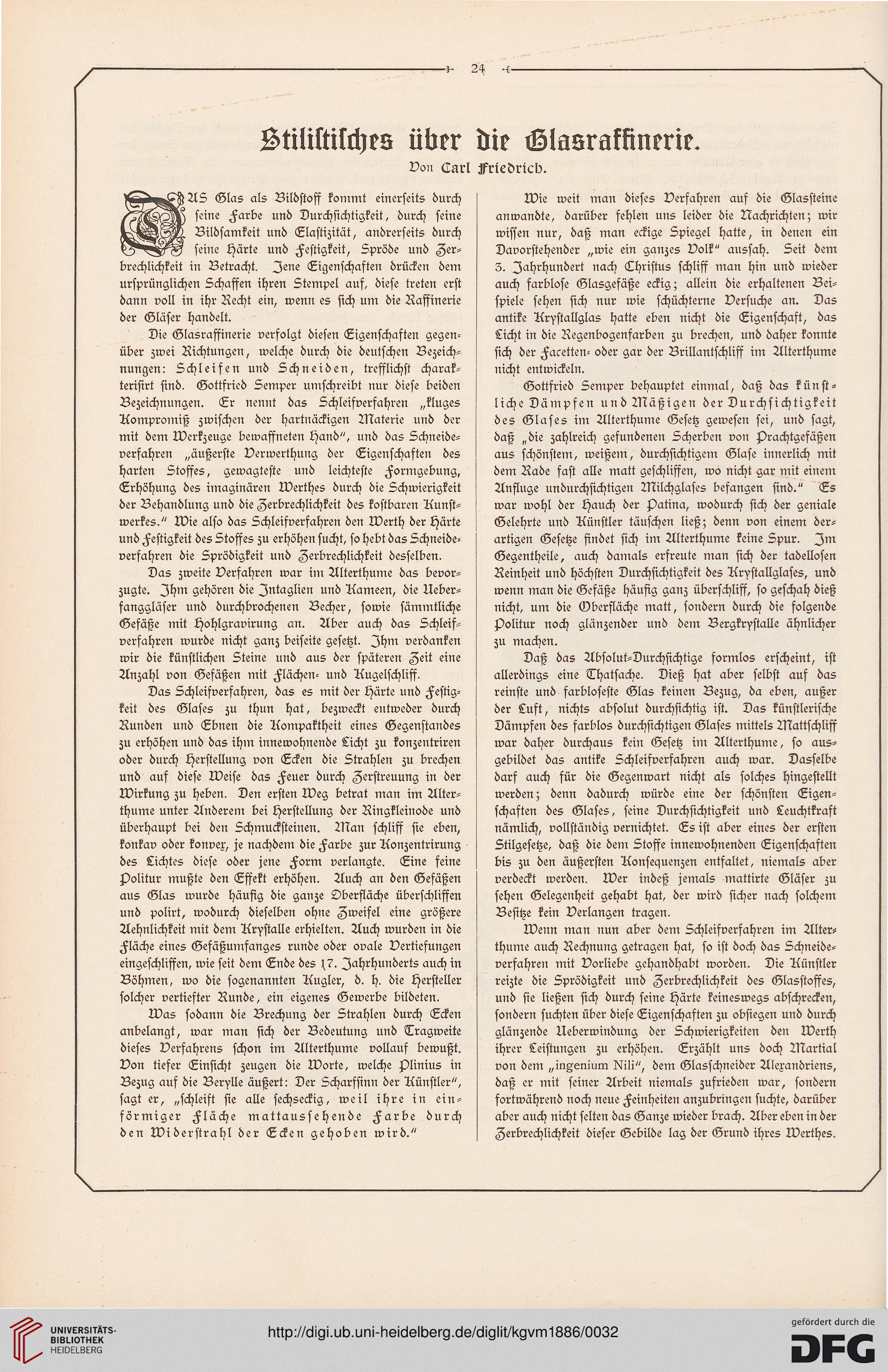Ltililtilches über
von Carl
215 Glas als Bildstoff kommt einerseits durch
feine Farbe und Durchsichtigkeit, durch seine
Bildsamkeit und Elastizität, andrerseits durch
feine Härte und Festigkeit, 5pröde und Zer-
brechlichkeit in Betracht. Jene Eigenschaften drücken dem
ursprünglichen Schaffen ihren Stempel auf, diese treten erst
dann voll in ihr Recht ein, wenn es sich um die Raffinerie
der Gläser handelt.
Die Glasraffinerie verfolgt diesen Eigenschaften gegen-
über zwei Richtungen, welche durch die deutschen Bezeich-
nungen: Schleifen und Schneiden, trefflichst charak-
terisirt sind. Gottfried Semper umschreibt nur diese beiden
Bezeichnungen. Er nennt das Schleifverfahren „kluges
Kompromiß zwischen der hartnäckigen Materie und der
mit dem Werkzeuge bewaffneten Hand", und das Schneide-
verfahren „äußerste Verwerthung der Eigenschaften des
harten Stoffes, gewagteste und leichteste Formgebung,
Erhöhung des imaginären Werthes durch die Schwierigkeit
der Behandlung und die Zerbrechlichkeit des kostbaren Kunst-
werkes." Wie also das Schleifverfahren den Werth der Härte
und Festigkeit des Stoffes zu erhöhen sucht, so hebt das Schneide-
verfahren die Sprödigkeit und Zerbrechlichkeit desselben.
Das zweite Verfahren war ini Alterthume das bevor-
zugte. Ihm gehören die Intaglien und Kameen, die Ueber-
fanggläser und durchbrochenen Becher, sowie sämmtliche
Gefäße mit Hohlgravirung an. Aber auch das Schleif-
verfahren wurde nicht ganz beiseite gesetzt. Ihm verdanken
wir die künstlichen Steine und aus der späteren Zeit eine
Anzahl von Gefäßen mit Flächen- und Kugelschliff.
Das Schleifverfahren, das es mit der Härte und Festig-
keit des Glases zu thun hat, bezweckt entweder durch
Runden und Ebnen die Kompaktheit eines Gegenstandes
zu erhöhen und das ihm innewohnende Licht zu konzentriren
oder durch Herstellung von Ecken die Strahlen zu brechen
und auf diese Weise das Feuer durch Zerstreuung in der
Wirkung zu heben. Den ersten Weg betrat man im Alter-
thume unter 2lnderem bei Herstellung der Ringkleinode und
überhaupt bei den Schmucksteinen. Man schliff sie eben,
konkav oder konvex, je nachdem die Farbe zur Konzentrirung
des Lichtes diese oder jene Form verlangte. Eine feine
Politur mußte den Effekt erhöhen. Auch an den Gefäßen
aus Glas wurde häufig die ganze Oberfläche überschliffen
und polirt, wodurch dieselben ohne Zweifel eine größere
Aehnlichkeit mit dem Krystalle erhielten. Auch wurden in die
Fläche eines Gefäßumfanges runde oder ovale Vertiefungen
eingeschliffen, wie seit dem Ende des \7. Jahrhunderts auch in
Böhmen, wo die sogenannten Kugler, d. h. die Hersteller
solcher vertiefter Runde, ein eigenes Gewerbe bildeten.
Was sodann die Brechung der Strahlen durch Ecken
anbelangt, war man sich der Bedeutung und Tragweite
dieses Verfahrens schon im Alterthume vollauf bewußt,
von tiefer Einsicht zeugen die Worte, welche Plinius in
Bezug auf die Berylle äußert: Der Scharfsinn der Künstler",
sagt er, „schleift sie alle sechseckig, weil ihre in ein-
förmiger Fläche mattaussehende Farbe durch
den Widerstrahl der Ecken gehoben wird."
die GlssraMnerie.
zfrtedricd.
Wie weit man dieses Verfahren auf die Glassteine
anwandte, darüber fehlen uns leider die Nachrichten; wir
wissen nur, daß man eckige Spiegel hatte, in denen ein
Davorstehender „wie ein ganzes Volk" aussah. Seit dem
3. Jahrhundert nach Christus schliff man hin und wieder
auch farblose Glasgefäße eckig; allein die erhaltenen Bei-
spiele sehen sich nur wie schüchterne Versuche an. Das
antike Krystallglas hatte eben nicht die Eigenschaft, das
Licht in die Regenbogenfarben zu brechen, und daher konnte
sich der Facetten- oder gar der Brillantschliff im Alterthume
nicht entwickeln.
Gottfried Semper behauptet einmal, daß das künst-
liche Dämpfen und Mäßigen der Durchsichtigkeit
des Glases im 2llterthume Gesetz gewesen sei, und sagt,
daß „die zahlreich gefundenen Scherben von Prachtgefäßen
aus schönstem, weißem, durchsichtigeur Glase innerlich mit
dem Rade fast alle matt geschliffen, wo nicht gar mit einem
Anfluge undurchsichtigen Milchglases befangen sind." Es
war wohl der Hauch der Patina, wodurch sich der geniale
Gelehrte und Künstler täuschen ließ; denn von einem der-
artigen Gesetze findet sich im Alterthume keine Spur. Im
Gegentheile, auch damals erfreute man sich der tadellosen
Reinheit und höchsten Durchsichtigkeit des Krystallglases, und
wenn man die Gefäße häufig ganz überschliff, so geschah dieß
nicht, um die Mberfläche matt, sondern durch die folgende
Politur noch glänzender und dem Bergkrystalle ähnlicher
zu machen.
Daß das Absolut-Durchsichtige formlos erscheint, ist
allerdings eine Thatsache. Dieß hat aber selbst auf das
reinste und farbloseste Glas keinen Bezug, da eben, außer
der Luft, nichts absolut durchsichtig ist. Das künstlerische
Dämpfen des farblos durchsichtigen Glases mittels Mattschliff
war daher durchaus kein Gesetz im Alterthume, so aus-
gebildet das antike Schleifverfahren auch war. Dasselbe
darf auch für die Gegenwart nicht als solches hingestellt
werden; denn dadurch würde eine der schönsten Eigen-
schaften des Glases, seine Durchsichtigkeit und Leuchtkraft
nämlich, vollständig vernichtet. Es ist aber eines der ersten
Stilgesetze, daß die dem Stoffe innewohnenden Eigenschaften
bis zu den äußersten Konsequenzen entfaltet, niemals aber
verdeckt werden. Mer indeß jemals mattirte Gläser zu
sehen Gelegenheit gehabt hat, der wird sicher nach solchem
Besitze kein verlangen tragen.
Wenn man nun aber dem Schleifverfahren im Alter-
thume auch Rechnung getragen hat, so ist doch das Schneide-
verfahren mit Vorliebe gehandhabt worden. Die Künstler
reizte die Sprödigkeit und Zerbrechlichkeit des Glasstoffes,
und sie ließen sich durch seine Härte keineswegs abschrecken,
sondern suchten über diese Eigenschaften zu obsiegen und durch
glänzende Aeberwindung der Schwierigkeiten den Werth
ihrer Leistungen zu erhöhen. Erzählt uns doch Martial
von dem „in§enium Nili", dem Glasschneider Alexandriens,
daß er mit seiner Arbeit niemals zufrieden war, sondern
fortwährend noch neue Feinheiten anzubringen suchte, darüber
aber auch nicht selten das Ganze wieder brach. Aber eben in der
Zerbrechlichkeit dieser Gebilde lag der Grund ihres Werthes.
von Carl
215 Glas als Bildstoff kommt einerseits durch
feine Farbe und Durchsichtigkeit, durch seine
Bildsamkeit und Elastizität, andrerseits durch
feine Härte und Festigkeit, 5pröde und Zer-
brechlichkeit in Betracht. Jene Eigenschaften drücken dem
ursprünglichen Schaffen ihren Stempel auf, diese treten erst
dann voll in ihr Recht ein, wenn es sich um die Raffinerie
der Gläser handelt.
Die Glasraffinerie verfolgt diesen Eigenschaften gegen-
über zwei Richtungen, welche durch die deutschen Bezeich-
nungen: Schleifen und Schneiden, trefflichst charak-
terisirt sind. Gottfried Semper umschreibt nur diese beiden
Bezeichnungen. Er nennt das Schleifverfahren „kluges
Kompromiß zwischen der hartnäckigen Materie und der
mit dem Werkzeuge bewaffneten Hand", und das Schneide-
verfahren „äußerste Verwerthung der Eigenschaften des
harten Stoffes, gewagteste und leichteste Formgebung,
Erhöhung des imaginären Werthes durch die Schwierigkeit
der Behandlung und die Zerbrechlichkeit des kostbaren Kunst-
werkes." Wie also das Schleifverfahren den Werth der Härte
und Festigkeit des Stoffes zu erhöhen sucht, so hebt das Schneide-
verfahren die Sprödigkeit und Zerbrechlichkeit desselben.
Das zweite Verfahren war ini Alterthume das bevor-
zugte. Ihm gehören die Intaglien und Kameen, die Ueber-
fanggläser und durchbrochenen Becher, sowie sämmtliche
Gefäße mit Hohlgravirung an. Aber auch das Schleif-
verfahren wurde nicht ganz beiseite gesetzt. Ihm verdanken
wir die künstlichen Steine und aus der späteren Zeit eine
Anzahl von Gefäßen mit Flächen- und Kugelschliff.
Das Schleifverfahren, das es mit der Härte und Festig-
keit des Glases zu thun hat, bezweckt entweder durch
Runden und Ebnen die Kompaktheit eines Gegenstandes
zu erhöhen und das ihm innewohnende Licht zu konzentriren
oder durch Herstellung von Ecken die Strahlen zu brechen
und auf diese Weise das Feuer durch Zerstreuung in der
Wirkung zu heben. Den ersten Weg betrat man im Alter-
thume unter 2lnderem bei Herstellung der Ringkleinode und
überhaupt bei den Schmucksteinen. Man schliff sie eben,
konkav oder konvex, je nachdem die Farbe zur Konzentrirung
des Lichtes diese oder jene Form verlangte. Eine feine
Politur mußte den Effekt erhöhen. Auch an den Gefäßen
aus Glas wurde häufig die ganze Oberfläche überschliffen
und polirt, wodurch dieselben ohne Zweifel eine größere
Aehnlichkeit mit dem Krystalle erhielten. Auch wurden in die
Fläche eines Gefäßumfanges runde oder ovale Vertiefungen
eingeschliffen, wie seit dem Ende des \7. Jahrhunderts auch in
Böhmen, wo die sogenannten Kugler, d. h. die Hersteller
solcher vertiefter Runde, ein eigenes Gewerbe bildeten.
Was sodann die Brechung der Strahlen durch Ecken
anbelangt, war man sich der Bedeutung und Tragweite
dieses Verfahrens schon im Alterthume vollauf bewußt,
von tiefer Einsicht zeugen die Worte, welche Plinius in
Bezug auf die Berylle äußert: Der Scharfsinn der Künstler",
sagt er, „schleift sie alle sechseckig, weil ihre in ein-
förmiger Fläche mattaussehende Farbe durch
den Widerstrahl der Ecken gehoben wird."
die GlssraMnerie.
zfrtedricd.
Wie weit man dieses Verfahren auf die Glassteine
anwandte, darüber fehlen uns leider die Nachrichten; wir
wissen nur, daß man eckige Spiegel hatte, in denen ein
Davorstehender „wie ein ganzes Volk" aussah. Seit dem
3. Jahrhundert nach Christus schliff man hin und wieder
auch farblose Glasgefäße eckig; allein die erhaltenen Bei-
spiele sehen sich nur wie schüchterne Versuche an. Das
antike Krystallglas hatte eben nicht die Eigenschaft, das
Licht in die Regenbogenfarben zu brechen, und daher konnte
sich der Facetten- oder gar der Brillantschliff im Alterthume
nicht entwickeln.
Gottfried Semper behauptet einmal, daß das künst-
liche Dämpfen und Mäßigen der Durchsichtigkeit
des Glases im 2llterthume Gesetz gewesen sei, und sagt,
daß „die zahlreich gefundenen Scherben von Prachtgefäßen
aus schönstem, weißem, durchsichtigeur Glase innerlich mit
dem Rade fast alle matt geschliffen, wo nicht gar mit einem
Anfluge undurchsichtigen Milchglases befangen sind." Es
war wohl der Hauch der Patina, wodurch sich der geniale
Gelehrte und Künstler täuschen ließ; denn von einem der-
artigen Gesetze findet sich im Alterthume keine Spur. Im
Gegentheile, auch damals erfreute man sich der tadellosen
Reinheit und höchsten Durchsichtigkeit des Krystallglases, und
wenn man die Gefäße häufig ganz überschliff, so geschah dieß
nicht, um die Mberfläche matt, sondern durch die folgende
Politur noch glänzender und dem Bergkrystalle ähnlicher
zu machen.
Daß das Absolut-Durchsichtige formlos erscheint, ist
allerdings eine Thatsache. Dieß hat aber selbst auf das
reinste und farbloseste Glas keinen Bezug, da eben, außer
der Luft, nichts absolut durchsichtig ist. Das künstlerische
Dämpfen des farblos durchsichtigen Glases mittels Mattschliff
war daher durchaus kein Gesetz im Alterthume, so aus-
gebildet das antike Schleifverfahren auch war. Dasselbe
darf auch für die Gegenwart nicht als solches hingestellt
werden; denn dadurch würde eine der schönsten Eigen-
schaften des Glases, seine Durchsichtigkeit und Leuchtkraft
nämlich, vollständig vernichtet. Es ist aber eines der ersten
Stilgesetze, daß die dem Stoffe innewohnenden Eigenschaften
bis zu den äußersten Konsequenzen entfaltet, niemals aber
verdeckt werden. Mer indeß jemals mattirte Gläser zu
sehen Gelegenheit gehabt hat, der wird sicher nach solchem
Besitze kein verlangen tragen.
Wenn man nun aber dem Schleifverfahren im Alter-
thume auch Rechnung getragen hat, so ist doch das Schneide-
verfahren mit Vorliebe gehandhabt worden. Die Künstler
reizte die Sprödigkeit und Zerbrechlichkeit des Glasstoffes,
und sie ließen sich durch seine Härte keineswegs abschrecken,
sondern suchten über diese Eigenschaften zu obsiegen und durch
glänzende Aeberwindung der Schwierigkeiten den Werth
ihrer Leistungen zu erhöhen. Erzählt uns doch Martial
von dem „in§enium Nili", dem Glasschneider Alexandriens,
daß er mit seiner Arbeit niemals zufrieden war, sondern
fortwährend noch neue Feinheiten anzubringen suchte, darüber
aber auch nicht selten das Ganze wieder brach. Aber eben in der
Zerbrechlichkeit dieser Gebilde lag der Grund ihres Werthes.