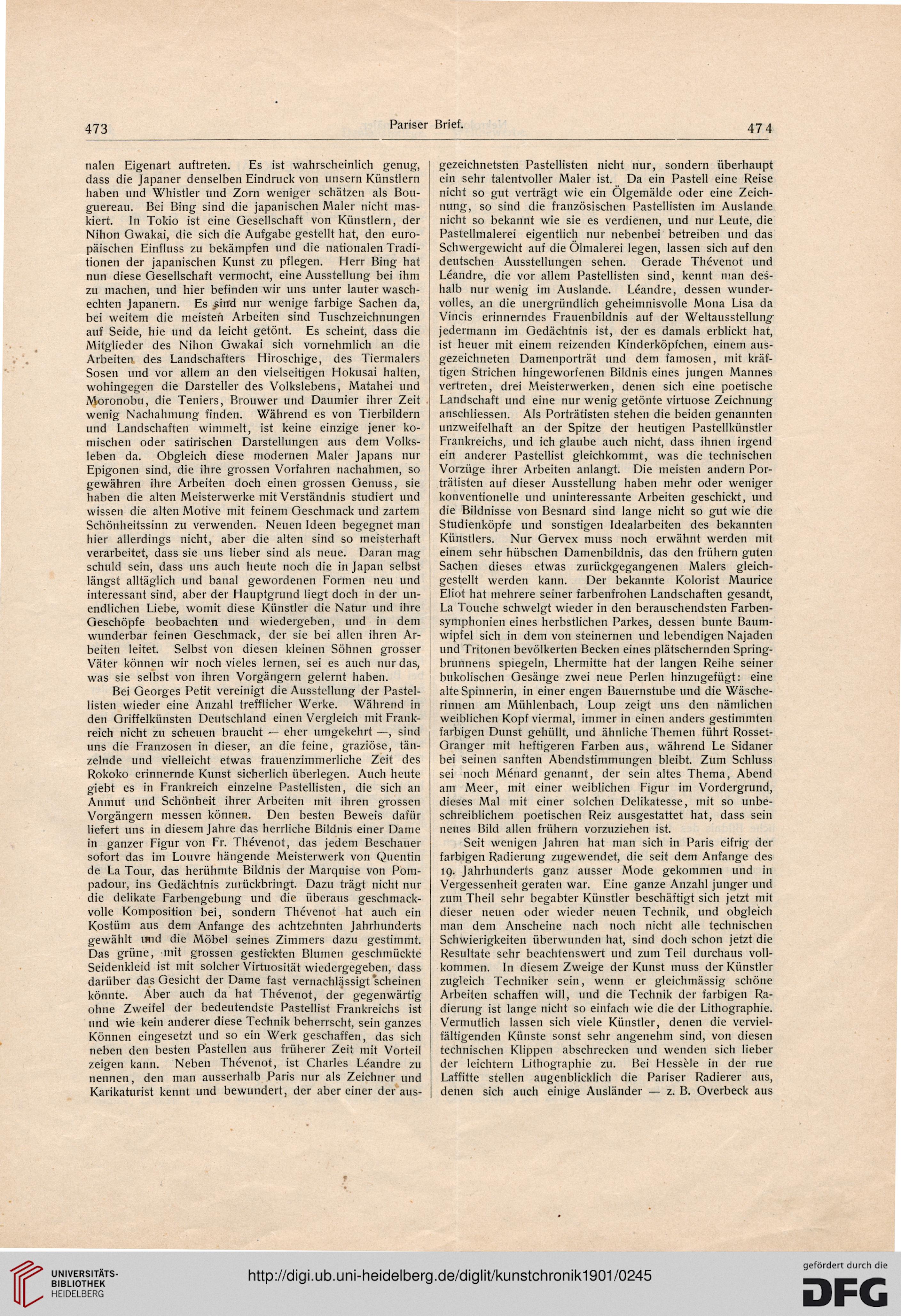473
Pariser Brief.
nalen Eigenart auftreten. Es ist wahrscheinlich genug,
dass die Japaner denselben Eindruck von unsern Künstlern
haben und Whistler und Zorn weniger schätzen als Bou-
guereau. Bei Bing sind die japanischen Maler nicht mas-
kiert. In Tokio ist eine Gesellschaft von Künstlern, der
Nihon Gwakai, die sich die Aufgabe gestellt hat, den euro-
päischen Einfluss zu bekämpfen und die nationalen Tradi-
tionen der japanischen Kunst zu pflegen. Herr Bing hat
nun diese Gesellschaft vermocht, eine Ausstellung bei ihm
zu machen, und hier befinden wir uns unter lauter wasch-
echten Japanern. Es sind nur wenige farbige Sachen da,
bei weitem die meisten Arbeiten sind Tuschzeichnungen
auf Seide, hie und da leicht getönt. Es scheint, dass die
Mitglieder des Nihon Gwakai sich vornehmlich an die
Arbeiten des Landschafters Hiroschige, des Tiermalers
Sosen und vor allem an den vielseitigen Hokusai halten,
wohingegen die Darsteller des Volkslebens, Matahei und
Moronobu, die Teniers, Brouwer und Daumier ihrer Zeit
wenig Nachahmung finden. Während es von Tierbildern
und Landschaften wimmelt, ist keine einzige jener ko-
mischen oder satirischen Darstellungen aus dem Volks-
leben da. Obgleich diese modernen Maler Japans nur
Epigonen sind, die ihre grossen Vorfahren nachahmen, so
gewähren ihre Arbeiten doch einen grossen Genuss, sie
haben die alten Meisterwerke mit Verständnis studiert und
wissen die alten Motive mit feinem Geschmack und zartem
Schönheitssinn zu verwenden. Neuen Ideen begegnet man
hier allerdings nicht, aber die alten sind so meisterhaft
verarbeitet, dass sie uns lieber sind als neue. Daran mag
schuld sein, dass uns auch heute noch die in Japan selbst
längst alltäglich und banal gewordenen Formen neu und
interessant sind, aber der Hauptgrund liegt doch in der un-
endlichen Liebe, womit diese Künstler die Natur und ihre
Geschöpfe beobachten und wiedergeben, und in dem
wunderbar feinen Geschmack, der sie bei allen ihren Ar-
beiten leitet. Selbst von diesen kleinen Söhnen grosser
Väter können wir noch vieles lernen, sei es auch nur das,
was sie selbst von ihren Vorgängern gelernt haben.
Bei Georges Petit vereinigt die Ausstellung der Pastel-
listen wieder eine Anzahl trefflicher Werke. Während in
den Griffelkünsten Deutschland einen Vergleich mit Frank-
reich nicht zu scheuen braucht — eher umgekehrt —, sind
uns die Franzosen in dieser, an die feine, graziöse, tän-
zelnde und vielleicht etwas frauenzimmerliche Zeit des
Rokoko erinnernde Kunst sicherlich überlegen. Auch heute
giebt es in Frankreich einzelne Pastellisten, die sich an
Anmut und Schönheit ihrer Arbeiten mit ihren grossen
Vorgängern messen können. Den besten Beweis dafür
liefert uns in diesem Jahre das herrliche Bildnis einer Dame
in ganzer Figur von Fr. Thevenot, das jedem Beschauer
sofort das im Louvre hängende Meisterwerk von Quentin
de La Tour, das herühmte Bildnis der Marquise von Pom-
padour, ins Gedächtnis zurückbringt. Dazu trägt nicht nur
die delikate Farbengebung und die überaus geschmack-
volle Komposition bei, sondern Thevenot hat auch ein
Kostüm aus dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts
gewählt und die Möbel seines Zimmers dazu gestimmt.
Das grüne, mit grossen gestickten Blumen geschmückte
Seidenkleid ist mit solcher Virtuosität wiedergegeben, dass
darüber das Gesicht der Dame fast vernachlässigt 'scheinen
könnte. Aber auch da hat Thevenot, der gegenwärtig
ohne Zweifel der bedeutendste Pastellist Frankreichs ist
und wie kein anderer diese Technik beherrscht, sein ganzes
Können eingesetzt und so ein Werk geschaffen, das sich
neben den besten Pastellen aus früherer Zeit mit Vorteil
zeigen kann. Neben Thevenot, ist Charles Leandre zu
nennen, den man ausserhalb Paris nur als Zeichner und
Karikaturist kennt und bewundert, der aber einer der aus-
gezeichnetsten Pastellisten nicht nur, sondern überhaupt
ein sehr talentvoller Maler ist. Da ein Pastell eine Reise
nicht so gut verträgt wie ein Ölgemälde oder eine Zeich-
nung, so sind die französischen Pastellisten im Auslande
nicht so bekannt wie sie es verdienen, und nur Leute, die
Pastellmalerei eigentlich nur nebenbei betreiben und das
Schwergewicht auf die Ölmalerei legen, lassen sich auf den
deutschen Ausstellungen sehen. Gerade Thevenot und
Leandre, die vor allem Pastellisten sind, kennt man des-
halb nur wenig im Auslande. Leandre, dessen wunder-
volles, an die unergründlich geheimnisvolle Mona Lisa da
Vincis erinnerndes Frauenbildnis auf der Weltausstellung
| jedermann im Gedächtnis ist, der es damals erblickt hat,
ist heuer mit einem reizenden Kinderköpfchen, einem aus-
gezeichneten Damenporträt und dem famosen, mit kräf-
tigen Strichen hingeworfenen Bildnis eines jungen Mannes
vertreten, drei Meisterwerken, denen sich eine poetische
Landschaft und eine nur wenig getönte virtuose Zeichnung
j anschliessen. Als Porträtisten stehen die beiden genannten
unzweifelhaft an der Spitze der heutigen Pastellkünstler
Frankreichs, und ich glaube auch nicht, dass ihnen irgend
ein anderer Pastellist gleichkommt, was die technischen
Vorzüge ihrer Arbeiten anlangt. Die meisten andern Por-
trätisten auf dieser Ausstellung haben mehr oder weniger
konventionelle und uninteressante Arbeiten geschickt, und
die Bildnisse von Besnard sind lange nicht so gut wie die
Studienköpfe und sonstigen Idealarbeiten des bekannten
Künstlers. Nur Gervex muss noch erwähnt werden mit
einem sehr hübschen Damenbildnis, das den frühern guten
Sachen dieses etwas zurückgegangenen Malers gleich-
gestellt werden kann. Der bekannte Kolorist Maurice
Eliot hat mehrere seiner farbenfrohen Landschaften gesandt,
La Touche schwelgt wieder in den berauschendsten Farben-
symphonien eines herbstlichen Parkes, dessen bunte Baum-
wipfel sich in dem von steinernen und lebendigen Najaden
und Tritonen bevölkerten Becken eines plätschernden Spring-
brunnens spiegeln, Lhermitte hat der langen Reihe seiner
bukolischen Gesänge zwei neue Perlen hinzugefügt: eine
alte Spinnerin, in einer engen Bauernstube und die Wäsche-
rinnen am Mühlenbach, Loup zeigt uns den nämlichen
weiblichen Kopf viermal, immer in einen anders gestimmten
farbigen Dunst gehüllt, und ähnliche Themen führt Rosset-
Granger mit heftigeren Farben aus, während Le Sidaner
bei seinen sanften Abendstimmungen bleibt. Zum Schluss
sei noch Menard genannt, der sein altes Thema, Abend
am Meer, mit einer weiblichen Figur im Vordergrund,
dieses Mal mit einer solchen Delikatesse, mit so unbe-
schreiblichem poetischen Reiz ausgestattet hat, dass sein
neues Bild allen frühern vorzuziehen ist.
Seit wenigen Jahren hat man sich in Paris eifrig der
farbigen Radierung zugewendet, die seit dem Anfange des
ig. Jahrhunderts ganz ausser Mode gekommen und in
Vergessenheit geraten war. Eine ganze Anzahl junger und
zum Theil sehr begabter Künstler beschäftigt sich jetzt mit
dieser neuen oder wieder neuen Technik, und obgleich
man dem Anscheine nach noch nicht alle technischen
Schwierigkeiten überwunden hat, sind doch schon jetzt die
Resultate sehr beachtenswert und zum Teil durchaus voll-
kommen. In diesem Zweige der Kunst muss der Künstler
zugleich Techniker sein, wenn er gleichmässig schöne
Arbeiten schaffen will, und die Technik der farbigen Ra-
dierung ist lange nicht so einfach wie die der Lithographie.
Vermutlich lassen sich viele Künstler, denen die verviel-
fältigenden Künste sonst sehr angenehm sind, von diesen
technischen Klippen abschrecken und wenden sich lieber
der leichtern Lithographie zu. Bei Hessele in der rue
Laffitte stellen augenblicklich die Pariser Radierer aus,
denen sich auch einige Ausländer — z. B. Overbeck aus
Pariser Brief.
nalen Eigenart auftreten. Es ist wahrscheinlich genug,
dass die Japaner denselben Eindruck von unsern Künstlern
haben und Whistler und Zorn weniger schätzen als Bou-
guereau. Bei Bing sind die japanischen Maler nicht mas-
kiert. In Tokio ist eine Gesellschaft von Künstlern, der
Nihon Gwakai, die sich die Aufgabe gestellt hat, den euro-
päischen Einfluss zu bekämpfen und die nationalen Tradi-
tionen der japanischen Kunst zu pflegen. Herr Bing hat
nun diese Gesellschaft vermocht, eine Ausstellung bei ihm
zu machen, und hier befinden wir uns unter lauter wasch-
echten Japanern. Es sind nur wenige farbige Sachen da,
bei weitem die meisten Arbeiten sind Tuschzeichnungen
auf Seide, hie und da leicht getönt. Es scheint, dass die
Mitglieder des Nihon Gwakai sich vornehmlich an die
Arbeiten des Landschafters Hiroschige, des Tiermalers
Sosen und vor allem an den vielseitigen Hokusai halten,
wohingegen die Darsteller des Volkslebens, Matahei und
Moronobu, die Teniers, Brouwer und Daumier ihrer Zeit
wenig Nachahmung finden. Während es von Tierbildern
und Landschaften wimmelt, ist keine einzige jener ko-
mischen oder satirischen Darstellungen aus dem Volks-
leben da. Obgleich diese modernen Maler Japans nur
Epigonen sind, die ihre grossen Vorfahren nachahmen, so
gewähren ihre Arbeiten doch einen grossen Genuss, sie
haben die alten Meisterwerke mit Verständnis studiert und
wissen die alten Motive mit feinem Geschmack und zartem
Schönheitssinn zu verwenden. Neuen Ideen begegnet man
hier allerdings nicht, aber die alten sind so meisterhaft
verarbeitet, dass sie uns lieber sind als neue. Daran mag
schuld sein, dass uns auch heute noch die in Japan selbst
längst alltäglich und banal gewordenen Formen neu und
interessant sind, aber der Hauptgrund liegt doch in der un-
endlichen Liebe, womit diese Künstler die Natur und ihre
Geschöpfe beobachten und wiedergeben, und in dem
wunderbar feinen Geschmack, der sie bei allen ihren Ar-
beiten leitet. Selbst von diesen kleinen Söhnen grosser
Väter können wir noch vieles lernen, sei es auch nur das,
was sie selbst von ihren Vorgängern gelernt haben.
Bei Georges Petit vereinigt die Ausstellung der Pastel-
listen wieder eine Anzahl trefflicher Werke. Während in
den Griffelkünsten Deutschland einen Vergleich mit Frank-
reich nicht zu scheuen braucht — eher umgekehrt —, sind
uns die Franzosen in dieser, an die feine, graziöse, tän-
zelnde und vielleicht etwas frauenzimmerliche Zeit des
Rokoko erinnernde Kunst sicherlich überlegen. Auch heute
giebt es in Frankreich einzelne Pastellisten, die sich an
Anmut und Schönheit ihrer Arbeiten mit ihren grossen
Vorgängern messen können. Den besten Beweis dafür
liefert uns in diesem Jahre das herrliche Bildnis einer Dame
in ganzer Figur von Fr. Thevenot, das jedem Beschauer
sofort das im Louvre hängende Meisterwerk von Quentin
de La Tour, das herühmte Bildnis der Marquise von Pom-
padour, ins Gedächtnis zurückbringt. Dazu trägt nicht nur
die delikate Farbengebung und die überaus geschmack-
volle Komposition bei, sondern Thevenot hat auch ein
Kostüm aus dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts
gewählt und die Möbel seines Zimmers dazu gestimmt.
Das grüne, mit grossen gestickten Blumen geschmückte
Seidenkleid ist mit solcher Virtuosität wiedergegeben, dass
darüber das Gesicht der Dame fast vernachlässigt 'scheinen
könnte. Aber auch da hat Thevenot, der gegenwärtig
ohne Zweifel der bedeutendste Pastellist Frankreichs ist
und wie kein anderer diese Technik beherrscht, sein ganzes
Können eingesetzt und so ein Werk geschaffen, das sich
neben den besten Pastellen aus früherer Zeit mit Vorteil
zeigen kann. Neben Thevenot, ist Charles Leandre zu
nennen, den man ausserhalb Paris nur als Zeichner und
Karikaturist kennt und bewundert, der aber einer der aus-
gezeichnetsten Pastellisten nicht nur, sondern überhaupt
ein sehr talentvoller Maler ist. Da ein Pastell eine Reise
nicht so gut verträgt wie ein Ölgemälde oder eine Zeich-
nung, so sind die französischen Pastellisten im Auslande
nicht so bekannt wie sie es verdienen, und nur Leute, die
Pastellmalerei eigentlich nur nebenbei betreiben und das
Schwergewicht auf die Ölmalerei legen, lassen sich auf den
deutschen Ausstellungen sehen. Gerade Thevenot und
Leandre, die vor allem Pastellisten sind, kennt man des-
halb nur wenig im Auslande. Leandre, dessen wunder-
volles, an die unergründlich geheimnisvolle Mona Lisa da
Vincis erinnerndes Frauenbildnis auf der Weltausstellung
| jedermann im Gedächtnis ist, der es damals erblickt hat,
ist heuer mit einem reizenden Kinderköpfchen, einem aus-
gezeichneten Damenporträt und dem famosen, mit kräf-
tigen Strichen hingeworfenen Bildnis eines jungen Mannes
vertreten, drei Meisterwerken, denen sich eine poetische
Landschaft und eine nur wenig getönte virtuose Zeichnung
j anschliessen. Als Porträtisten stehen die beiden genannten
unzweifelhaft an der Spitze der heutigen Pastellkünstler
Frankreichs, und ich glaube auch nicht, dass ihnen irgend
ein anderer Pastellist gleichkommt, was die technischen
Vorzüge ihrer Arbeiten anlangt. Die meisten andern Por-
trätisten auf dieser Ausstellung haben mehr oder weniger
konventionelle und uninteressante Arbeiten geschickt, und
die Bildnisse von Besnard sind lange nicht so gut wie die
Studienköpfe und sonstigen Idealarbeiten des bekannten
Künstlers. Nur Gervex muss noch erwähnt werden mit
einem sehr hübschen Damenbildnis, das den frühern guten
Sachen dieses etwas zurückgegangenen Malers gleich-
gestellt werden kann. Der bekannte Kolorist Maurice
Eliot hat mehrere seiner farbenfrohen Landschaften gesandt,
La Touche schwelgt wieder in den berauschendsten Farben-
symphonien eines herbstlichen Parkes, dessen bunte Baum-
wipfel sich in dem von steinernen und lebendigen Najaden
und Tritonen bevölkerten Becken eines plätschernden Spring-
brunnens spiegeln, Lhermitte hat der langen Reihe seiner
bukolischen Gesänge zwei neue Perlen hinzugefügt: eine
alte Spinnerin, in einer engen Bauernstube und die Wäsche-
rinnen am Mühlenbach, Loup zeigt uns den nämlichen
weiblichen Kopf viermal, immer in einen anders gestimmten
farbigen Dunst gehüllt, und ähnliche Themen führt Rosset-
Granger mit heftigeren Farben aus, während Le Sidaner
bei seinen sanften Abendstimmungen bleibt. Zum Schluss
sei noch Menard genannt, der sein altes Thema, Abend
am Meer, mit einer weiblichen Figur im Vordergrund,
dieses Mal mit einer solchen Delikatesse, mit so unbe-
schreiblichem poetischen Reiz ausgestattet hat, dass sein
neues Bild allen frühern vorzuziehen ist.
Seit wenigen Jahren hat man sich in Paris eifrig der
farbigen Radierung zugewendet, die seit dem Anfange des
ig. Jahrhunderts ganz ausser Mode gekommen und in
Vergessenheit geraten war. Eine ganze Anzahl junger und
zum Theil sehr begabter Künstler beschäftigt sich jetzt mit
dieser neuen oder wieder neuen Technik, und obgleich
man dem Anscheine nach noch nicht alle technischen
Schwierigkeiten überwunden hat, sind doch schon jetzt die
Resultate sehr beachtenswert und zum Teil durchaus voll-
kommen. In diesem Zweige der Kunst muss der Künstler
zugleich Techniker sein, wenn er gleichmässig schöne
Arbeiten schaffen will, und die Technik der farbigen Ra-
dierung ist lange nicht so einfach wie die der Lithographie.
Vermutlich lassen sich viele Künstler, denen die verviel-
fältigenden Künste sonst sehr angenehm sind, von diesen
technischen Klippen abschrecken und wenden sich lieber
der leichtern Lithographie zu. Bei Hessele in der rue
Laffitte stellen augenblicklich die Pariser Radierer aus,
denen sich auch einige Ausländer — z. B. Overbeck aus