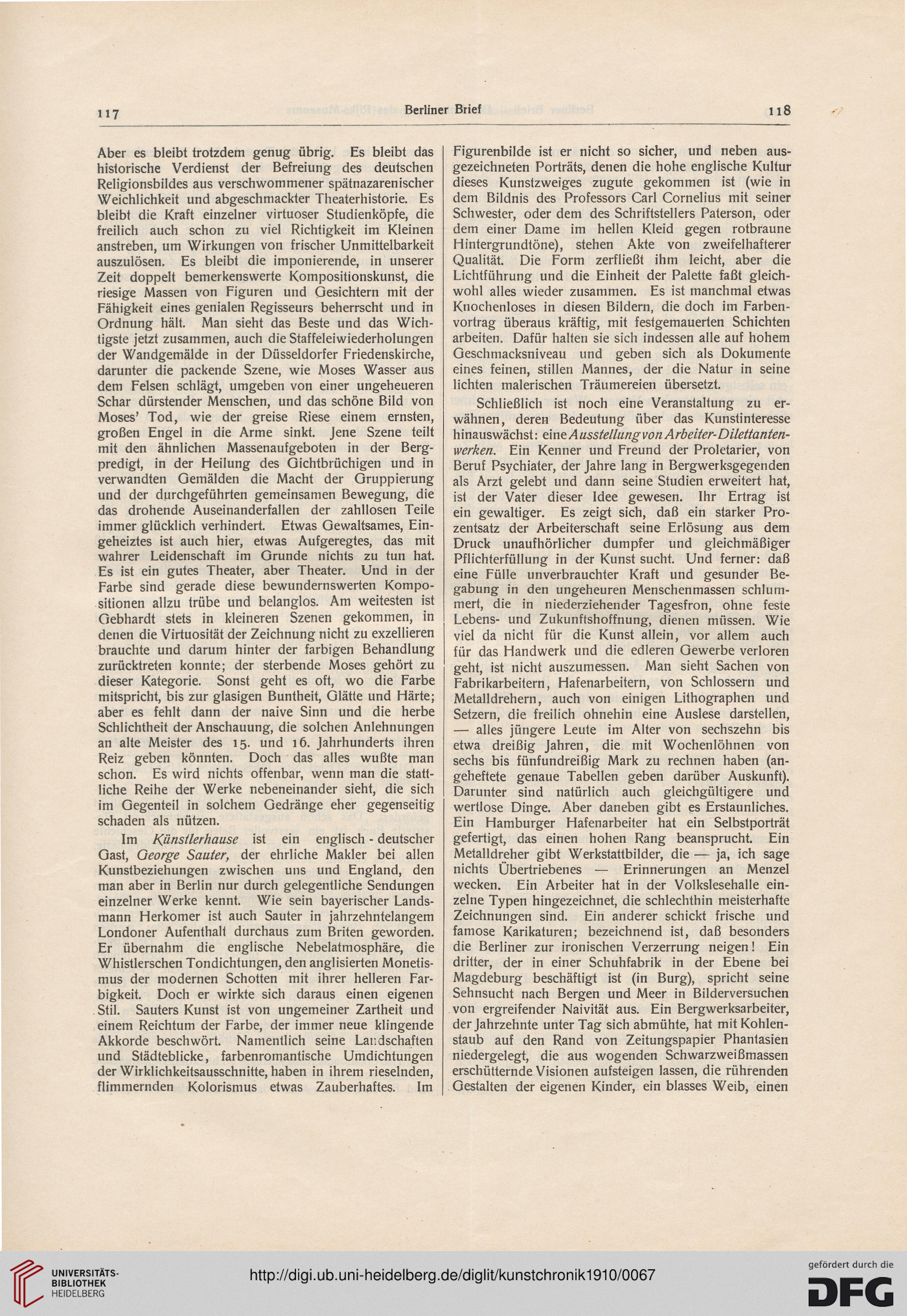117
Berliner Brief
118
Aber es bleibt trotzdem genug übrig. Es bleibt das
historische Verdienst der Befreiung des deutschen
Religionsbildes aus verschwommener spätnazarenischer
Weichlichkeit und abgeschmackter Theaterhistorie. Es
bleibt die Kraft einzelner virtuoser Studienköpfe, die
freilich auch schon zu viel Richtigkeit im Kleinen
anstreben, um Wirkungen von frischer Unmittelbarkeit
auszulösen. Es bleibt die imponierende, in unserer
Zeit doppelt bemerkenswerte Kompositionskunst, die
riesige Massen von Figuren und Gesichtern mit der
Fähigkeit eines genialen Regisseurs beherrscht und in
Ordnung hält. Man sieht das Beste und das Wich-
tigste jetzt zusammen, auch die Staffeleiwiederholungen
der Wandgemälde in der Düsseldorfer Friedenskirche,
darunter die packende Szene, wie Moses Wasser aus
dem Felsen schlägt, umgeben von einer ungeheueren
Schar dürstender Menschen, und das schöne Bild von
Moses' Tod, wie der greise Riese einem ernsten,
großen Engel in die Arme sinkt. Jene Szene teilt
mit den ähnlichen Massenaufgeboten in der Berg-
predigt, in der Heilung des Gichtbrüchigen und in
verwandten Gemälden die Macht der Gruppierung
und der durchgeführten gemeinsamen Bewegung, die
das drohende Auseinanderfallen der zahllosen Teile
immer glücklich verhindert. Etwas Gewaltsames, Ein-
geheiztes ist auch hier, etwas Aufgeregtes, das mit
wahrer Leidenschaft im Grunde nichts zu tun hat.
Es ist ein gutes Theater, aber Theater. Und in der
Farbe sind gerade diese bewundernswerten Kompo-
sitionen allzu trübe und belanglos. Am weitesten ist
Gebhardt stets in kleineren Szenen gekommen, in
denen die Virtuosität der Zeichnung nicht zu exzellieren
brauchte und darum hinter der farbigen Behandlung
zurücktreten konnte; der sterbende Moses gehört zu
dieser Kategorie. Sonst geht es oft, wo die Farbe
mitspricht, bis zur glasigen Buntheit, Glätte und Härte;
aber es fehlt dann der naive Sinn und die herbe
Schlichtheit der Anschauung, die solchen Anlehnungen
an alte Meister des 15. und 16. Jahrhunderts ihren
Reiz geben könnten. Doch das alles wußte man
schon. Es wird nichts offenbar, wenn man die statt-
liche Reihe der Werke nebeneinander sieht, die sich
im Gegenteil in solchem Gedränge eher gegenseitig
schaden als nützen.
Im Künstlerhause ist ein englisch - deutscher
Gast, George Saater, der ehrliche Makler bei allen
Kunstbeziehungen zwischen uns und England, den
man aber in Berlin nur durch gelegentliche Sendungen
einzelner Werke kennt. Wie sein bayerischer Lands-
mann Herkomer ist auch Sauter in jahrzehntelangem
Londoner Aufenthalt durchaus zum Briten geworden.
Er übernahm die englische Nebelatmosphäre, die
Whistlerschen Tondichtungen, den anglisierten Monetis-
mus der modernen Schotten mit ihrer helleren Far-
bigkeit. Doch er wirkte sich daraus einen eigenen
Stil. Sauters Kunst ist von ungemeiner Zartheit und
einem Reichtum der Farbe, der immer neue klingende
Akkorde beschwört. Namentlich seine Landschaften
und Städteblicke, farbenromantische Umdichtungen
der Wirklichkeitsausschnitte, haben in ihrem rieselnden,
flimmernden Kolorismus etwas Zauberhaftes. Im
Figurenbilde ist er nicht so sicher, und neben aus-
gezeichneten Porträts, denen die hohe englische Kultur
dieses Kunstzweiges zugute gekommen ist (wie in
dem Bildnis des Professors Carl Cornelius mit seiner
Schwester, oder dem des Schriftstellers Paterson, oder
dem einer Dame im hellen Kleid gegen rotbraune
Hintergrundtöne), stehen Akte von zweifelhafterer
Qualität. Die Form zerfließt ihm leicht, aber die
Lichtführung und die Einheit der Palette faßt gleich-
wohl alles wieder zusammen. Es ist manchmal etwas
Knochenloses in diesen Bildern, die doch im Farben-
vortrag überaus kräftig, mit festgemauerten Schichten
arbeiten. Dafür halten sie sich indessen alle auf hohem
Geschmacksniveau und geben sich als Dokumente
eines feinen, stillen Mannes, der die Natur in seine
lichten malerischen Träumereien übersetzt.
Schließlich ist noch eine Veranstaltung zu er-
wähnen, deren Bedeutung über das Kunstinteresse
hinauswächst: eine A usstellang von Arbeiter-Dilettanten-
werken. Ein Kenner und Freund der Proletarier, von
Beruf Psychiater, der Jahre lang in Bergwerksgegenden
als Arzt gelebt und dann seine Studien erweitert hat,
ist der Vater dieser Idee gewesen. Ihr Ertrag ist
ein gewaltiger. Es zeigt sich, daß ein starker Pro-
zentsatz der Arbeiterschaft seine Erlösung aus dem
Druck unaufhörlicher dumpfer und gleichmäßiger
Pflichterfüllung in der Kunst sucht. Und ferner: daß
eine Fülle unverbrauchter Kraft und gesunder Be-
gabung in den ungeheuren Menschenmassen schlum-
mert, die in niederziehender Tagesfron, ohne feste
Lebens- und Zukunftshoffnung, dienen müssen. Wie
viel da nicht für die Kunst allein, vor allem auch
für das Handwerk und die edleren Gewerbe verloren
geht, ist nicht auszumessen. Man sieht Sachen von
Fabrikarbeitern, Hafenarbeitern, von Schlossern und
Metalldrehern, auch von einigen Lithographen und
Setzern, die freilich ohnehin eine Auslese darstellen,
— alles jüngere Leute im Alter von sechszehn bis
etwa dreißig Jahren, die mit Wochenlöhnen von
sechs bis fünfundreißig Mark zu rechnen haben (an-
geheftete genaue Tabellen geben darüber Auskunft).
Darunter sind natürlich auch gleichgültigere und
wertlose Dinge. Aber daneben gibt es Erstaunliches.
Ein Hamburger Hafenarbeiter hat ein Selbstporträt
gefertigt, das einen hohen Rang beansprucht. Ein
Metalldreher gibt Werkstattbilder, die — ja, ich sage
nichts Übertriebenes — Erinnerungen an Menzel
wecken. Ein Arbeiter hat in der Volkslesehalle ein-
zelne Typen hingezeichnet, die schlechthin meisterhafte
Zeichnungen sind. Ein anderer schickt frische und
famose Karikaturen; bezeichnend ist, daß besonders
die Berliner zur ironischen Verzerrung neigen! Ein
dritter, der in einer Schuhfabrik in der Ebene bei
Magdeburg beschäftigt ist (in Burg), spricht seine
Sehnsucht nach Bergen und Meer in Bilderversuchen
von ergreifender Naivität aus. Ein Bergwerksarbeiter,
der Jahrzehnte unter Tag sich abmühte, hat mit Kohlen-
staub auf den Rand von Zeitungspapier Phantasien
niedergelegt, die aus wogenden Schwarzweißmassen
erschütternde Visionen aufsteigen lassen, die rührenden
Gestalten der eigenen Kinder, ein blasses Weib, einen
Berliner Brief
118
Aber es bleibt trotzdem genug übrig. Es bleibt das
historische Verdienst der Befreiung des deutschen
Religionsbildes aus verschwommener spätnazarenischer
Weichlichkeit und abgeschmackter Theaterhistorie. Es
bleibt die Kraft einzelner virtuoser Studienköpfe, die
freilich auch schon zu viel Richtigkeit im Kleinen
anstreben, um Wirkungen von frischer Unmittelbarkeit
auszulösen. Es bleibt die imponierende, in unserer
Zeit doppelt bemerkenswerte Kompositionskunst, die
riesige Massen von Figuren und Gesichtern mit der
Fähigkeit eines genialen Regisseurs beherrscht und in
Ordnung hält. Man sieht das Beste und das Wich-
tigste jetzt zusammen, auch die Staffeleiwiederholungen
der Wandgemälde in der Düsseldorfer Friedenskirche,
darunter die packende Szene, wie Moses Wasser aus
dem Felsen schlägt, umgeben von einer ungeheueren
Schar dürstender Menschen, und das schöne Bild von
Moses' Tod, wie der greise Riese einem ernsten,
großen Engel in die Arme sinkt. Jene Szene teilt
mit den ähnlichen Massenaufgeboten in der Berg-
predigt, in der Heilung des Gichtbrüchigen und in
verwandten Gemälden die Macht der Gruppierung
und der durchgeführten gemeinsamen Bewegung, die
das drohende Auseinanderfallen der zahllosen Teile
immer glücklich verhindert. Etwas Gewaltsames, Ein-
geheiztes ist auch hier, etwas Aufgeregtes, das mit
wahrer Leidenschaft im Grunde nichts zu tun hat.
Es ist ein gutes Theater, aber Theater. Und in der
Farbe sind gerade diese bewundernswerten Kompo-
sitionen allzu trübe und belanglos. Am weitesten ist
Gebhardt stets in kleineren Szenen gekommen, in
denen die Virtuosität der Zeichnung nicht zu exzellieren
brauchte und darum hinter der farbigen Behandlung
zurücktreten konnte; der sterbende Moses gehört zu
dieser Kategorie. Sonst geht es oft, wo die Farbe
mitspricht, bis zur glasigen Buntheit, Glätte und Härte;
aber es fehlt dann der naive Sinn und die herbe
Schlichtheit der Anschauung, die solchen Anlehnungen
an alte Meister des 15. und 16. Jahrhunderts ihren
Reiz geben könnten. Doch das alles wußte man
schon. Es wird nichts offenbar, wenn man die statt-
liche Reihe der Werke nebeneinander sieht, die sich
im Gegenteil in solchem Gedränge eher gegenseitig
schaden als nützen.
Im Künstlerhause ist ein englisch - deutscher
Gast, George Saater, der ehrliche Makler bei allen
Kunstbeziehungen zwischen uns und England, den
man aber in Berlin nur durch gelegentliche Sendungen
einzelner Werke kennt. Wie sein bayerischer Lands-
mann Herkomer ist auch Sauter in jahrzehntelangem
Londoner Aufenthalt durchaus zum Briten geworden.
Er übernahm die englische Nebelatmosphäre, die
Whistlerschen Tondichtungen, den anglisierten Monetis-
mus der modernen Schotten mit ihrer helleren Far-
bigkeit. Doch er wirkte sich daraus einen eigenen
Stil. Sauters Kunst ist von ungemeiner Zartheit und
einem Reichtum der Farbe, der immer neue klingende
Akkorde beschwört. Namentlich seine Landschaften
und Städteblicke, farbenromantische Umdichtungen
der Wirklichkeitsausschnitte, haben in ihrem rieselnden,
flimmernden Kolorismus etwas Zauberhaftes. Im
Figurenbilde ist er nicht so sicher, und neben aus-
gezeichneten Porträts, denen die hohe englische Kultur
dieses Kunstzweiges zugute gekommen ist (wie in
dem Bildnis des Professors Carl Cornelius mit seiner
Schwester, oder dem des Schriftstellers Paterson, oder
dem einer Dame im hellen Kleid gegen rotbraune
Hintergrundtöne), stehen Akte von zweifelhafterer
Qualität. Die Form zerfließt ihm leicht, aber die
Lichtführung und die Einheit der Palette faßt gleich-
wohl alles wieder zusammen. Es ist manchmal etwas
Knochenloses in diesen Bildern, die doch im Farben-
vortrag überaus kräftig, mit festgemauerten Schichten
arbeiten. Dafür halten sie sich indessen alle auf hohem
Geschmacksniveau und geben sich als Dokumente
eines feinen, stillen Mannes, der die Natur in seine
lichten malerischen Träumereien übersetzt.
Schließlich ist noch eine Veranstaltung zu er-
wähnen, deren Bedeutung über das Kunstinteresse
hinauswächst: eine A usstellang von Arbeiter-Dilettanten-
werken. Ein Kenner und Freund der Proletarier, von
Beruf Psychiater, der Jahre lang in Bergwerksgegenden
als Arzt gelebt und dann seine Studien erweitert hat,
ist der Vater dieser Idee gewesen. Ihr Ertrag ist
ein gewaltiger. Es zeigt sich, daß ein starker Pro-
zentsatz der Arbeiterschaft seine Erlösung aus dem
Druck unaufhörlicher dumpfer und gleichmäßiger
Pflichterfüllung in der Kunst sucht. Und ferner: daß
eine Fülle unverbrauchter Kraft und gesunder Be-
gabung in den ungeheuren Menschenmassen schlum-
mert, die in niederziehender Tagesfron, ohne feste
Lebens- und Zukunftshoffnung, dienen müssen. Wie
viel da nicht für die Kunst allein, vor allem auch
für das Handwerk und die edleren Gewerbe verloren
geht, ist nicht auszumessen. Man sieht Sachen von
Fabrikarbeitern, Hafenarbeitern, von Schlossern und
Metalldrehern, auch von einigen Lithographen und
Setzern, die freilich ohnehin eine Auslese darstellen,
— alles jüngere Leute im Alter von sechszehn bis
etwa dreißig Jahren, die mit Wochenlöhnen von
sechs bis fünfundreißig Mark zu rechnen haben (an-
geheftete genaue Tabellen geben darüber Auskunft).
Darunter sind natürlich auch gleichgültigere und
wertlose Dinge. Aber daneben gibt es Erstaunliches.
Ein Hamburger Hafenarbeiter hat ein Selbstporträt
gefertigt, das einen hohen Rang beansprucht. Ein
Metalldreher gibt Werkstattbilder, die — ja, ich sage
nichts Übertriebenes — Erinnerungen an Menzel
wecken. Ein Arbeiter hat in der Volkslesehalle ein-
zelne Typen hingezeichnet, die schlechthin meisterhafte
Zeichnungen sind. Ein anderer schickt frische und
famose Karikaturen; bezeichnend ist, daß besonders
die Berliner zur ironischen Verzerrung neigen! Ein
dritter, der in einer Schuhfabrik in der Ebene bei
Magdeburg beschäftigt ist (in Burg), spricht seine
Sehnsucht nach Bergen und Meer in Bilderversuchen
von ergreifender Naivität aus. Ein Bergwerksarbeiter,
der Jahrzehnte unter Tag sich abmühte, hat mit Kohlen-
staub auf den Rand von Zeitungspapier Phantasien
niedergelegt, die aus wogenden Schwarzweißmassen
erschütternde Visionen aufsteigen lassen, die rührenden
Gestalten der eigenen Kinder, ein blasses Weib, einen