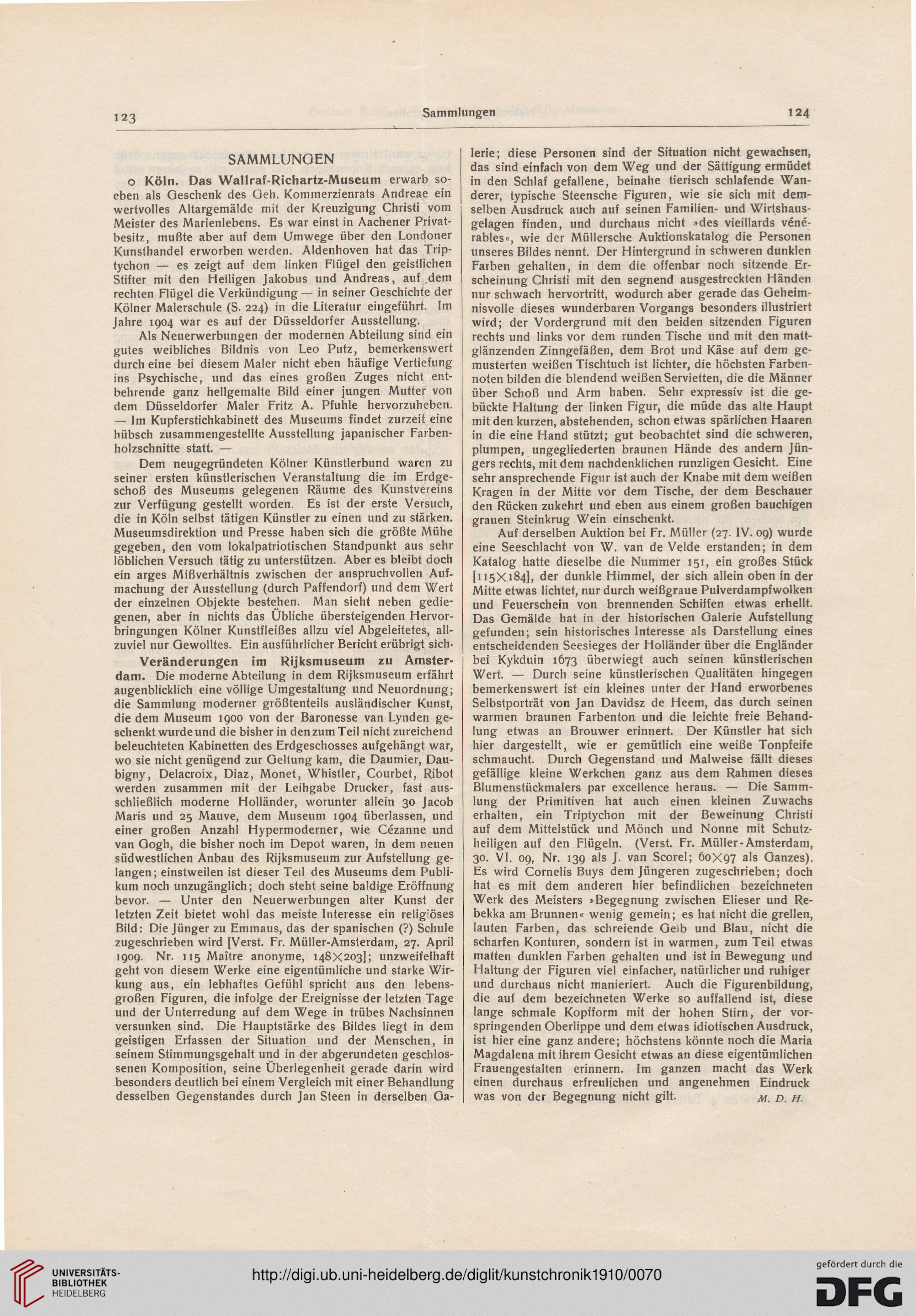123
Sammlungen
124
SAMMLUNGEN
o Köln. Das Wallraf-Richartz-Museum erwarb so-
eben als Geschenk des Oeh. Kommerzienrats Andreae ein
wertvolles Altargemälde mit der Kreuzigung Christi vom
Meister des Marienlebens. Es war einst in Aachener Privat-
besitz, mußte aber auf dem Umwege über den Londoner
Kunsthandel erworben werden. Aldenhoven hat das Trip-
tychon — es zeigt auf dem linken Flügel den geistlichen
Stifter mit den Heiligen Jakobus und Andreas, auf dem
rechten Flügel die Verkündigung— in seiner Geschichte der
Kölner Malerschule (S. 224) in die Literatur eingeführt. Im
Jahre 1904 war es auf der Düsseldorfer Ausstellung.
Als Neuerwerbungen der modernen Abteilung sind ein
gutes weibliches Bildnis von Leo Putz, bemerkenswert
durch eine bei diesem Maler nicht eben häufige Vertiefung
ins Psychische, und das eines großen Zuges nicht ent-
behrende ganz hellgemalte Bild einer jungen Mutter von
dem Düsseldorfer Maler Fritz A. Pfuhle hervorzuheben.
— Im Kupferstichkabinett des Museums findet zurzeit eine
hübsch zusammengestellte Ausstellung japanischer Farben-
holzschnitte statt. —
Dem neugegründeten Kölner Künstlerbund waren zu
seiner ersten künstlerischen Veranstaltung die im Erdge-
schoß des Museums gelegenen Räume des Kunstvereins
zur Verfügung gestellt worden. Es ist der erste Versuch,
die in Köln selbst tätigen Künstler zu einen und zu stärken.
Museumsdirektion und Presse haben sich die größte Mühe
gegeben, den vom lokalpatriotischen Standpunkt aus sehr
löblichen Versuch tätig zu unterstützen. Aber es bleibt doch
ein arges Mißverhältnis zwischen der anspruchvollen Auf-
machung der Ausstellung (durch Paffendorf) und dem Wert
der einzelnen Objekte bestehen. Man sieht neben gedie-
genen, aber in nichts das Übliche übersteigenden Hervor-
bringungen Kölner Kunstfleißes allzu viel Abgeleitetes, all-
zuviel nur Gewolltes. Ein ausführlicher Bericht erübrigt sich-
Veränderungen im Rijksmuseum zu Amster-
dam. Die moderne Abteilung in dem Rijksmuseum erfährt
augenblicklich eine völlige Umgestaltung und Neuordnung;
die Sammlung moderner größtenteils ausländischer Kunst,
die dem Museum 1900 von der Baronesse van Lynden ge-
schenkt wurde und die bisher in den zum Teil nicht zureichend
beleuchteten Kabinetten des Erdgeschosses aufgehängt war,
wo sie nicht genügend zur Geltung kam, die Daumier, Dau-
bigny, Delacroix, Diaz, Monet, Whistler, Courbet, Ribot
werden zusammen mit der Leihgabe Drucker, fast aus-
schließlich moderne Holländer, worunter allein 30 Jacob
Maris und 25 Mauve, dem Museum 1904 überlassen, und
einer großen Anzahl Hypermoderner, wie Cezanne und
van Gogh, die bisher noch im Depot waren, in dem neuen
südwestlichen Anbau des Rijksmuseum zur Aufstellung ge-
langen; einstweilen ist dieser Teil des Museums dem Publi-
kum noch unzugänglich; doch steht seine baldige Eröffnung
bevor. — Unter den Neuerwerbungen alter Kunst der
letzten Zeit bietet wohl das meiste Interesse ein religiöses
Bild: Die Jünger zu Emmaus, das der spanischen (?) Schule
zugeschrieben wird [Verst. Fr. Müller-Amsterdam, 27. April
1909. Nr. iisMaitre anonyme, 148X203]; unzweifelhaft
geht von diesem Werke eine eigentümliche und starke Wir-
kung aus, ein lebhaftes Gefühl spricht aus den lebens-
großen Figuren, die infolge der Ereignisse der letzten Tage
und der Unterredung auf dem Wege in trübes Nachsinnen
versunken sind. Die Hauptstärke des Bildes liegt in dem
geistigen Erfassen der Situation und der Menschen, in
seinem Stimmungsgehalt und in der abgerundeten geschlos-
senen Komposition, seine Überlegenheit gerade darin wird
besonders deutlich bei einem Vergleich mit einer Behandlung
desselben Gegenstandes durch Jan Steen in derselben Ga-
lerie; diese Personen sind der Situation nicht gewachsen,
das sind einfach von dem Weg und der Sättigung ermüdet
in den Schlaf gefallene, beinahe tierisch schlafende Wan-
derer, typische Steensche Figuren, wie sie sich mit dem-
selben Ausdruck auch auf seinen Familien- und Wirtshaus-
gelagen finden, und durchaus nicht »des vieillards v6ne-
rables«, wie der Müllersche Auktionskatalog die Personen
unseres Bildes nennt. Der Hintergrund in schweren dunklen
Farben gehalten, in dem die offenbar noch sitzende Er-
scheinung Christi mit den segnend ausgestreckten Händen
nur schwach hervortritt, wodurch aber gerade das Geheim-
nisvolle dieses wunderbaren Vorgangs besonders illustriert
wird; der Vordergrund mit den beiden sitzenden Figuren
rechts und links vor dem runden Tische und mit den matt-
glänzenden Zinngefäßen, dem Brot und Käse auf dem ge-
musterten weißen Tischtuch ist lichter, die höchsten Farben-
noten bilden die blendend weißen Servietten, die die Männer
über Schoß und Arm haben. Sehr expressiv ist die ge-
bückte Haltung der linken Figur, die müde das alte Haupt
mit den kurzen, abstehenden, schon etwas spärlichen Haaren
in die eine Hand stützt; gut beobachtet sind die schweren,
plumpen, ungegliederten braunen Hände des andern Jün-
gers rechts, mit dem nachdenklichen runzligen Gesicht. Eine
sehr ansprechende Figur ist auch der Knabe mit dem weißen
Kragen in der Mitte vor dem Tische, der dem Beschauer
den Rücken zukehrt und eben aus einem großen bauchigen
grauen Steinkrug Wein einschenkt.
Auf derselben Auktion bei Fr. Müller (27. IV. 09) wurde
eine Seeschlacht von W. van de Velde erstanden; in dem
Katalog hatte dieselbe die Nummer 151, ein großes Stück
[115X184], der dunkle Himmel, der sich allein oben in der
Mitte etwas lichtet, nur durch weißgraue Pulverdampfwolken
und Feuerschein von brennenden Schiffen etwas erhellt.
Das Gemälde hat in der historischen Galerie Aufstellung
gefunden; sein historisches Interesse als Darstellung eines
entscheidenden Seesieges der Holländer über die Engländer
bei Kykduin 1673 überwiegt auch seinen künstlerischen
Wert. — Durch seine künstlerischen Qualitäten hingegen
bemerkenswert ist ein kleines unter der Hand erworbenes
Selbstporträt von Jan Davidsz de Heem, das durch seinen
warmen braunen Farbenton und die leichte freie Behand-
lung etwas an Brouwer erinnert. Der Künstler hat sich
hier dargestellt, wie er gemütlich eine weiße Tonpfeife
schmaucht. Durch Gegenstand und Malweise fällt dieses
gefällige kleine Werkchen ganz aus dem Rahmen dieses
Blumenstückmalers par excellence heraus. — Die Samm-
lung der Primitiven hat auch einen kleinen Zuwachs
erhalten, ein Triptychon mit der Beweinung Christi
auf dem Mittelstück und Mönch und Nonne mit Schutz-
heiligen auf den Flügeln. (Verst. Fr. Müller-Amsterdam,
30. VI. 09, Nr. 139 als J. van Scorel; 60X97 als Ganzes).
Es wird Cornelis Buys dem Jüngeren zugeschrieben; doch
hat es mit dem anderen hier befindlichen bezeichneten
Werk des Meisters »Begegnung zwischen Elieser und Re-
bekka am Brunnen« wenig gemein; es hat nicht die grellen,
lauten Farben, das schreiende Gelb und Blau, nicht die
scharfen Konturen, sondern ist in warmen, zum Teil etwas
matten dunklen Farben gehalten und ist in Bewegung und
Haltung der Figuren viel einfacher, natürlicher und ruhiger
und durchaus nicht manieriert. Auch die Figurenbildung,
die auf dem bezeichneten Werke so auffallend ist, diese
lange schmale Kopfform mit der hohen Stirn, der vor-
springenden Oberlippe und dem etwas idiotischen Ausdruck,
ist hier eine ganz andere; höchstens könnte noch die Maria
Magdalena mit ihrem Gesicht etwas an diese eigentümlichen
Frauengestalten erinnern. Im ganzen macht das Werk
einen durchaus erfreulichen und angenehmen Eindruck
was von der Begegnung nicht gilt. m. d. h.
Sammlungen
124
SAMMLUNGEN
o Köln. Das Wallraf-Richartz-Museum erwarb so-
eben als Geschenk des Oeh. Kommerzienrats Andreae ein
wertvolles Altargemälde mit der Kreuzigung Christi vom
Meister des Marienlebens. Es war einst in Aachener Privat-
besitz, mußte aber auf dem Umwege über den Londoner
Kunsthandel erworben werden. Aldenhoven hat das Trip-
tychon — es zeigt auf dem linken Flügel den geistlichen
Stifter mit den Heiligen Jakobus und Andreas, auf dem
rechten Flügel die Verkündigung— in seiner Geschichte der
Kölner Malerschule (S. 224) in die Literatur eingeführt. Im
Jahre 1904 war es auf der Düsseldorfer Ausstellung.
Als Neuerwerbungen der modernen Abteilung sind ein
gutes weibliches Bildnis von Leo Putz, bemerkenswert
durch eine bei diesem Maler nicht eben häufige Vertiefung
ins Psychische, und das eines großen Zuges nicht ent-
behrende ganz hellgemalte Bild einer jungen Mutter von
dem Düsseldorfer Maler Fritz A. Pfuhle hervorzuheben.
— Im Kupferstichkabinett des Museums findet zurzeit eine
hübsch zusammengestellte Ausstellung japanischer Farben-
holzschnitte statt. —
Dem neugegründeten Kölner Künstlerbund waren zu
seiner ersten künstlerischen Veranstaltung die im Erdge-
schoß des Museums gelegenen Räume des Kunstvereins
zur Verfügung gestellt worden. Es ist der erste Versuch,
die in Köln selbst tätigen Künstler zu einen und zu stärken.
Museumsdirektion und Presse haben sich die größte Mühe
gegeben, den vom lokalpatriotischen Standpunkt aus sehr
löblichen Versuch tätig zu unterstützen. Aber es bleibt doch
ein arges Mißverhältnis zwischen der anspruchvollen Auf-
machung der Ausstellung (durch Paffendorf) und dem Wert
der einzelnen Objekte bestehen. Man sieht neben gedie-
genen, aber in nichts das Übliche übersteigenden Hervor-
bringungen Kölner Kunstfleißes allzu viel Abgeleitetes, all-
zuviel nur Gewolltes. Ein ausführlicher Bericht erübrigt sich-
Veränderungen im Rijksmuseum zu Amster-
dam. Die moderne Abteilung in dem Rijksmuseum erfährt
augenblicklich eine völlige Umgestaltung und Neuordnung;
die Sammlung moderner größtenteils ausländischer Kunst,
die dem Museum 1900 von der Baronesse van Lynden ge-
schenkt wurde und die bisher in den zum Teil nicht zureichend
beleuchteten Kabinetten des Erdgeschosses aufgehängt war,
wo sie nicht genügend zur Geltung kam, die Daumier, Dau-
bigny, Delacroix, Diaz, Monet, Whistler, Courbet, Ribot
werden zusammen mit der Leihgabe Drucker, fast aus-
schließlich moderne Holländer, worunter allein 30 Jacob
Maris und 25 Mauve, dem Museum 1904 überlassen, und
einer großen Anzahl Hypermoderner, wie Cezanne und
van Gogh, die bisher noch im Depot waren, in dem neuen
südwestlichen Anbau des Rijksmuseum zur Aufstellung ge-
langen; einstweilen ist dieser Teil des Museums dem Publi-
kum noch unzugänglich; doch steht seine baldige Eröffnung
bevor. — Unter den Neuerwerbungen alter Kunst der
letzten Zeit bietet wohl das meiste Interesse ein religiöses
Bild: Die Jünger zu Emmaus, das der spanischen (?) Schule
zugeschrieben wird [Verst. Fr. Müller-Amsterdam, 27. April
1909. Nr. iisMaitre anonyme, 148X203]; unzweifelhaft
geht von diesem Werke eine eigentümliche und starke Wir-
kung aus, ein lebhaftes Gefühl spricht aus den lebens-
großen Figuren, die infolge der Ereignisse der letzten Tage
und der Unterredung auf dem Wege in trübes Nachsinnen
versunken sind. Die Hauptstärke des Bildes liegt in dem
geistigen Erfassen der Situation und der Menschen, in
seinem Stimmungsgehalt und in der abgerundeten geschlos-
senen Komposition, seine Überlegenheit gerade darin wird
besonders deutlich bei einem Vergleich mit einer Behandlung
desselben Gegenstandes durch Jan Steen in derselben Ga-
lerie; diese Personen sind der Situation nicht gewachsen,
das sind einfach von dem Weg und der Sättigung ermüdet
in den Schlaf gefallene, beinahe tierisch schlafende Wan-
derer, typische Steensche Figuren, wie sie sich mit dem-
selben Ausdruck auch auf seinen Familien- und Wirtshaus-
gelagen finden, und durchaus nicht »des vieillards v6ne-
rables«, wie der Müllersche Auktionskatalog die Personen
unseres Bildes nennt. Der Hintergrund in schweren dunklen
Farben gehalten, in dem die offenbar noch sitzende Er-
scheinung Christi mit den segnend ausgestreckten Händen
nur schwach hervortritt, wodurch aber gerade das Geheim-
nisvolle dieses wunderbaren Vorgangs besonders illustriert
wird; der Vordergrund mit den beiden sitzenden Figuren
rechts und links vor dem runden Tische und mit den matt-
glänzenden Zinngefäßen, dem Brot und Käse auf dem ge-
musterten weißen Tischtuch ist lichter, die höchsten Farben-
noten bilden die blendend weißen Servietten, die die Männer
über Schoß und Arm haben. Sehr expressiv ist die ge-
bückte Haltung der linken Figur, die müde das alte Haupt
mit den kurzen, abstehenden, schon etwas spärlichen Haaren
in die eine Hand stützt; gut beobachtet sind die schweren,
plumpen, ungegliederten braunen Hände des andern Jün-
gers rechts, mit dem nachdenklichen runzligen Gesicht. Eine
sehr ansprechende Figur ist auch der Knabe mit dem weißen
Kragen in der Mitte vor dem Tische, der dem Beschauer
den Rücken zukehrt und eben aus einem großen bauchigen
grauen Steinkrug Wein einschenkt.
Auf derselben Auktion bei Fr. Müller (27. IV. 09) wurde
eine Seeschlacht von W. van de Velde erstanden; in dem
Katalog hatte dieselbe die Nummer 151, ein großes Stück
[115X184], der dunkle Himmel, der sich allein oben in der
Mitte etwas lichtet, nur durch weißgraue Pulverdampfwolken
und Feuerschein von brennenden Schiffen etwas erhellt.
Das Gemälde hat in der historischen Galerie Aufstellung
gefunden; sein historisches Interesse als Darstellung eines
entscheidenden Seesieges der Holländer über die Engländer
bei Kykduin 1673 überwiegt auch seinen künstlerischen
Wert. — Durch seine künstlerischen Qualitäten hingegen
bemerkenswert ist ein kleines unter der Hand erworbenes
Selbstporträt von Jan Davidsz de Heem, das durch seinen
warmen braunen Farbenton und die leichte freie Behand-
lung etwas an Brouwer erinnert. Der Künstler hat sich
hier dargestellt, wie er gemütlich eine weiße Tonpfeife
schmaucht. Durch Gegenstand und Malweise fällt dieses
gefällige kleine Werkchen ganz aus dem Rahmen dieses
Blumenstückmalers par excellence heraus. — Die Samm-
lung der Primitiven hat auch einen kleinen Zuwachs
erhalten, ein Triptychon mit der Beweinung Christi
auf dem Mittelstück und Mönch und Nonne mit Schutz-
heiligen auf den Flügeln. (Verst. Fr. Müller-Amsterdam,
30. VI. 09, Nr. 139 als J. van Scorel; 60X97 als Ganzes).
Es wird Cornelis Buys dem Jüngeren zugeschrieben; doch
hat es mit dem anderen hier befindlichen bezeichneten
Werk des Meisters »Begegnung zwischen Elieser und Re-
bekka am Brunnen« wenig gemein; es hat nicht die grellen,
lauten Farben, das schreiende Gelb und Blau, nicht die
scharfen Konturen, sondern ist in warmen, zum Teil etwas
matten dunklen Farben gehalten und ist in Bewegung und
Haltung der Figuren viel einfacher, natürlicher und ruhiger
und durchaus nicht manieriert. Auch die Figurenbildung,
die auf dem bezeichneten Werke so auffallend ist, diese
lange schmale Kopfform mit der hohen Stirn, der vor-
springenden Oberlippe und dem etwas idiotischen Ausdruck,
ist hier eine ganz andere; höchstens könnte noch die Maria
Magdalena mit ihrem Gesicht etwas an diese eigentümlichen
Frauengestalten erinnern. Im ganzen macht das Werk
einen durchaus erfreulichen und angenehmen Eindruck
was von der Begegnung nicht gilt. m. d. h.