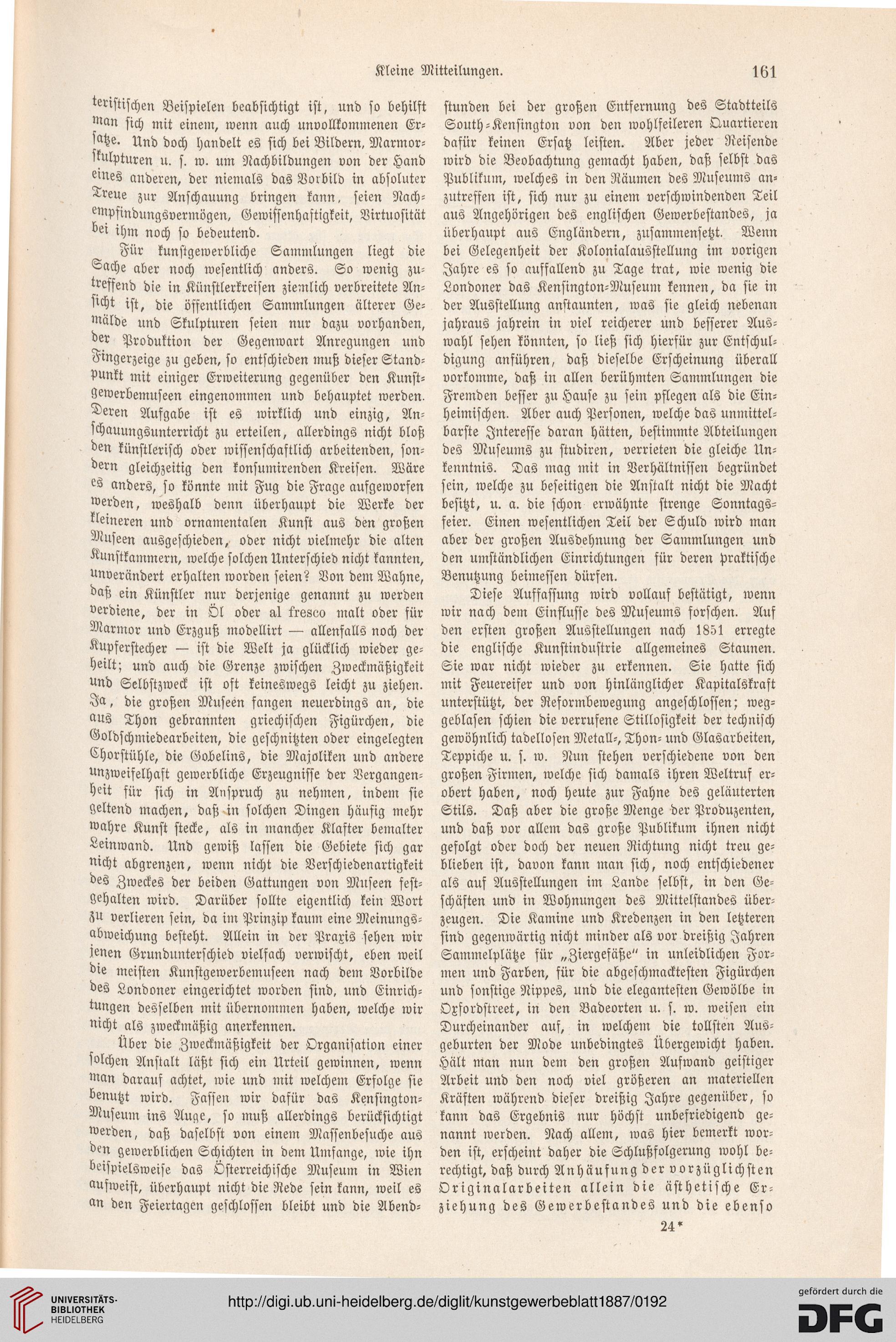Kleine Mitteilungen.
181
ieristischen Beispielen beabsichtigt ist, und so behilft
">an sich niit einem, wenn auch unvollkommenen Er-
^atze. Und doch handelt es sich bei Bildern, Marmor-
Üulpturen u. s. w. um Nachbildungen von der Hand
eines anderen, der niemals das Vorbild in absoluter
Treue zur Anschauung bringen kann, seien Nach-
rnipfindungsvermögsn, Gewissenhaftigkeit, Virtuosität
^ai ihm noch so bedeutend.
Für kunstgewsrbliche Sammlungen liegt die
Sache aber noch wesentlich anders. So wenig zu-
treffend die in Künstlerkreisen ziemlich vsrbreitete An-
licht ist, die öffentlichen Sammlungen älterer Ge-
»rälde und Skulpturen seien nur dazu vorhanden,
i>er Produktion der Gegenwart Anregungen und
Fingerzsige zu geben, so entschieden muß dieser Stand-
Punkt mit einiger Erweiterung gegenüber den Kunst-
gewerbemuseen eingenommen und behauptet werden.
Deren Aufgabe ist es wirklich und einzig, An-
lchauungsunterricht zu erteilen, allerdings nicht bloß
den künstlerisch oder wissenschastlich arbeitenden, son-
dern gleichzeitig den konsumirenden Kreisen. Wäre
anders, so könnte mit Fug die Frage aufgeworfen
werdsn, weshalb denn überhaupt die Werke der
kleineren und ornamentalen Kunst aus den großen
Museen ausgeschieden, oder nicht vielmehr die alten
Kunstkammern, welche solchen Unterschied nicht kannten,
unverändert erhalten worden seien? Von dem Wahne,
daß ein Künstler nur derjenigs genannt zu werden
verdiene, der in Öl oder al trssoo malt oder für
Marmor und Erzguß modellirt — allenfalls noch der
Kupferstecher — ist die Welt ja glücklich wieder ge-
heilt; und auch die Grenze zwischen Zweckmäßigksit
und Selbstzweck ist oft ksinsswsgs lsicht zu ziehen.
Ja, die großen Museen fangen neuerdings an, die
aus Thon gebranntsn griechischen Figürchen, die
Goldschmiedearbeiten, die geschnitzten oder eingelegten
Chorstühle, die Gobelins, die Majoliken und andere
unzweifelhaft gewerbliche Erzeugnisse der Vergangen-
heit sür sich in Anspruch zu nehmen, indem sie
geltend machen, daß -in solchen Dingen häufig mehr
wahre Kunst stecks, als in mancher Klafter bemalter
Leinwand. Und gewiß lassen die Gebiete stch gar
nicht abgrenzen, wenn nicht dis Verschisdenartigkeit
bes Zweckes der beiden Gattungen von Museen sest-
gehalten wird. Darüber sollte eigentlich kein Wort
zu verlieren sein, da im Prinzip kaum eine Msinungs-
abweichung besteht. Allein in der Praxis sshen wir
jenen Grundunterschied vielfach verwischt, eben weil
die meisten Kunstgewerbemuseen nach dem Vorbilde
des Londoner eingerichtet worden sind, und Einrich-
tungen desselben mit übernommen haben, welche wir
Nicht als zweckmäßig anerkennen.
Über die Zweckmäßigkeit der Organisation einer
solchen Anstalt läßt sich ein Urteil gewinnen, wenn
wan darauf achtet, wie und mit welchem Erfolge sie
benutzt wird. Fassen wir dafür das Kensmgton-
Museum ins Auge, so muß allsrdings berücksichtigt
werden, daß daselbst von einem Massenbesuche aus
den gswerblichen Schichten in dem Umfange, wie ihn
beispislsweise das Österreichische Museum in Wien
ausweist, überhaupt nicht die Rede sein kann, weil es
an den Feiertagen geschlossen bleibt und die Abend-
stunden bei der großen Entfernung des Stadtteils
South-Kensington von den wohlfeileren Quartieren
dafür keinen Ersatz leisten. Aber jeder Reisende
wird die Beobachtung gemacht haben, daß selbst das
Publikum, welches in den Räumen des Museums an-
zutreffen ist, sich nur zu einem verschwindenden Teil
aus Angehörigen des englischen Gewerbestandes, ja
überhaupt aus Engländsrn, zusammensetzt. Wenn
bei Gelegenheit der Kolonialausstellung im vorigen
Jahre es so auffallend zu Tage trat, wie wenig die
Londoner das Kensington-Museum kennen, da ste in
der Ausstellung anstaunten, was sie gleich nebenan
jahraus jahrein in viel reicherer und besserer Aus-
wahl sehen könnten, so ließ sich hierfür zur Entschul-
digung anführen, daß dieselbe Erscheinung überall
vorkomme, daß in allen berühmten Sammlungsn die
Fremdsn besser zu Hause zu sein pflegen als die Ein-
heimischen. Aber auch Personen, welche das unmittel-
barste Jnteresse daran hätten, bestimmte Abteilungen
des Museums zu studiren, verrieten die gleiche Un-
kenntnis. Das mag mit in Verhältnissen begrllndet
sein, welche zu beseitigen dis Anstalt nicht die Macht
besitzt, u. a. die schon erwähnte strenge Sonntags-
feier. Einen wesentlichen Teil der Schuld wird man
aber dsr großen Ausdehnung der Sammlungen und
dsn umständlichen Einrichtungen für deren praktische
Benutzung beimessen dürsen.
Diese Auffassung wird vollauf bestätigt, wenn
wir nach dem Einflusse des Museums forschen. Auf
den ersten großen Ausstellungen nach 1851 erregte
die englische Kunstindustrie allgemeines Staunen.
Sie war nicht wieder zu erkennen. Sie hatte sich
mit Feuereifer und von hinlänglicher Kapitalskraft
untsrstützt, der Reformbewegung angeschlossen; weg-
geblasen schien die verrufsns Stillosigkeit der technisch
gewöhnlich tadellosen Metall-, Thon- und Glasarbeiten,
Teppiche u. s. w. Nun stehen verschiedene von den
grotzen Firmen, welche sich damals ihren Weltrus er-
obert haben, noch heuts zur Fahne des geläuterten
Stils. Daß aber die große Menge der Produzenten,
und daß vor allem das große Publikum ihnen nicht
gefolgt oder doch der neuen Richtung nicht treu ge-
blisben ist, davon kann man sich, noch entschiedener
als auf Ausstellungen im Lande selbst, in den Ge-
schäften und in Wohnungen des Mittelstandes über-
zeugen. Die Kamine und Kredenzen in den letzteren
sind gegsnwärtig nicht minder als vor dreißig Jahren
Sammelplütze sür „Ziergefäße" in unleidlichen For-
men und Farben, für die abgeschmacktesten Figürchen
und sonstige Nippss, und die elegantesten Gewölbe in
Oxfordstreet, in den Badeorten u. s. w. weisen ein
Durcheinander aust in welchem die tollstsn Aus-
geburten der Mode unbedingtes Übergewicht haben.
Hält man nun dem den großen Aufwand geistiger
Arbsit und den noch vtel größeren an materiellen
Kräften während dieser dreißig Jahre gegenüber, so
kann das Ergebnis nur höchst unbefriedigend ge-
nannt werden. Nach allem, was hier bemerkt wor-
den ist, erscheint daher die Schlußfolgerung wohl bs-
rechtigt, daß durch Anhäufung der vorzüglichsten
Originalarbeiten allein die ästhetische Er-
ziehung des Gewerbestandes und die ebenso
24'
181
ieristischen Beispielen beabsichtigt ist, und so behilft
">an sich niit einem, wenn auch unvollkommenen Er-
^atze. Und doch handelt es sich bei Bildern, Marmor-
Üulpturen u. s. w. um Nachbildungen von der Hand
eines anderen, der niemals das Vorbild in absoluter
Treue zur Anschauung bringen kann, seien Nach-
rnipfindungsvermögsn, Gewissenhaftigkeit, Virtuosität
^ai ihm noch so bedeutend.
Für kunstgewsrbliche Sammlungen liegt die
Sache aber noch wesentlich anders. So wenig zu-
treffend die in Künstlerkreisen ziemlich vsrbreitete An-
licht ist, die öffentlichen Sammlungen älterer Ge-
»rälde und Skulpturen seien nur dazu vorhanden,
i>er Produktion der Gegenwart Anregungen und
Fingerzsige zu geben, so entschieden muß dieser Stand-
Punkt mit einiger Erweiterung gegenüber den Kunst-
gewerbemuseen eingenommen und behauptet werden.
Deren Aufgabe ist es wirklich und einzig, An-
lchauungsunterricht zu erteilen, allerdings nicht bloß
den künstlerisch oder wissenschastlich arbeitenden, son-
dern gleichzeitig den konsumirenden Kreisen. Wäre
anders, so könnte mit Fug die Frage aufgeworfen
werdsn, weshalb denn überhaupt die Werke der
kleineren und ornamentalen Kunst aus den großen
Museen ausgeschieden, oder nicht vielmehr die alten
Kunstkammern, welche solchen Unterschied nicht kannten,
unverändert erhalten worden seien? Von dem Wahne,
daß ein Künstler nur derjenigs genannt zu werden
verdiene, der in Öl oder al trssoo malt oder für
Marmor und Erzguß modellirt — allenfalls noch der
Kupferstecher — ist die Welt ja glücklich wieder ge-
heilt; und auch die Grenze zwischen Zweckmäßigksit
und Selbstzweck ist oft ksinsswsgs lsicht zu ziehen.
Ja, die großen Museen fangen neuerdings an, die
aus Thon gebranntsn griechischen Figürchen, die
Goldschmiedearbeiten, die geschnitzten oder eingelegten
Chorstühle, die Gobelins, die Majoliken und andere
unzweifelhaft gewerbliche Erzeugnisse der Vergangen-
heit sür sich in Anspruch zu nehmen, indem sie
geltend machen, daß -in solchen Dingen häufig mehr
wahre Kunst stecks, als in mancher Klafter bemalter
Leinwand. Und gewiß lassen die Gebiete stch gar
nicht abgrenzen, wenn nicht dis Verschisdenartigkeit
bes Zweckes der beiden Gattungen von Museen sest-
gehalten wird. Darüber sollte eigentlich kein Wort
zu verlieren sein, da im Prinzip kaum eine Msinungs-
abweichung besteht. Allein in der Praxis sshen wir
jenen Grundunterschied vielfach verwischt, eben weil
die meisten Kunstgewerbemuseen nach dem Vorbilde
des Londoner eingerichtet worden sind, und Einrich-
tungen desselben mit übernommen haben, welche wir
Nicht als zweckmäßig anerkennen.
Über die Zweckmäßigkeit der Organisation einer
solchen Anstalt läßt sich ein Urteil gewinnen, wenn
wan darauf achtet, wie und mit welchem Erfolge sie
benutzt wird. Fassen wir dafür das Kensmgton-
Museum ins Auge, so muß allsrdings berücksichtigt
werden, daß daselbst von einem Massenbesuche aus
den gswerblichen Schichten in dem Umfange, wie ihn
beispislsweise das Österreichische Museum in Wien
ausweist, überhaupt nicht die Rede sein kann, weil es
an den Feiertagen geschlossen bleibt und die Abend-
stunden bei der großen Entfernung des Stadtteils
South-Kensington von den wohlfeileren Quartieren
dafür keinen Ersatz leisten. Aber jeder Reisende
wird die Beobachtung gemacht haben, daß selbst das
Publikum, welches in den Räumen des Museums an-
zutreffen ist, sich nur zu einem verschwindenden Teil
aus Angehörigen des englischen Gewerbestandes, ja
überhaupt aus Engländsrn, zusammensetzt. Wenn
bei Gelegenheit der Kolonialausstellung im vorigen
Jahre es so auffallend zu Tage trat, wie wenig die
Londoner das Kensington-Museum kennen, da ste in
der Ausstellung anstaunten, was sie gleich nebenan
jahraus jahrein in viel reicherer und besserer Aus-
wahl sehen könnten, so ließ sich hierfür zur Entschul-
digung anführen, daß dieselbe Erscheinung überall
vorkomme, daß in allen berühmten Sammlungsn die
Fremdsn besser zu Hause zu sein pflegen als die Ein-
heimischen. Aber auch Personen, welche das unmittel-
barste Jnteresse daran hätten, bestimmte Abteilungen
des Museums zu studiren, verrieten die gleiche Un-
kenntnis. Das mag mit in Verhältnissen begrllndet
sein, welche zu beseitigen dis Anstalt nicht die Macht
besitzt, u. a. die schon erwähnte strenge Sonntags-
feier. Einen wesentlichen Teil der Schuld wird man
aber dsr großen Ausdehnung der Sammlungen und
dsn umständlichen Einrichtungen für deren praktische
Benutzung beimessen dürsen.
Diese Auffassung wird vollauf bestätigt, wenn
wir nach dem Einflusse des Museums forschen. Auf
den ersten großen Ausstellungen nach 1851 erregte
die englische Kunstindustrie allgemeines Staunen.
Sie war nicht wieder zu erkennen. Sie hatte sich
mit Feuereifer und von hinlänglicher Kapitalskraft
untsrstützt, der Reformbewegung angeschlossen; weg-
geblasen schien die verrufsns Stillosigkeit der technisch
gewöhnlich tadellosen Metall-, Thon- und Glasarbeiten,
Teppiche u. s. w. Nun stehen verschiedene von den
grotzen Firmen, welche sich damals ihren Weltrus er-
obert haben, noch heuts zur Fahne des geläuterten
Stils. Daß aber die große Menge der Produzenten,
und daß vor allem das große Publikum ihnen nicht
gefolgt oder doch der neuen Richtung nicht treu ge-
blisben ist, davon kann man sich, noch entschiedener
als auf Ausstellungen im Lande selbst, in den Ge-
schäften und in Wohnungen des Mittelstandes über-
zeugen. Die Kamine und Kredenzen in den letzteren
sind gegsnwärtig nicht minder als vor dreißig Jahren
Sammelplütze sür „Ziergefäße" in unleidlichen For-
men und Farben, für die abgeschmacktesten Figürchen
und sonstige Nippss, und die elegantesten Gewölbe in
Oxfordstreet, in den Badeorten u. s. w. weisen ein
Durcheinander aust in welchem die tollstsn Aus-
geburten der Mode unbedingtes Übergewicht haben.
Hält man nun dem den großen Aufwand geistiger
Arbsit und den noch vtel größeren an materiellen
Kräften während dieser dreißig Jahre gegenüber, so
kann das Ergebnis nur höchst unbefriedigend ge-
nannt werden. Nach allem, was hier bemerkt wor-
den ist, erscheint daher die Schlußfolgerung wohl bs-
rechtigt, daß durch Anhäufung der vorzüglichsten
Originalarbeiten allein die ästhetische Er-
ziehung des Gewerbestandes und die ebenso
24'