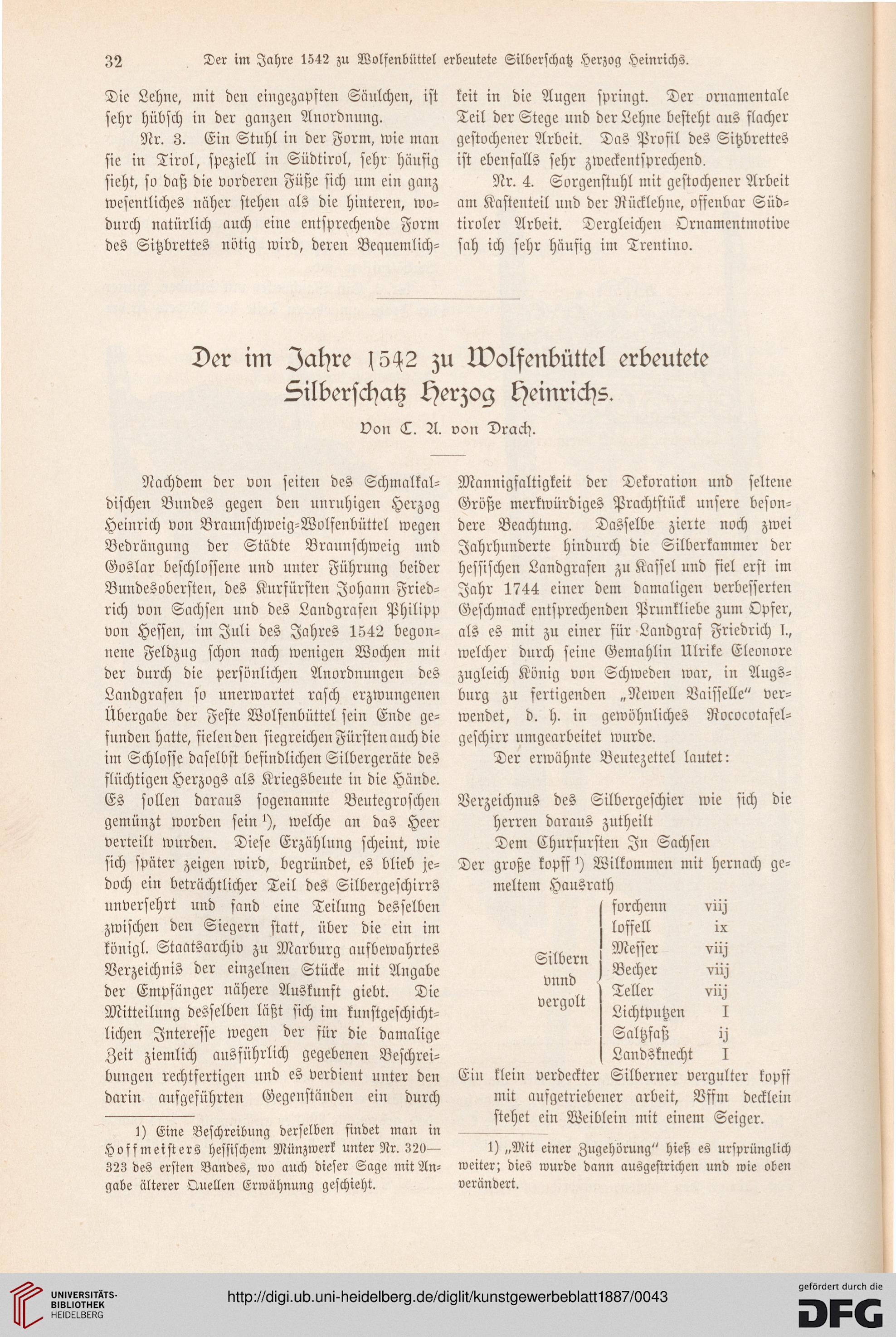32
Der im Jahre 1542 zu Wolfenbüttel erbeutete Silberschatz Herzog Heinrichs.
Die Lehne, mit den eingezapften Säulchen, ist
sehr hübsch in der ganzen Anordnung.
Nr. 3. Ein Stuhl in der Form, wie man
sie in Tirol, speziell in Südtirol, sehr häufig
sieht, so daß die vorderen Füße sich um ein ganz
wesentliches näher stehen als die hinteren, wo-
durch natürlich auch eine entsprechende Form
des Sitzbrettes nötig wird, deren Bequemlich-
keit in die Augen springt. Der ornamentale
Teil der Stege und der Lehne besteht aus flacher
gestochener Arbeit. Das Profil des Sitzbrettes
ist ebenfalls sehr zweckentsprechend.
Nr. 4. Sorgenstuhl mit gestochener Arbeit
am Kastenteil und der Rücklehne, offenbar Süd-
tiroler Arbeit. Dergleichen Ornamentmotive
sah ich sehr häufig im Trentino.
Der im Iahre ^5^2 zu Molfenbüttel erbeutete
Älberschatz Herzog k^einrichs.
von L. A. von Drach.
Nachdem der von seiten des Schmalkal-
dischen Bundes gegen den unruhigen Herzog
Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel wegen
Bedrängung der Städte Brannschweig nnd
Goslar beschlossene nnd unter Führung beider
Bundesobersten, des Kurfürsten Johann Fried-
rich von Sachsen und des Landgrafen Philipp
von Hessen, im Juli des Jahres 1542 begon-
nene Feldzug schon nach wenigen Wochen mit
der dnrch die persönlichen Anordnungen des
Landgrafen so unerwartet rasch erzwungenen
Übergabe der Feste Wolfenbüttel sein Ende ge-
sunden hatte, fielenden siegreichen Fürsten auch die
im Schlosse daselbst befindlichen Silbergeräte des
flüchtigen Herzogs als Kriegsbeute in die Hände.
Es sollen daraus sogenannte Beutegroschen
gemünzt worden sein ü, welche an das Heer
verteilt wurden. Diese Erzählung scheint, wie
sich später zeigen wird, begründet, es blieb je-
doch ein beträchtlicher Teil des Silbergeschirrs
unversehrt und fand eine Teilung desselben
zwischen den Siegern statt, über die ein im
königl. Staatsarchiv zu Marburg aufbewahrtes
Verzeichnis der einzelnen Stücke mit Angabe
der Empfänger nähere Auskunft giebt. Die
Mitteilung desselben läßt sich im knnstgeschicht-
lichen Jnteresse wegen der fiir die damalige
Zeit ziemlich ausführlich gegebenen Beschrei-
bungen rechtfertigen und es verdient unter den
darin aufgeführten Gegenständen ein durch
I) Eins Beschreibung derselben findet man in
Hoffmsisters hessischem Münzwerk unter Nr. 320—
823 des ersten Bandes, wo auch disser Sage mit An-
gabe älterer Quellen Erwähnung geschieht.
Mannigfaltigkeit der Dekoration und seltene
Größe merkwürdiges Prachtstück unsere beson-
dere Beachtung. Dasselbe zierte noch zwei
Jahrhunderte hindurch die Silberkammer der
hessischen Landgrafen zu Kassel und fiel erst im
Jahr 1744 einer dem damaligen verbesserten
Geschmack entsprechenden Prunkliebe zum Opfer,
als es mit zu einer für Landgraf Friedrich I.,
welcher durch seine Gemahlin lllrike Eleonore
zugleich König von Schweden war, in Augs-
burg zu fertigenden „Newen Vaisselle" ver-
wendet, d. h. in gewöhnliches Rococotafel-
geschirr umgearbeitet wurde.
Der erwähnte Beutezettel lautet:
Verzeichnus des Silbergeschier wie sich die
herren daraus zutheilt
Dem Churfursteu Jn Sachsen
Der große kopff^) Wilkommen mit hernach ge-
meltem Hausrath
Silbern
vnnd
vergolt
Ein klein verdeckter Silberner vergulter kopff
mit aufgetriebener arbeit, Vffm decklein
stehet ein Weiblein mit einem Seiger.
forchenn
viij
loffell
ix
Messer
viij
Becher
viij
Teller
viij
Lichtputzen
I
Saltzfaß
Ü
Landsknecht
I
1) „Mit einer Zugehörung" hieß es ursprünglich
weiter; dies wurde dann ausgestrichen und wie obsn
verändert.
Der im Jahre 1542 zu Wolfenbüttel erbeutete Silberschatz Herzog Heinrichs.
Die Lehne, mit den eingezapften Säulchen, ist
sehr hübsch in der ganzen Anordnung.
Nr. 3. Ein Stuhl in der Form, wie man
sie in Tirol, speziell in Südtirol, sehr häufig
sieht, so daß die vorderen Füße sich um ein ganz
wesentliches näher stehen als die hinteren, wo-
durch natürlich auch eine entsprechende Form
des Sitzbrettes nötig wird, deren Bequemlich-
keit in die Augen springt. Der ornamentale
Teil der Stege und der Lehne besteht aus flacher
gestochener Arbeit. Das Profil des Sitzbrettes
ist ebenfalls sehr zweckentsprechend.
Nr. 4. Sorgenstuhl mit gestochener Arbeit
am Kastenteil und der Rücklehne, offenbar Süd-
tiroler Arbeit. Dergleichen Ornamentmotive
sah ich sehr häufig im Trentino.
Der im Iahre ^5^2 zu Molfenbüttel erbeutete
Älberschatz Herzog k^einrichs.
von L. A. von Drach.
Nachdem der von seiten des Schmalkal-
dischen Bundes gegen den unruhigen Herzog
Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel wegen
Bedrängung der Städte Brannschweig nnd
Goslar beschlossene nnd unter Führung beider
Bundesobersten, des Kurfürsten Johann Fried-
rich von Sachsen und des Landgrafen Philipp
von Hessen, im Juli des Jahres 1542 begon-
nene Feldzug schon nach wenigen Wochen mit
der dnrch die persönlichen Anordnungen des
Landgrafen so unerwartet rasch erzwungenen
Übergabe der Feste Wolfenbüttel sein Ende ge-
sunden hatte, fielenden siegreichen Fürsten auch die
im Schlosse daselbst befindlichen Silbergeräte des
flüchtigen Herzogs als Kriegsbeute in die Hände.
Es sollen daraus sogenannte Beutegroschen
gemünzt worden sein ü, welche an das Heer
verteilt wurden. Diese Erzählung scheint, wie
sich später zeigen wird, begründet, es blieb je-
doch ein beträchtlicher Teil des Silbergeschirrs
unversehrt und fand eine Teilung desselben
zwischen den Siegern statt, über die ein im
königl. Staatsarchiv zu Marburg aufbewahrtes
Verzeichnis der einzelnen Stücke mit Angabe
der Empfänger nähere Auskunft giebt. Die
Mitteilung desselben läßt sich im knnstgeschicht-
lichen Jnteresse wegen der fiir die damalige
Zeit ziemlich ausführlich gegebenen Beschrei-
bungen rechtfertigen und es verdient unter den
darin aufgeführten Gegenständen ein durch
I) Eins Beschreibung derselben findet man in
Hoffmsisters hessischem Münzwerk unter Nr. 320—
823 des ersten Bandes, wo auch disser Sage mit An-
gabe älterer Quellen Erwähnung geschieht.
Mannigfaltigkeit der Dekoration und seltene
Größe merkwürdiges Prachtstück unsere beson-
dere Beachtung. Dasselbe zierte noch zwei
Jahrhunderte hindurch die Silberkammer der
hessischen Landgrafen zu Kassel und fiel erst im
Jahr 1744 einer dem damaligen verbesserten
Geschmack entsprechenden Prunkliebe zum Opfer,
als es mit zu einer für Landgraf Friedrich I.,
welcher durch seine Gemahlin lllrike Eleonore
zugleich König von Schweden war, in Augs-
burg zu fertigenden „Newen Vaisselle" ver-
wendet, d. h. in gewöhnliches Rococotafel-
geschirr umgearbeitet wurde.
Der erwähnte Beutezettel lautet:
Verzeichnus des Silbergeschier wie sich die
herren daraus zutheilt
Dem Churfursteu Jn Sachsen
Der große kopff^) Wilkommen mit hernach ge-
meltem Hausrath
Silbern
vnnd
vergolt
Ein klein verdeckter Silberner vergulter kopff
mit aufgetriebener arbeit, Vffm decklein
stehet ein Weiblein mit einem Seiger.
forchenn
viij
loffell
ix
Messer
viij
Becher
viij
Teller
viij
Lichtputzen
I
Saltzfaß
Ü
Landsknecht
I
1) „Mit einer Zugehörung" hieß es ursprünglich
weiter; dies wurde dann ausgestrichen und wie obsn
verändert.