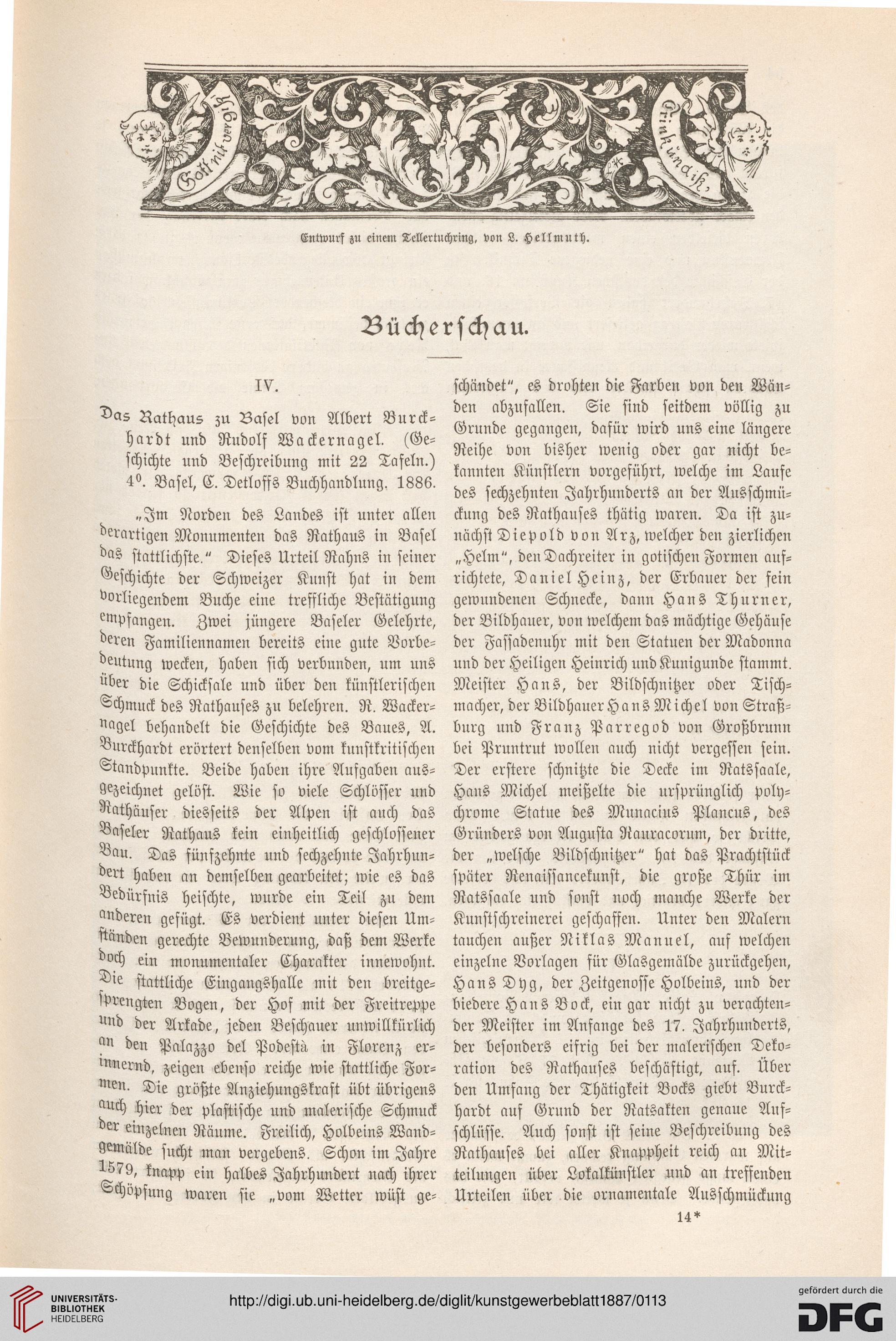Entwurf zu cinem Tellertnchring, von L. Hellniuth.
Bücherschau.
IV.
^as Rathaus zu Basel von Albert Burck-
hcirdt und Rudolf Wackernagel. (Ge-
schichte und Beschreibung mit 22 Tafeln.)
4«. Basel, C. Detloffs Bnchhandlnng. 1886.
„Jm Norden des Landes ist unter allen
^erartigen Monumenten das Rathaus in Basel
^as stattlichste." Dieses Urteil Rahns in seiner
^eschichte der Schweizer Knnst hat in dem
borliegendem Buche eine treffliche Bestätigung
knipsangen. Zwei jüngere Baseler Gelehrte,
deren Familiennamen bereits eine gute Vorbe-
deutung wecken, haben sich verbunden, um uns
über die Schicksale und über den künstlerischen
Schmuck des Rathauses zu belehren. R. Wacker-
nagel behandelt die Geschichte des Baues, A.
^urckhardt erörtert denselben vom kunstkritischen
Standpunkte. Beide haben ihre Aufgaben aus-
lwzeichnet gelöst. Wie so viele Schlösser und
dkathäuser diesseits der Alpen ist anch das
Baseler Rathaus kein einheitlich geschlossener
^au. Das fünfzehnte und sechzehnte Jahrhun-
dert haben an demselben gearbeitet; wie es das
^edürfnis heischte, wurde ein Teil zu dem
auderen gefügt. Es verdient unter diesen Um-
ständen gerechte Bewnnderung, daß dem Werke
^och ein monumentaler Charakter innewohnt.
stattliche Eingangshalle mit den breitge-
sprengten Bogen, der Hof mit der Freitreppe
uud der Arkade, jeden Beschaner unwillkürlich
a» den Palazzo del Podestü in Florenz er-
wnernd, zeigen ebenso reiche wie stattliche For-
wen. Die größte Anziehungskraft übt übrigens
auch hier der plastische und malerische Schmuck
^er einzelnen Räume. Freilich, Holbeins Wand-
gemülde sncht man vergebens. Schon im Jahre
1579, knapp ein halbes Jahrhundert nach ihrer
Schöpfung waren sie „vom Wetter wüst ge-
schändet", es drohten die Farben von den Wän-
den abzufallen. Sie sind seitdem völlig zu
Grunde gegangen, dafür wird uns eine längere
Reihe von bisher wenig oder gar nicht be-
kannten Künstlern vorgeführt, welche im Laufe
des sechzehnten Jahrhunderts an der Ansschmü-
ckung des Rathauses thätig waren. Da ist zu-
nächst Diepold von Arz, welcher den zierlichen
„Helm", denDachreiter in gotischen Formen auf-
richtete, Daniel Heinz, der Erbauer der fein
gewundenen Schnecke, dann Hans Thurner,
der Bildhauer, von welchem das mächtige Gehäuse
der Fassadenuhr mit den Statuen der Madonna
und der Heiligen Heinrich und Kunigunde stammt.
Meister Hans, der Bildschnitzer oder Tisch-
macher, der BildhauerHans Michel von Straß-
burg und Franz Parregod von Großbrunn
bei Pruntrut wollen auch nicht vergessen sein.
Der erstere schnitzte die Decke im Ratssaale,
Hans Michel meißelte die ursprünglich poly-
chrome Statue des Munacius Plancus, des
Gründers von Augusta Ranracorum, der dritte,
der „welsche Bildschnitzer" hai das Prachtstück
später Renaissancekunst, die große Thür im
Ratssaale und sonst noch manche Werke der
Kunstschreinerei geschaffen. Unter den Malern
tauchen außer Niklas Manuel, auf welchen
einzelne Vorlagen für Glasgemälde zurückgehen,
Hans Dyg, der Zeitgenosse Holbeins, und der
biedere Hans Bock, ein gar nicht zu verachten-
der Meister im Anfange des 17. Jahrhunderts,
der besonders eifrig bei der malerischen Deko-
ration des Rathanses beschäftigt, anf. Über
den Umfang der Thätigkeit Bocks giebt Burck-
hardt auf Grund der Ratsakten genaue Auf-
schlüsse. Auch sonst ist seine Beschreibuug des
Rathauses bei aller Knappheit reich an Mit-
teilungen über Lokalkünstler nnd an treffenden
Urteilen über die ornamentale Ausschmückung
14*
Bücherschau.
IV.
^as Rathaus zu Basel von Albert Burck-
hcirdt und Rudolf Wackernagel. (Ge-
schichte und Beschreibung mit 22 Tafeln.)
4«. Basel, C. Detloffs Bnchhandlnng. 1886.
„Jm Norden des Landes ist unter allen
^erartigen Monumenten das Rathaus in Basel
^as stattlichste." Dieses Urteil Rahns in seiner
^eschichte der Schweizer Knnst hat in dem
borliegendem Buche eine treffliche Bestätigung
knipsangen. Zwei jüngere Baseler Gelehrte,
deren Familiennamen bereits eine gute Vorbe-
deutung wecken, haben sich verbunden, um uns
über die Schicksale und über den künstlerischen
Schmuck des Rathauses zu belehren. R. Wacker-
nagel behandelt die Geschichte des Baues, A.
^urckhardt erörtert denselben vom kunstkritischen
Standpunkte. Beide haben ihre Aufgaben aus-
lwzeichnet gelöst. Wie so viele Schlösser und
dkathäuser diesseits der Alpen ist anch das
Baseler Rathaus kein einheitlich geschlossener
^au. Das fünfzehnte und sechzehnte Jahrhun-
dert haben an demselben gearbeitet; wie es das
^edürfnis heischte, wurde ein Teil zu dem
auderen gefügt. Es verdient unter diesen Um-
ständen gerechte Bewnnderung, daß dem Werke
^och ein monumentaler Charakter innewohnt.
stattliche Eingangshalle mit den breitge-
sprengten Bogen, der Hof mit der Freitreppe
uud der Arkade, jeden Beschaner unwillkürlich
a» den Palazzo del Podestü in Florenz er-
wnernd, zeigen ebenso reiche wie stattliche For-
wen. Die größte Anziehungskraft übt übrigens
auch hier der plastische und malerische Schmuck
^er einzelnen Räume. Freilich, Holbeins Wand-
gemülde sncht man vergebens. Schon im Jahre
1579, knapp ein halbes Jahrhundert nach ihrer
Schöpfung waren sie „vom Wetter wüst ge-
schändet", es drohten die Farben von den Wän-
den abzufallen. Sie sind seitdem völlig zu
Grunde gegangen, dafür wird uns eine längere
Reihe von bisher wenig oder gar nicht be-
kannten Künstlern vorgeführt, welche im Laufe
des sechzehnten Jahrhunderts an der Ansschmü-
ckung des Rathauses thätig waren. Da ist zu-
nächst Diepold von Arz, welcher den zierlichen
„Helm", denDachreiter in gotischen Formen auf-
richtete, Daniel Heinz, der Erbauer der fein
gewundenen Schnecke, dann Hans Thurner,
der Bildhauer, von welchem das mächtige Gehäuse
der Fassadenuhr mit den Statuen der Madonna
und der Heiligen Heinrich und Kunigunde stammt.
Meister Hans, der Bildschnitzer oder Tisch-
macher, der BildhauerHans Michel von Straß-
burg und Franz Parregod von Großbrunn
bei Pruntrut wollen auch nicht vergessen sein.
Der erstere schnitzte die Decke im Ratssaale,
Hans Michel meißelte die ursprünglich poly-
chrome Statue des Munacius Plancus, des
Gründers von Augusta Ranracorum, der dritte,
der „welsche Bildschnitzer" hai das Prachtstück
später Renaissancekunst, die große Thür im
Ratssaale und sonst noch manche Werke der
Kunstschreinerei geschaffen. Unter den Malern
tauchen außer Niklas Manuel, auf welchen
einzelne Vorlagen für Glasgemälde zurückgehen,
Hans Dyg, der Zeitgenosse Holbeins, und der
biedere Hans Bock, ein gar nicht zu verachten-
der Meister im Anfange des 17. Jahrhunderts,
der besonders eifrig bei der malerischen Deko-
ration des Rathanses beschäftigt, anf. Über
den Umfang der Thätigkeit Bocks giebt Burck-
hardt auf Grund der Ratsakten genaue Auf-
schlüsse. Auch sonst ist seine Beschreibuug des
Rathauses bei aller Knappheit reich an Mit-
teilungen über Lokalkünstler nnd an treffenden
Urteilen über die ornamentale Ausschmückung
14*