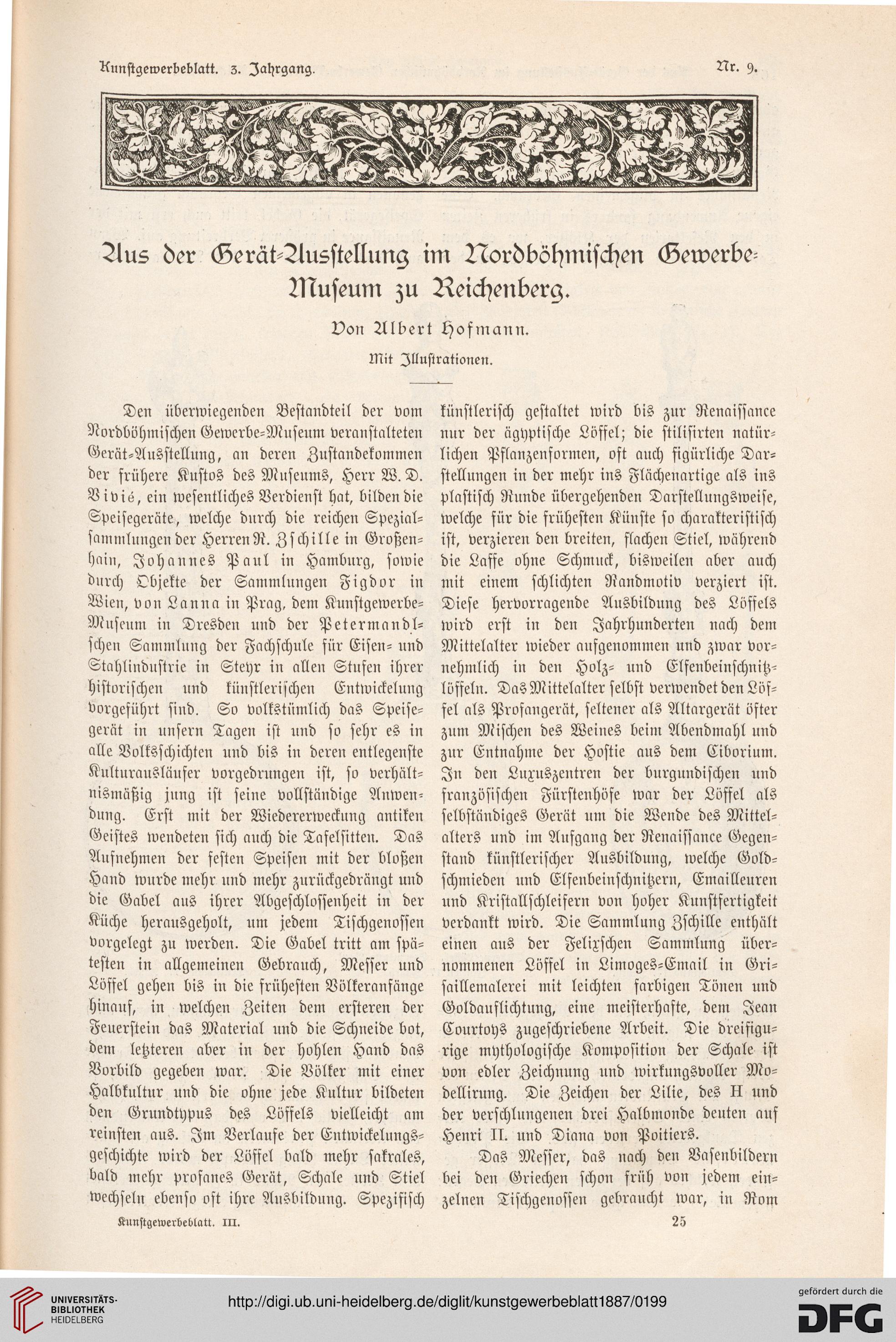Aimstgewerbeblatt. z. Iahrgang.
Nr. 9.
Aus der Gerät-^lusstellung im Nordböhmischen Gewerbe-
)Nuseunr zu Reichenberg.
Von Albert l)ofmann.
Mit Illustrationen.
Den überwiegenden Bestmidteil der vom
Nordböhmischen Gewerbe-Museum veranstolteten
Gerät-Ausstellung, on deren Zustandekommen
der frühere Kustos des Muscnms, Herr W. D.
Vivis, eiu wesentliches Verdienst hat, bilden die
Speisegeräte, welche dnrch die reichen Spezial-
sammlungender HerrenR. Zschille in Großen-
h>ün, Johannes Paul in Hamburg, sowie
durch Objekte der Sammlungen Figdor in
Wien, von Lanna in Prag, dem Kunstgewerbe-
Mnseum in Dresden und der Petermandl-
scheu Sammlung der Fachschule für Eisen- und
Stahlindustrie in Steyr in alleu Stufen ihrer
historischeu und künstlerischen Entwickeluug
vorgeführt sind. So volkstümlich das Speise-
gerät in unsern Tagen ist uud so sehr es iu
alle Volksschichten und bis in deren entlegenste
Kulturauslänfer Porgedrnngen ist, so verhält-
nismäßig jung ist seine vollständige Anwen-
duug. Erst mit der Wiedererweckung antiken
Geistes wendeten sich auch die Tafelsilten. Das
Aufnehmen der festen Speisen mit der bloßen
Hand wnrde mehr und mehr zurückgedräugt und
die Gabel aus ihrer Abgeschlossenheit in der
Küche heransgeholt, um jedem Tischgenossen
vorgelegt zu werden. Die Gabel tritt am spü-
testen in allgemeinen Gebrauch, Messer und
Lösfel gehen bis in die frühesten Völkeranfänge
hinauf, in welchen Zeiten dem ersteren der
Feuerstein das Material und die Schneide bot,
dem letzteren aber in der hohlen Hand dns
Vorbild gegebeu war. Die Völker mit einer
Halbkultur und die ohne jede Kultur bildeten
den Grundtypus des Lösfels vielleicht am
reinsten aus. Jm Verlaufe der Entwickelungs-
geschichte wird der Lösfel bald mehr sakrales,
bald mchr Profanes Gerät, Schale nnd Stiel
wechselu cbeuso oft ihre Ansbildung. Spezifisch
Kunstgewerbeblatt. III.
künstlerisch gestaltet wird bis zur Renaissance
nur der ägyptische Löffel; die stilisirteu natür-
lichen Pflanzensormen, oft auch figürliche Dar-
stellungen in der mehr ins Flächeuartige als ins
plastisch Runde übergehenden Darstelluugsweise,
welche für die frühesteu Künste so charakteristisch
ist, verzieren den breiten, flachen Stiel, während
die Laffe ohne Schmnck, bisweilen aber auch
mit einem schlichten Nandmotiv verziert ist.
Diese hervorragende Ausbildung des Löffels
wird erst in den Jahrhunderten nach dem
Mittelalter wieder aufgenommen uud zwar vor-
nehmlich in den Holz- und Elfenbeinschnitz-
löffeln. DasMittelalter selbst verwendetden Löf-
fel als Profangerät, seltener als Altargerät vfter
zum Mischen des Weines beim Abendmahl und
zur Entnahme der Hostie aus dem Ciborium.
Ju den Luxuszeutren der bnrgundischen nnd
sranzösischen Fürstenhöfe war der Löffel als
selbständiges Gerttt nm die Wende des Mittel-
alters und im Aufgang der Renaissance Gegen-
stand künstlerischer Ausbildung, welche Gold-
schmieden und Elfenbeinschnitzern, Emailleuren
nnd Kristallschleifern von hoher Kunstfertigkeit
verdnnkt wird. Die Sammlung Zschille enthält
einen aus der Felixschen Sammlung über-
nommenen Löffel in Limoges-Email in Gri-
saillemalerei mit leichten farbigen Tönen nnd
Goldauflichtnng, eine meisterhafte, dem Jean
Conrtoys zugeschriebene Arbeit. Die dreifigu-
rige mythologische Komposition der Schale ist
von edler Zeichnung und wirkuugsvoller Mo-
dellirung. Die Zeichen der Lilie, des 8 und
der verschlnngenen drei Halbmonde deuten auf
Henri II. und Diana von Poitiers.
Das Messer, das nach den Vasenbildern
bei den Griechen schon friih von jedem eiu-
zelnen Tischgenossen gebraucht war, in Rom
Nr. 9.
Aus der Gerät-^lusstellung im Nordböhmischen Gewerbe-
)Nuseunr zu Reichenberg.
Von Albert l)ofmann.
Mit Illustrationen.
Den überwiegenden Bestmidteil der vom
Nordböhmischen Gewerbe-Museum veranstolteten
Gerät-Ausstellung, on deren Zustandekommen
der frühere Kustos des Muscnms, Herr W. D.
Vivis, eiu wesentliches Verdienst hat, bilden die
Speisegeräte, welche dnrch die reichen Spezial-
sammlungender HerrenR. Zschille in Großen-
h>ün, Johannes Paul in Hamburg, sowie
durch Objekte der Sammlungen Figdor in
Wien, von Lanna in Prag, dem Kunstgewerbe-
Mnseum in Dresden und der Petermandl-
scheu Sammlung der Fachschule für Eisen- und
Stahlindustrie in Steyr in alleu Stufen ihrer
historischeu und künstlerischen Entwickeluug
vorgeführt sind. So volkstümlich das Speise-
gerät in unsern Tagen ist uud so sehr es iu
alle Volksschichten und bis in deren entlegenste
Kulturauslänfer Porgedrnngen ist, so verhält-
nismäßig jung ist seine vollständige Anwen-
duug. Erst mit der Wiedererweckung antiken
Geistes wendeten sich auch die Tafelsilten. Das
Aufnehmen der festen Speisen mit der bloßen
Hand wnrde mehr und mehr zurückgedräugt und
die Gabel aus ihrer Abgeschlossenheit in der
Küche heransgeholt, um jedem Tischgenossen
vorgelegt zu werden. Die Gabel tritt am spü-
testen in allgemeinen Gebrauch, Messer und
Lösfel gehen bis in die frühesten Völkeranfänge
hinauf, in welchen Zeiten dem ersteren der
Feuerstein das Material und die Schneide bot,
dem letzteren aber in der hohlen Hand dns
Vorbild gegebeu war. Die Völker mit einer
Halbkultur und die ohne jede Kultur bildeten
den Grundtypus des Lösfels vielleicht am
reinsten aus. Jm Verlaufe der Entwickelungs-
geschichte wird der Lösfel bald mehr sakrales,
bald mchr Profanes Gerät, Schale nnd Stiel
wechselu cbeuso oft ihre Ansbildung. Spezifisch
Kunstgewerbeblatt. III.
künstlerisch gestaltet wird bis zur Renaissance
nur der ägyptische Löffel; die stilisirteu natür-
lichen Pflanzensormen, oft auch figürliche Dar-
stellungen in der mehr ins Flächeuartige als ins
plastisch Runde übergehenden Darstelluugsweise,
welche für die frühesteu Künste so charakteristisch
ist, verzieren den breiten, flachen Stiel, während
die Laffe ohne Schmnck, bisweilen aber auch
mit einem schlichten Nandmotiv verziert ist.
Diese hervorragende Ausbildung des Löffels
wird erst in den Jahrhunderten nach dem
Mittelalter wieder aufgenommen uud zwar vor-
nehmlich in den Holz- und Elfenbeinschnitz-
löffeln. DasMittelalter selbst verwendetden Löf-
fel als Profangerät, seltener als Altargerät vfter
zum Mischen des Weines beim Abendmahl und
zur Entnahme der Hostie aus dem Ciborium.
Ju den Luxuszeutren der bnrgundischen nnd
sranzösischen Fürstenhöfe war der Löffel als
selbständiges Gerttt nm die Wende des Mittel-
alters und im Aufgang der Renaissance Gegen-
stand künstlerischer Ausbildung, welche Gold-
schmieden und Elfenbeinschnitzern, Emailleuren
nnd Kristallschleifern von hoher Kunstfertigkeit
verdnnkt wird. Die Sammlung Zschille enthält
einen aus der Felixschen Sammlung über-
nommenen Löffel in Limoges-Email in Gri-
saillemalerei mit leichten farbigen Tönen nnd
Goldauflichtnng, eine meisterhafte, dem Jean
Conrtoys zugeschriebene Arbeit. Die dreifigu-
rige mythologische Komposition der Schale ist
von edler Zeichnung und wirkuugsvoller Mo-
dellirung. Die Zeichen der Lilie, des 8 und
der verschlnngenen drei Halbmonde deuten auf
Henri II. und Diana von Poitiers.
Das Messer, das nach den Vasenbildern
bei den Griechen schon friih von jedem eiu-
zelnen Tischgenossen gebraucht war, in Rom