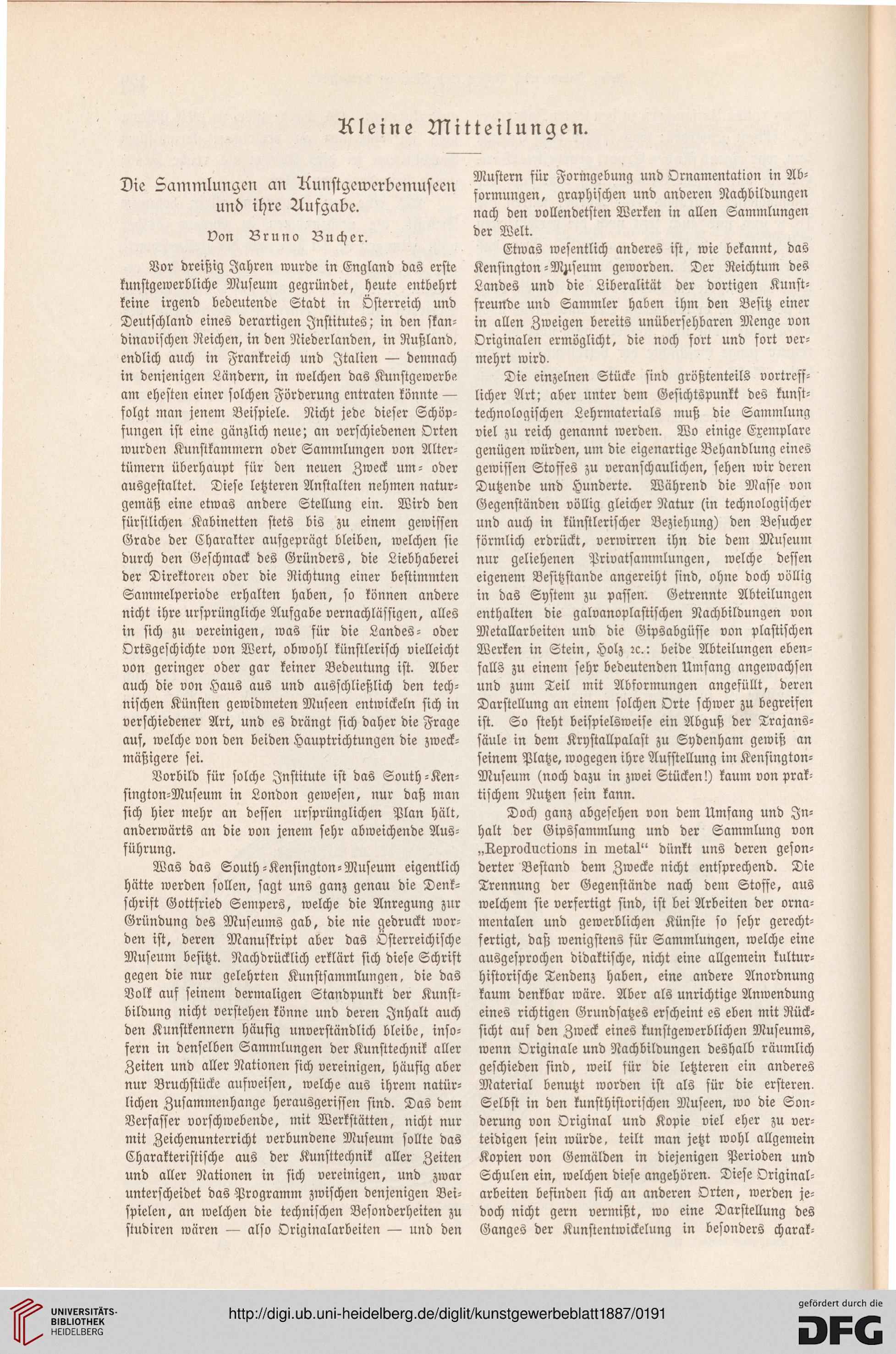Kleine Mitteilungen.
Die 5ammlungen an Aunstgewerbemuseen
und ihre Ausgabe.
Von Bruno Bncher.
Vor dreihig Jahren wurde in England das erste
kunstgewerbliche Museum gegründst, heute entbehrt
keine irgend bedeutende Stadt in Üsterreich und
Deutschland eines derartigen Jnstitutes; in den skan-
dinavischen Reichen, in den Niederlanden, in Rußland,
endlich auch in Frankreich und Jtalisn — demnach
in denjenigsn Ländern, in welchen das Kunstgewerbe
am ehesten einsr solchen Förderung entraten könnte —
folgt man jenem Beispiele. Nicht jede disser Schöp-
sungsn ist eine gänzlich neue; an verschiedenen Orten
wurden Kunstkammern oder Sammlungen von Alter-
tümern überhaüpt für den neuen Zweck um- oder
ausgestaltet. Diese letzteren Anstalten nehmen natur-
gemäß eine etwas andere Stellung ein. Wird den
fürstlichen Kabinetten stets bis zu einem gewissen
Grade der Charakter aufgeprägt bleiben, welchen sie
durch den Geschmack des Gründers, die Liebhaberei
der Direktoren oder dis Richtung einer bestimmten
Sammelperiode erhalten haben, so können andsre
nicht ihre ursprüngliche Aufgabo vernachlässigen, alles
in sich zu vereinigen, was für die Landes- oder
Ortsgeschichte von Wert, obwohl künstlerisch vielleicht
von geringer oder gar keiner Bedeutung ist. Aber
auch die von Haus aus und ausschließlich den tech-
nischen Künsten gewidmeten Museen entwicksln sich in
verschiedener Art, und es drängt sich daher die Frage
auf, welchs von den beiden Hauptrichtungen die zweck-
mäßigere sei.
Vorbild für solche Jnstitute ist das South-Ksn-
sington-Museum in London gewesen, nur daß man
sich hier mehr an dsssen ursprünglichen Plan hält.
anderwärts an dis von jenem sehr abweichende Aus-
führung.
Was das South-Ksnsington-Museum eigentlich
hätte werden sollen, sagt uns ganz genau die Denk-
schrift Gottfried Sempers, welche die Anregung zur
Gründung des Museums gab, die nie gedruckt wor-
dsn ist, deren Manuskript aber das Österreichische
Museum besitzt. Nachdrücklich erklärt sich diese Schrift
gegen die nur gelehrten Kunstsammlungen, die das
Volk auf seinem dermaligsn Standpunkt der Kunst-
bildung nicht verstehen könns und dersn Jnhalt auch
den Kunstkennern häufig unverständlich bleibe, inso-
sern in denselben Sammlungen der Kunsttechnik aller
Zeiten und aller Nationen sich versinigen, häufig aber
nur Bruchstücke aufweisen, welche aus ihrem natür-
lichen Zusammenhange herausgerissen sind. Das dem
Verfasser vorschwebende, mit Werkstätten, nicht nur
mit Zeichenunterricht verbundene Museum sollte das
Charakteristische aus der Kunsttechnik aller Zeiten
und aller Nationen in sich vereinigen, und zwar
unterscheidet das Programm zwischen denjenigen Bei-
spielen, an welchen dis technischen Besonderheiten zu
studiren wären — also Originalarbeiten — und den
Mustern für Formgebung und Ornamentation in Ab-
formungen, graphischen und anderen Nachbildungen
nach den vollendetsten Werken in allen Sammlungen
der Welt.
Etwas wesentlich anderes ist, wie bskannt, das
Kensington-Mpseum geworden. Der Reichtum des
Landes und die Liberalität der dortigen Kunst-
freunde und Sammler haben ihm dsn Besitz einsr
in allen Zweigen bereits unübersehbaren Menge von
Originalen ermöglicht, die noch fort und fort ver-
mehrt wird.
Die einzelnen Stücke sind größtenteils vortreff-
licher Art; aber unter dem Gesichtspunkt des kunst-
technologischen Lehrmaterials muß dis Sammlung
viel zu reich genannt werden. Wo einige Exemplare
genügen würden, um die eigenartige Behandlung eines
gewisssn Stoffes zu veranschaulichsn, sehen wir deren
Dutzende und Hunderte. Während die Masse von
Gegenständen völlig gleicher Natur sin technologischer
und auch in künstlerischer Bsziehung) den Besucher
förmlich erdrückt, verwirren ihn die dem Museum
nur geliehenen Privatsammlungen, welche dessen
eigenem Besitzstande angsreiht sind, ohne doch völlig
in das System zu passen. Getrennte Abteilungsn
enthalten die galvanoplastischen Nachbildungen von
Metallarbsiten und die Gipsabgüsse von plastifchen
Werken in Stein, Holz rc.: beide Abteilungen eben-
salls zu einem sehr bedeutenden Umfang angewachsen
und zum Teil mit Abformungsn angefüllt, deren
Darstellung an einem solchen Orte schwer zu begreifen
ist. So steht beispielswsise ein Abguß der Trajans-
säule in dem Krystallpalast zu Sydenham gewiß an
seinem Platze, wogegen ihre Aufstellung im Kensington-
Museum (noch dazu in zwei Stücken!) kaum von prak-
tischem Nutzen sein kann.
Doch ganz abgssehen von dem Umfang und Jn-
halt der Gipssammlung und der Sammlung von
„Lsxiociuotioiis iu mstai" dünkt uns deren geson-
derter Bestand dem Zwecks nicht entsprechend. Die
Trennung der Gegenstände nach dem Stoffe, aus
welchem sie verfertigt sind, ist bei Arbeiten der orna-
mentalen und gewerblichen Künste so sehr gerecht-
fertigt, daß wenigstens für Sammlungen, welche eine
ausgesprochen didaktische, nicht eine allgemein kultur-
historische Tendenz haben, eine andere Anordnung
kaum denkbar wäre. Aber als unrichtige Anwendung
eines richtigen Grundsatzes erscheint es ebsn mit Rück-
sicht auf den Zweck eines kunstgewerblichen Museums,
wenn Originale und Nachbildungen dsshalb räumlich
geschieden sind, weil für die letzteren ein anderes
Material benutzt worden ist als sür die ersteren.
Selbst in den kunsthistorischen Museen, wo die Son-
derung von Original und Kopie viel eher zu ver-
teidigen sein würde, teilt man jetzt wohl allgemein
Kopien von Gemälden in diejenigen Perioden und
Schulen ein, welchen diese angehören. Diese Original-
arbeiten befinden sich an anderen Ortsn, werdsn je-
doch nicht gern vermißt, wo eine Darstellung des
Ganges der Kunstentwickelung in besonders charak-
Die 5ammlungen an Aunstgewerbemuseen
und ihre Ausgabe.
Von Bruno Bncher.
Vor dreihig Jahren wurde in England das erste
kunstgewerbliche Museum gegründst, heute entbehrt
keine irgend bedeutende Stadt in Üsterreich und
Deutschland eines derartigen Jnstitutes; in den skan-
dinavischen Reichen, in den Niederlanden, in Rußland,
endlich auch in Frankreich und Jtalisn — demnach
in denjenigsn Ländern, in welchen das Kunstgewerbe
am ehesten einsr solchen Förderung entraten könnte —
folgt man jenem Beispiele. Nicht jede disser Schöp-
sungsn ist eine gänzlich neue; an verschiedenen Orten
wurden Kunstkammern oder Sammlungen von Alter-
tümern überhaüpt für den neuen Zweck um- oder
ausgestaltet. Diese letzteren Anstalten nehmen natur-
gemäß eine etwas andere Stellung ein. Wird den
fürstlichen Kabinetten stets bis zu einem gewissen
Grade der Charakter aufgeprägt bleiben, welchen sie
durch den Geschmack des Gründers, die Liebhaberei
der Direktoren oder dis Richtung einer bestimmten
Sammelperiode erhalten haben, so können andsre
nicht ihre ursprüngliche Aufgabo vernachlässigen, alles
in sich zu vereinigen, was für die Landes- oder
Ortsgeschichte von Wert, obwohl künstlerisch vielleicht
von geringer oder gar keiner Bedeutung ist. Aber
auch die von Haus aus und ausschließlich den tech-
nischen Künsten gewidmeten Museen entwicksln sich in
verschiedener Art, und es drängt sich daher die Frage
auf, welchs von den beiden Hauptrichtungen die zweck-
mäßigere sei.
Vorbild für solche Jnstitute ist das South-Ksn-
sington-Museum in London gewesen, nur daß man
sich hier mehr an dsssen ursprünglichen Plan hält.
anderwärts an dis von jenem sehr abweichende Aus-
führung.
Was das South-Ksnsington-Museum eigentlich
hätte werden sollen, sagt uns ganz genau die Denk-
schrift Gottfried Sempers, welche die Anregung zur
Gründung des Museums gab, die nie gedruckt wor-
dsn ist, deren Manuskript aber das Österreichische
Museum besitzt. Nachdrücklich erklärt sich diese Schrift
gegen die nur gelehrten Kunstsammlungen, die das
Volk auf seinem dermaligsn Standpunkt der Kunst-
bildung nicht verstehen könns und dersn Jnhalt auch
den Kunstkennern häufig unverständlich bleibe, inso-
sern in denselben Sammlungen der Kunsttechnik aller
Zeiten und aller Nationen sich versinigen, häufig aber
nur Bruchstücke aufweisen, welche aus ihrem natür-
lichen Zusammenhange herausgerissen sind. Das dem
Verfasser vorschwebende, mit Werkstätten, nicht nur
mit Zeichenunterricht verbundene Museum sollte das
Charakteristische aus der Kunsttechnik aller Zeiten
und aller Nationen in sich vereinigen, und zwar
unterscheidet das Programm zwischen denjenigen Bei-
spielen, an welchen dis technischen Besonderheiten zu
studiren wären — also Originalarbeiten — und den
Mustern für Formgebung und Ornamentation in Ab-
formungen, graphischen und anderen Nachbildungen
nach den vollendetsten Werken in allen Sammlungen
der Welt.
Etwas wesentlich anderes ist, wie bskannt, das
Kensington-Mpseum geworden. Der Reichtum des
Landes und die Liberalität der dortigen Kunst-
freunde und Sammler haben ihm dsn Besitz einsr
in allen Zweigen bereits unübersehbaren Menge von
Originalen ermöglicht, die noch fort und fort ver-
mehrt wird.
Die einzelnen Stücke sind größtenteils vortreff-
licher Art; aber unter dem Gesichtspunkt des kunst-
technologischen Lehrmaterials muß dis Sammlung
viel zu reich genannt werden. Wo einige Exemplare
genügen würden, um die eigenartige Behandlung eines
gewisssn Stoffes zu veranschaulichsn, sehen wir deren
Dutzende und Hunderte. Während die Masse von
Gegenständen völlig gleicher Natur sin technologischer
und auch in künstlerischer Bsziehung) den Besucher
förmlich erdrückt, verwirren ihn die dem Museum
nur geliehenen Privatsammlungen, welche dessen
eigenem Besitzstande angsreiht sind, ohne doch völlig
in das System zu passen. Getrennte Abteilungsn
enthalten die galvanoplastischen Nachbildungen von
Metallarbsiten und die Gipsabgüsse von plastifchen
Werken in Stein, Holz rc.: beide Abteilungen eben-
salls zu einem sehr bedeutenden Umfang angewachsen
und zum Teil mit Abformungsn angefüllt, deren
Darstellung an einem solchen Orte schwer zu begreifen
ist. So steht beispielswsise ein Abguß der Trajans-
säule in dem Krystallpalast zu Sydenham gewiß an
seinem Platze, wogegen ihre Aufstellung im Kensington-
Museum (noch dazu in zwei Stücken!) kaum von prak-
tischem Nutzen sein kann.
Doch ganz abgssehen von dem Umfang und Jn-
halt der Gipssammlung und der Sammlung von
„Lsxiociuotioiis iu mstai" dünkt uns deren geson-
derter Bestand dem Zwecks nicht entsprechend. Die
Trennung der Gegenstände nach dem Stoffe, aus
welchem sie verfertigt sind, ist bei Arbeiten der orna-
mentalen und gewerblichen Künste so sehr gerecht-
fertigt, daß wenigstens für Sammlungen, welche eine
ausgesprochen didaktische, nicht eine allgemein kultur-
historische Tendenz haben, eine andere Anordnung
kaum denkbar wäre. Aber als unrichtige Anwendung
eines richtigen Grundsatzes erscheint es ebsn mit Rück-
sicht auf den Zweck eines kunstgewerblichen Museums,
wenn Originale und Nachbildungen dsshalb räumlich
geschieden sind, weil für die letzteren ein anderes
Material benutzt worden ist als sür die ersteren.
Selbst in den kunsthistorischen Museen, wo die Son-
derung von Original und Kopie viel eher zu ver-
teidigen sein würde, teilt man jetzt wohl allgemein
Kopien von Gemälden in diejenigen Perioden und
Schulen ein, welchen diese angehören. Diese Original-
arbeiten befinden sich an anderen Ortsn, werdsn je-
doch nicht gern vermißt, wo eine Darstellung des
Ganges der Kunstentwickelung in besonders charak-