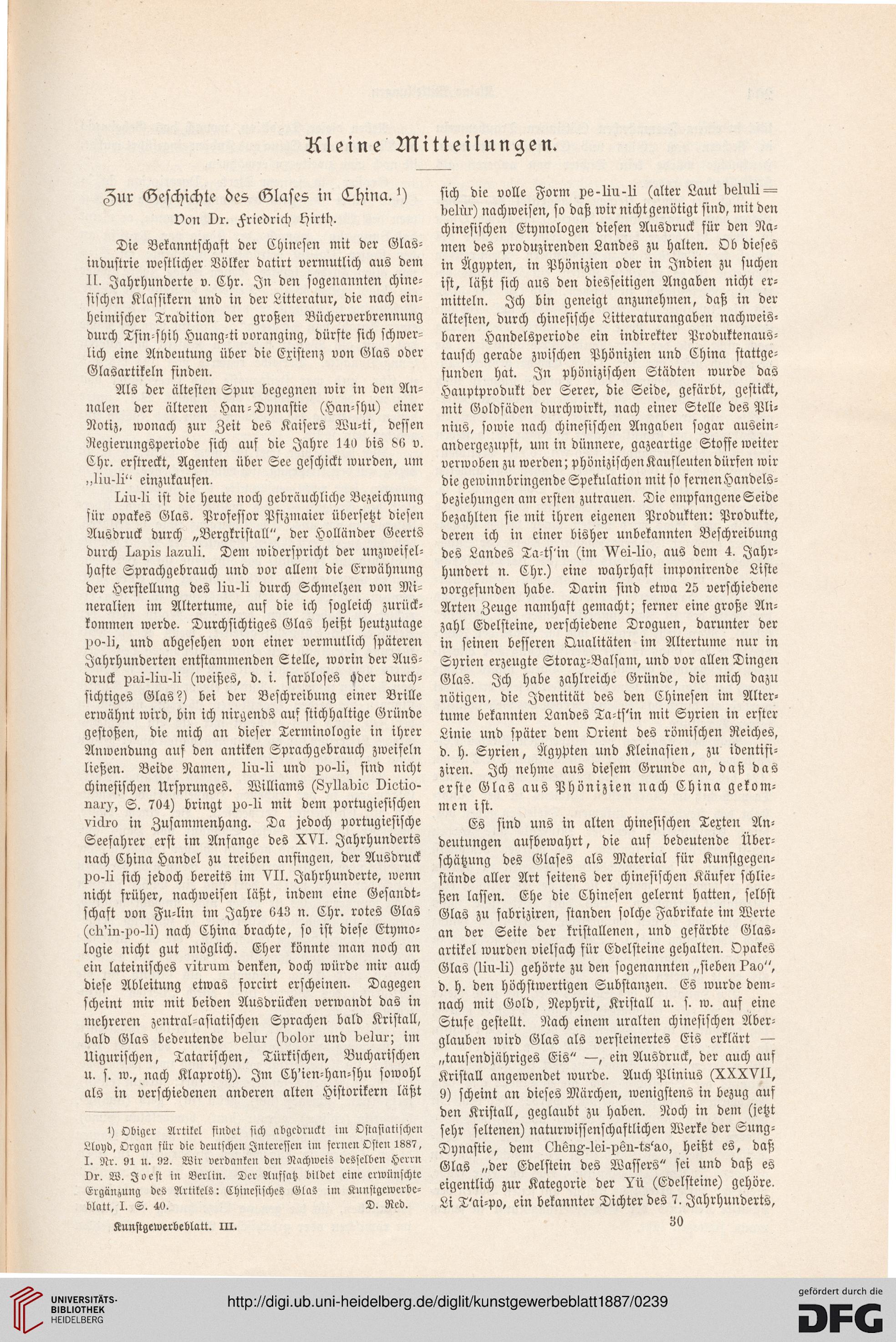Rleine Mitteilungen
Zur Geschichte dcs Glascs i» Lhina.')
Von Or. Friedrich k)irth.
Die Bekanntschaft der Chinesen mit der Glas-
industrie westlicher Völker datirt vermutlich aus dem
ll. Jahrhunderte v. Chr. Jn deu sogenanntsu chine-
sischen Klassikern und in der Litteratur, die nach ein-
heimischer Tradition der großen Bücherverbrennung
durch Tsin-shih Hnang-ti vvranging, dürfte sich schwer-
lich eine Andeutung über die Existenz von Glas oder
Glasartikeln finden.
Als der ältesten Spur begegnen wir in den An-
nalen der älteren Han-Dynastie (Han-shu) einer
Notiz, wonach zur Zeit des Kaisers Wu-ti, dessen
Regisrungsperiode sich auf die Jahre 140 bis 86 v.
Chr. erstreckt, Agenten über See geschickt wurden, um
„liu-Ii" einzukaufen.
Inu-Ii ist die heute »och gebräuchliche Bezeichnung
für opakes Glas. Profsssor Psizmaier übersetzt diesen
Ausdruck durch „Bergkristall", der Holländer Geerts
durch I-upis Iu2uli. Dem widerspricht der unzweifel-
hafte Sprachgebrauch und vor allem dis Erwähnung
der Herstellung des liu-li durch Schmelzen von Mi-
neralien im Altsrtume, auf dis ich sogleich zurück-
kommen werde. Durchsichtiges Glas heißt heutzutage
po-Ii, und abgesehen von einer vermutlich späteren
Jahrhunderten entstammenden Stelle, worin der Aus-
druck pui-Iiu-Ii (weißes, d. i. farbloses öder durch-
sichtiges Glas?) bei der Beschreibung einer Brille
erwähnt wird, bin ich nirgends auf stichhaltige Grllnde
gestoßen, die mich an dieser Terminologie in ihrer
Anwendung auf den antiken Sprachgebrauch zweifeln
ließen. Beide Namen, liu-Ii und xo-Ii, sind nicht
chinesischen Ursprunges. Williams (8g-IIaI>io Oiotio-
narg-, S. 704) bringt po-li mit dem portugiesischen
viäro in Zusammenhang. Da jedoch portugiesische
Seefahrer erst im Anfange des XVI. Jahrhunderts
nach China Handel zu treiben anfingen, der Ausdruck
xo-Ii sich jedoch bereits im VII. Jahrhunderte, wenn
nicht srüher, nachweisen läßt, indem eine Gesandt-
schaft von Fu-lin im Jahre 643 n. Chr. rotes Glas
(otr'iu-po-Ii) nach China brachte, so ist diese Etymo-
logie nicht gut möglich. Eher könnte man noch an
ein lateinisches vitrurn denken, doch würde mir auch
diese Ableitung etwas forcirt erscheinen. Dagegen
scheint mir mit beiden Ausdrllcken verwandt das in
mehreren zentral-asiatischen Sprachen bald Kristall,
bald Glas bedeutende dslur (bolor und dslur; im
Uigurischen, Tatarischen, Türkischen, Bucharischen
u. s. w., nach Klaproth). Jm Ch'ien-han-shu sowohl
als in verschiedenen anderen alten Historikern läßt
>) Obiger Artilel findct sich abgcdruckt im Ostasiatischen
Lloyd, Organ sür die deutschen Jnterefsen im fcrncn Osten 1S87,
I. Str. S1 u. SL. Wtr verdanken den Nachweis desselben Herrn
vr. W. Joest iu Berlin. Dcr Aufsatz bildet cine crwllnschte
Ergänzung dcs Artikels: ChinesischeS Glas im Kunstgewerbe-
blatt, I. S. 4V. D. Red.
Kunstgcwerbcblatt. m.
sich die volle Form xs-Iiu-Ii (alter Laut delnli —
delnr) nachweisen, so daß wir nichtgenötigt sind, mit den
chinesischen Etymologen diesen Ausdruck für den Na-
men des produzirenden Landes zu halten. Ob dieses
in Ägypten, in Phönizien oder in Jndien zu suchen
ist, läßt sich aus den diesseitigen Angaben nicht er-
mitteln. Jch bin geneigt anzunehmen, daß in der
ältesten, durch chinesische Litteraturangaben nachweis-
baren Handelsperiode ein indirekter Produktenaus-
tausch gerade zwischen Phönizien und China stattge-
funden hat. Jn phönizischen Städten wurde das
Hauptprodukt der Serer, die Seide, gefärbt, gestickt,
mit Goldfäden durchwirkt, nach einer Stelle des Pli-
nius, sowie nach chinesischen Angaben sogar ausein-
andergezupft, um in dünnere, gazeartige Stoffe weiter
vorwoben zu werden; phönizischenKaufleutendürfen wir
die gewinnbringendeSpekulation mit so fernenHandels-
beziehungen am ersten zutrauen. Die empfangens Seide
bezahlten sie mit ihren eigenen Produkten: Produkte,
deren ich in einer bisher unbekannten Beschreibung
des Landes Ta-tstin (im IVsi-Uo, aus dem 4. Jahr-
hundert n. Chr.) eine wahrhaft imponirende Liste
vorgefunden habe. Darin sind etwa 25 verschiedene
Arteu Zeuge namhaft gemacht; ferner eins große An-
zahl Edelsteine, verschiedens Droguen, darunter der
in seinen besseren Qualitäten im Altertume nur in
Syrisn erzeugte Storax-Balsam, und vor allen Dingen
Glas. Jch habe zahlreiche Gründe, die mich dazu
nötigen, die Jdentität des den Chinesen im Alter-
tume bekannten Landes Ta-tstin mit Syrien in erster
Linie und später dem Orient des römischen Reiches,
d. h. Syrien, Ägypten und Kleinasien, zu identifi-
ziren. Jch nehme aus diesem Grunde an, daß das
erste Glas aus Phönizien nach China gekom-
men ist.
Es sind uns in alten chinesischen Texten An-
deutungen aufbewahrt, die auf bedeutende Über-
schätzung des Glases als Material für Kunstgegen-
stände aller Art seitsns der chinesischen Käufer schlie-
ßen lassen. Ehe die Chinesen gelernt hatton, selbst
Glas zu fabriziren, standen solche Fabrikate im Werte
an dsr Seite der kristallenen, und gefärbte Glas-
artikel wurden vielsach für Edelsteine gehalten. Opakes
Glas (liu-Ii) gehörte zu den sogenannten „sieben?ao",
d. h. dsn höchstwertigen Substanzen. Es wurde dem-
nach mit Gold, Nephrit, Kristall u. s. w. auf eine
Stufe gestellt. Nach einem uralten chinesischen Äber-
glauben wird Glas als versteinertes Eis erklärt —
„tausendjähriges Eis" —, ein Ausdruck, der auch auf
Kristall augowendet wurde. Auch Plinius (XXXVII,
9) scheint an dieses Märchen, wenigstens in bezug auf
den Kristall, gsglaubt zu haben. Noch in dem (jetzt
sehr seltenen) naturwissenschaftlichen Werke der Sung-
Dynastie, dem Olißn^-lei-xon-ts'ao, heißt es, daß
Glas „der Edelstein des Wassers" sei und daß es
eigentlich zur Kategorie der Vü (Edelsteine) gehöre.
Li T'ai-po, ein bekannter Dichter dss 7. Jahrhunderts,
30
Zur Geschichte dcs Glascs i» Lhina.')
Von Or. Friedrich k)irth.
Die Bekanntschaft der Chinesen mit der Glas-
industrie westlicher Völker datirt vermutlich aus dem
ll. Jahrhunderte v. Chr. Jn deu sogenanntsu chine-
sischen Klassikern und in der Litteratur, die nach ein-
heimischer Tradition der großen Bücherverbrennung
durch Tsin-shih Hnang-ti vvranging, dürfte sich schwer-
lich eine Andeutung über die Existenz von Glas oder
Glasartikeln finden.
Als der ältesten Spur begegnen wir in den An-
nalen der älteren Han-Dynastie (Han-shu) einer
Notiz, wonach zur Zeit des Kaisers Wu-ti, dessen
Regisrungsperiode sich auf die Jahre 140 bis 86 v.
Chr. erstreckt, Agenten über See geschickt wurden, um
„liu-Ii" einzukaufen.
Inu-Ii ist die heute »och gebräuchliche Bezeichnung
für opakes Glas. Profsssor Psizmaier übersetzt diesen
Ausdruck durch „Bergkristall", der Holländer Geerts
durch I-upis Iu2uli. Dem widerspricht der unzweifel-
hafte Sprachgebrauch und vor allem dis Erwähnung
der Herstellung des liu-li durch Schmelzen von Mi-
neralien im Altsrtume, auf dis ich sogleich zurück-
kommen werde. Durchsichtiges Glas heißt heutzutage
po-Ii, und abgesehen von einer vermutlich späteren
Jahrhunderten entstammenden Stelle, worin der Aus-
druck pui-Iiu-Ii (weißes, d. i. farbloses öder durch-
sichtiges Glas?) bei der Beschreibung einer Brille
erwähnt wird, bin ich nirgends auf stichhaltige Grllnde
gestoßen, die mich an dieser Terminologie in ihrer
Anwendung auf den antiken Sprachgebrauch zweifeln
ließen. Beide Namen, liu-Ii und xo-Ii, sind nicht
chinesischen Ursprunges. Williams (8g-IIaI>io Oiotio-
narg-, S. 704) bringt po-li mit dem portugiesischen
viäro in Zusammenhang. Da jedoch portugiesische
Seefahrer erst im Anfange des XVI. Jahrhunderts
nach China Handel zu treiben anfingen, der Ausdruck
xo-Ii sich jedoch bereits im VII. Jahrhunderte, wenn
nicht srüher, nachweisen läßt, indem eine Gesandt-
schaft von Fu-lin im Jahre 643 n. Chr. rotes Glas
(otr'iu-po-Ii) nach China brachte, so ist diese Etymo-
logie nicht gut möglich. Eher könnte man noch an
ein lateinisches vitrurn denken, doch würde mir auch
diese Ableitung etwas forcirt erscheinen. Dagegen
scheint mir mit beiden Ausdrllcken verwandt das in
mehreren zentral-asiatischen Sprachen bald Kristall,
bald Glas bedeutende dslur (bolor und dslur; im
Uigurischen, Tatarischen, Türkischen, Bucharischen
u. s. w., nach Klaproth). Jm Ch'ien-han-shu sowohl
als in verschiedenen anderen alten Historikern läßt
>) Obiger Artilel findct sich abgcdruckt im Ostasiatischen
Lloyd, Organ sür die deutschen Jnterefsen im fcrncn Osten 1S87,
I. Str. S1 u. SL. Wtr verdanken den Nachweis desselben Herrn
vr. W. Joest iu Berlin. Dcr Aufsatz bildet cine crwllnschte
Ergänzung dcs Artikels: ChinesischeS Glas im Kunstgewerbe-
blatt, I. S. 4V. D. Red.
Kunstgcwerbcblatt. m.
sich die volle Form xs-Iiu-Ii (alter Laut delnli —
delnr) nachweisen, so daß wir nichtgenötigt sind, mit den
chinesischen Etymologen diesen Ausdruck für den Na-
men des produzirenden Landes zu halten. Ob dieses
in Ägypten, in Phönizien oder in Jndien zu suchen
ist, läßt sich aus den diesseitigen Angaben nicht er-
mitteln. Jch bin geneigt anzunehmen, daß in der
ältesten, durch chinesische Litteraturangaben nachweis-
baren Handelsperiode ein indirekter Produktenaus-
tausch gerade zwischen Phönizien und China stattge-
funden hat. Jn phönizischen Städten wurde das
Hauptprodukt der Serer, die Seide, gefärbt, gestickt,
mit Goldfäden durchwirkt, nach einer Stelle des Pli-
nius, sowie nach chinesischen Angaben sogar ausein-
andergezupft, um in dünnere, gazeartige Stoffe weiter
vorwoben zu werden; phönizischenKaufleutendürfen wir
die gewinnbringendeSpekulation mit so fernenHandels-
beziehungen am ersten zutrauen. Die empfangens Seide
bezahlten sie mit ihren eigenen Produkten: Produkte,
deren ich in einer bisher unbekannten Beschreibung
des Landes Ta-tstin (im IVsi-Uo, aus dem 4. Jahr-
hundert n. Chr.) eine wahrhaft imponirende Liste
vorgefunden habe. Darin sind etwa 25 verschiedene
Arteu Zeuge namhaft gemacht; ferner eins große An-
zahl Edelsteine, verschiedens Droguen, darunter der
in seinen besseren Qualitäten im Altertume nur in
Syrisn erzeugte Storax-Balsam, und vor allen Dingen
Glas. Jch habe zahlreiche Gründe, die mich dazu
nötigen, die Jdentität des den Chinesen im Alter-
tume bekannten Landes Ta-tstin mit Syrien in erster
Linie und später dem Orient des römischen Reiches,
d. h. Syrien, Ägypten und Kleinasien, zu identifi-
ziren. Jch nehme aus diesem Grunde an, daß das
erste Glas aus Phönizien nach China gekom-
men ist.
Es sind uns in alten chinesischen Texten An-
deutungen aufbewahrt, die auf bedeutende Über-
schätzung des Glases als Material für Kunstgegen-
stände aller Art seitsns der chinesischen Käufer schlie-
ßen lassen. Ehe die Chinesen gelernt hatton, selbst
Glas zu fabriziren, standen solche Fabrikate im Werte
an dsr Seite der kristallenen, und gefärbte Glas-
artikel wurden vielsach für Edelsteine gehalten. Opakes
Glas (liu-Ii) gehörte zu den sogenannten „sieben?ao",
d. h. dsn höchstwertigen Substanzen. Es wurde dem-
nach mit Gold, Nephrit, Kristall u. s. w. auf eine
Stufe gestellt. Nach einem uralten chinesischen Äber-
glauben wird Glas als versteinertes Eis erklärt —
„tausendjähriges Eis" —, ein Ausdruck, der auch auf
Kristall augowendet wurde. Auch Plinius (XXXVII,
9) scheint an dieses Märchen, wenigstens in bezug auf
den Kristall, gsglaubt zu haben. Noch in dem (jetzt
sehr seltenen) naturwissenschaftlichen Werke der Sung-
Dynastie, dem Olißn^-lei-xon-ts'ao, heißt es, daß
Glas „der Edelstein des Wassers" sei und daß es
eigentlich zur Kategorie der Vü (Edelsteine) gehöre.
Li T'ai-po, ein bekannter Dichter dss 7. Jahrhunderts,
30