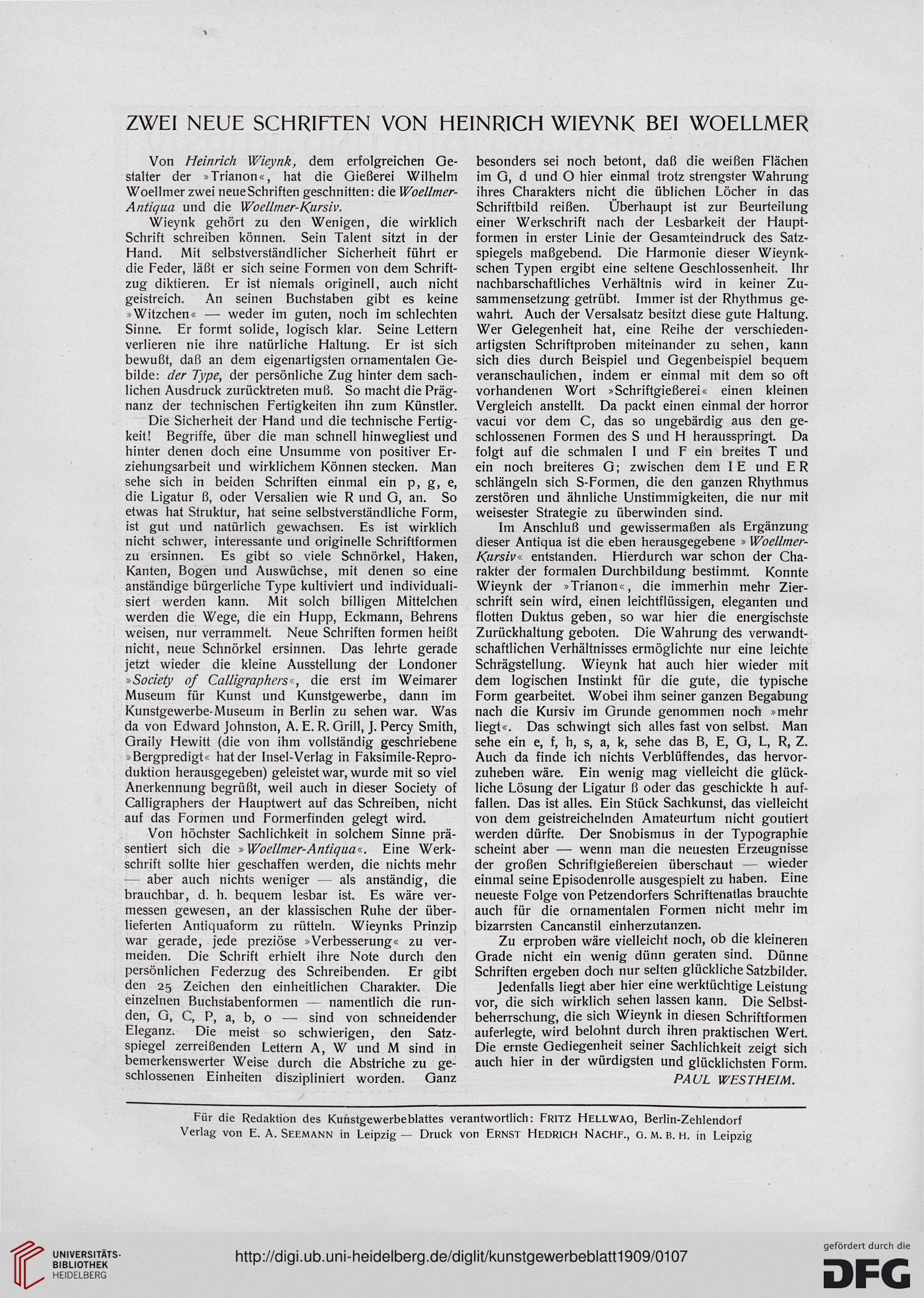ZWEI NEUE SCHRIFTEN VON HEINRICH WIEYNK BEI WOELLMER
Von Heinrich Wieynk, dem erfolgreichen Ge-
stalter der »Trianon«, hat die Gießerei Wilhelm
Woellmer zwei neue Schriften geschnitten: die Woellmer-
Antiqua und die Woellmer-Karsiv.
Wieynk gehört zu den Wenigen, die wirklich
Schrift schreiben können. Sein Talent sitzt in der
Hand. Mit selbstverständlicher Sicherheit führt er
die Feder, läßt er sich seine Formen von dem Schrift-
zug diktieren. Er ist niemals originell, auch nicht
geistreich. An seinen Buchstaben gibt es keine
»Witzchen« — weder im guten, noch im schlechten
Sinne. Er formt solide, logisch klar. Seine Lettern
verlieren nie ihre natürliche Haltung. Er ist sich
bewußt, daß an dem eigenartigsten ornamentalen Ge-
bilde: der Type, der persönliche Zug hinter dem sach-
lichen Ausdruck zurücktreten muß. So macht die Präg-
nanz der technischen Fertigkeiten ihn zum Künstler.
Die Sicherheit der Hand und die technische Fertig-
keit! Begriffe, über die man schnell hinwegliest und
hinter denen doch eine Unsumme von positiver Er-
ziehungsarbeit und wirklichem Können stecken. Man
sehe sich in beiden Schriften einmal ein p, g, e,
die Ligatur ß, oder Versalien wie R und G, an. So
etwas hat Struktur, hat seine selbstverständliche Form,
ist gut und natürlich gewachsen. Es ist wirklich
nicht schwer, interessante und originelle Schriftformen
zu ersinnen. Es gibt so viele Schnörkel, Haken,
Kanten, Bogen und Auswüchse, mit denen so eine
anständige bürgerliche Type kultiviert und individuali-
siert werden kann. Mit solch billigen Mittelchen
werden die Wege, die ein Hupp, Eckmann, Behrens
weisen, nur verrammelt. Neue Schriften formen heißt
nicht, neue Schnörkel ersinnen. Das lehrte gerade
jetzt wieder die kleine Ausstellung der Londoner
»Society of Calligraphers«, die erst im Weimarer
Museum für Kunst und Kunstgewerbe, dann im
Kunstgewerbe-Museum in Berlin zu sehen war. Was
da von Edward Johnston, A. E. R. Grill, J. Percy Smith,
Graily Hewitt (die von ihm vollständig geschriebene
»Bergpredigt« hat der Insel-Verlag in Faksimile-Repro-
duktion herausgegeben) geleistet war, wurde mit so viel
Anerkennung begrüßt, weil auch in dieser Society of
Calligraphers der Hauptwert auf das Schreiben, nicht
auf das Formen und Formerfinden gelegt wird.
Von höchster Sachlichkeit in solchem Sinne prä-
sentiert sich die »Woellmer-Antiqua«. Eine Werk-
schrift sollte hier geschaffen werden, die nichts mehr
— aber auch nichts weniger — als anständig, die
brauchbar, d. h. bequem lesbar ist. Es wäre ver-
messen gewesen, an der klassischen Ruhe der über-
lieferten Antiquaform zu rütteln. Wieynks Prinzip
war gerade, jede preziöse »Verbesserung« zu ver-
meiden. Die Schrift erhielt ihre Note durch den
persönlichen Federzug des Schreibenden. Er gibt
den 25 Zeichen den einheitlichen Charakter. Die
einzelnen Buchstabenformen — namentlich die run-
den, G, C, P, a, b, o — sind von schneidender
Eleganz. Die meist so schwierigen, den Satz-
spiegel zerreißenden Lettern A, W und M sind in
bemerkenswerter Weise durch die Abstriche zu ge-
schlossenen Einheiten diszipliniert worden. Ganz
besonders sei noch betont, daß die weißen Flächen
im G, d und O hier einmal trotz strengster Wahrung
ihres Charakters nicht die üblichen Löcher in das
Schriftbild reißen. Überhaupt ist zur Beurteilung
einer Werkschrift nach der Lesbarkeit der Haupt-
formen in erster Linie der Gesamteindruck des Satz-
spiegels maßgebend. Die Harmonie dieser Wieynk-
schen Typen ergibt eine seltene Geschlossenheit. Ihr
nachbarschaftliches Verhältnis wird in keiner Zu-
sammensetzung getrübt. Immer ist der Rhythmus ge-
wahrt. Auch der Versalsatz besitzt diese gute Haltung.
Wer Gelegenheit hat, eine Reihe der verschieden-
artigsten Schriftproben miteinander zu sehen, kann
sich dies durch Beispiel und Gegenbeispiel bequem
veranschaulichen, indem er einmal mit dem so oft
vorhandenen Wort »Schriftgießerei« einen kleinen
Vergleich anstellt. Da packt einen einmal der horror
vacui vor dem C, das so ungebärdig aus den ge-
schlossenen Formen des S und H herausspringt. Da
folgt auf die schmalen I und F ein breites T und
ein noch breiteres G; zwischen dem IE und ER
schlängeln sich S-Formen, die den ganzen Rhythmus
zerstören und ähnliche Unstimmigkeiten, die nur mit
weisester Strategie zu überwinden sind.
Im Anschluß und gewissermaßen als Ergänzung
dieser Antiqua ist die eben herausgegebene » Woelltner-
Kursiv« entstanden. Hierdurch war schon der Cha-
rakter der formalen Durchbildung bestimmt. Konnte
Wieynk der »Trianon«, die immerhin mehr Zier-
schrift sein wird, einen leichtflüssigen, eleganten und
flotten Duktus geben, so war hier die energischste
Zurückhaltung geboten. Die Wahrung des verwandt-
schaftlichen Verhältnisses ermöglichte nur eine leichte
Schrägstellung. Wieynk hat auch hier wieder mit
dem logischen Instinkt für die gute, die typische
Form gearbeitet. Wobei ihm seiner ganzen Begabung
nach die Kursiv im Grunde genommen noch »mehr
liegt«. Das schwingt sich alles fast von selbst. Man
sehe ein e, f, h, s, a, k, sehe das B, E, G, L, R, Z.
Auch da finde ich nichts Verblüffendes, das hervor-
zuheben wäre. Ein wenig mag vielleicht die glück-
liche Lösung der Ligatur ß oder das geschickte h auf-
fallen. Das ist alles. Ein Stück Sachkunst, das vielleicht
von dem geistreichelnden Amateurtum nicht goutiert
werden dürfte. Der Snobismus in der Typographie
scheint aber — wenn man die neuesten Erzeugnisse
der großen Schriftgießereien überschaut — wieder
einmal seine Episodenrolle ausgespielt zu haben. Eine
neueste Folge von Petzendorfers Schriftenatlas brauchte
auch für die ornamentalen Formen nicht mehr im
bizarrsten Cancanstil einherzutanzen.
Zu erproben wäre vielleicht noch, ob die kleineren
Grade nicht ein wenig dünn geraten sind. Dünne
Schriften ergeben doch nur selten glückliche Satzbilder.
Jedenfalls liegt aber hier eine werktüchtige Leistung
vor, die sich wirklich sehen lassen kann. Die Selbst-
beherrschung, die sich Wieynk in diesen Schriftformen
auferlegte, wird belohnt durch ihren praktischen Wert.
Die ernste Gediegenheit seiner Sachlichkeit zeigt sich
auch hier in der würdigsten und glücklichsten Form.
PAUL WESTHEIM.
Für die Redaktion des Kunstgewerbeblattes verantwortlich: Fritz Hellwao, Berlin-Zehlendorf
Verlag von E. A. Seemann in Leipzig — Druck von Ernst Hedrich Nachf., g. m. b. h. in Leipzig
Von Heinrich Wieynk, dem erfolgreichen Ge-
stalter der »Trianon«, hat die Gießerei Wilhelm
Woellmer zwei neue Schriften geschnitten: die Woellmer-
Antiqua und die Woellmer-Karsiv.
Wieynk gehört zu den Wenigen, die wirklich
Schrift schreiben können. Sein Talent sitzt in der
Hand. Mit selbstverständlicher Sicherheit führt er
die Feder, läßt er sich seine Formen von dem Schrift-
zug diktieren. Er ist niemals originell, auch nicht
geistreich. An seinen Buchstaben gibt es keine
»Witzchen« — weder im guten, noch im schlechten
Sinne. Er formt solide, logisch klar. Seine Lettern
verlieren nie ihre natürliche Haltung. Er ist sich
bewußt, daß an dem eigenartigsten ornamentalen Ge-
bilde: der Type, der persönliche Zug hinter dem sach-
lichen Ausdruck zurücktreten muß. So macht die Präg-
nanz der technischen Fertigkeiten ihn zum Künstler.
Die Sicherheit der Hand und die technische Fertig-
keit! Begriffe, über die man schnell hinwegliest und
hinter denen doch eine Unsumme von positiver Er-
ziehungsarbeit und wirklichem Können stecken. Man
sehe sich in beiden Schriften einmal ein p, g, e,
die Ligatur ß, oder Versalien wie R und G, an. So
etwas hat Struktur, hat seine selbstverständliche Form,
ist gut und natürlich gewachsen. Es ist wirklich
nicht schwer, interessante und originelle Schriftformen
zu ersinnen. Es gibt so viele Schnörkel, Haken,
Kanten, Bogen und Auswüchse, mit denen so eine
anständige bürgerliche Type kultiviert und individuali-
siert werden kann. Mit solch billigen Mittelchen
werden die Wege, die ein Hupp, Eckmann, Behrens
weisen, nur verrammelt. Neue Schriften formen heißt
nicht, neue Schnörkel ersinnen. Das lehrte gerade
jetzt wieder die kleine Ausstellung der Londoner
»Society of Calligraphers«, die erst im Weimarer
Museum für Kunst und Kunstgewerbe, dann im
Kunstgewerbe-Museum in Berlin zu sehen war. Was
da von Edward Johnston, A. E. R. Grill, J. Percy Smith,
Graily Hewitt (die von ihm vollständig geschriebene
»Bergpredigt« hat der Insel-Verlag in Faksimile-Repro-
duktion herausgegeben) geleistet war, wurde mit so viel
Anerkennung begrüßt, weil auch in dieser Society of
Calligraphers der Hauptwert auf das Schreiben, nicht
auf das Formen und Formerfinden gelegt wird.
Von höchster Sachlichkeit in solchem Sinne prä-
sentiert sich die »Woellmer-Antiqua«. Eine Werk-
schrift sollte hier geschaffen werden, die nichts mehr
— aber auch nichts weniger — als anständig, die
brauchbar, d. h. bequem lesbar ist. Es wäre ver-
messen gewesen, an der klassischen Ruhe der über-
lieferten Antiquaform zu rütteln. Wieynks Prinzip
war gerade, jede preziöse »Verbesserung« zu ver-
meiden. Die Schrift erhielt ihre Note durch den
persönlichen Federzug des Schreibenden. Er gibt
den 25 Zeichen den einheitlichen Charakter. Die
einzelnen Buchstabenformen — namentlich die run-
den, G, C, P, a, b, o — sind von schneidender
Eleganz. Die meist so schwierigen, den Satz-
spiegel zerreißenden Lettern A, W und M sind in
bemerkenswerter Weise durch die Abstriche zu ge-
schlossenen Einheiten diszipliniert worden. Ganz
besonders sei noch betont, daß die weißen Flächen
im G, d und O hier einmal trotz strengster Wahrung
ihres Charakters nicht die üblichen Löcher in das
Schriftbild reißen. Überhaupt ist zur Beurteilung
einer Werkschrift nach der Lesbarkeit der Haupt-
formen in erster Linie der Gesamteindruck des Satz-
spiegels maßgebend. Die Harmonie dieser Wieynk-
schen Typen ergibt eine seltene Geschlossenheit. Ihr
nachbarschaftliches Verhältnis wird in keiner Zu-
sammensetzung getrübt. Immer ist der Rhythmus ge-
wahrt. Auch der Versalsatz besitzt diese gute Haltung.
Wer Gelegenheit hat, eine Reihe der verschieden-
artigsten Schriftproben miteinander zu sehen, kann
sich dies durch Beispiel und Gegenbeispiel bequem
veranschaulichen, indem er einmal mit dem so oft
vorhandenen Wort »Schriftgießerei« einen kleinen
Vergleich anstellt. Da packt einen einmal der horror
vacui vor dem C, das so ungebärdig aus den ge-
schlossenen Formen des S und H herausspringt. Da
folgt auf die schmalen I und F ein breites T und
ein noch breiteres G; zwischen dem IE und ER
schlängeln sich S-Formen, die den ganzen Rhythmus
zerstören und ähnliche Unstimmigkeiten, die nur mit
weisester Strategie zu überwinden sind.
Im Anschluß und gewissermaßen als Ergänzung
dieser Antiqua ist die eben herausgegebene » Woelltner-
Kursiv« entstanden. Hierdurch war schon der Cha-
rakter der formalen Durchbildung bestimmt. Konnte
Wieynk der »Trianon«, die immerhin mehr Zier-
schrift sein wird, einen leichtflüssigen, eleganten und
flotten Duktus geben, so war hier die energischste
Zurückhaltung geboten. Die Wahrung des verwandt-
schaftlichen Verhältnisses ermöglichte nur eine leichte
Schrägstellung. Wieynk hat auch hier wieder mit
dem logischen Instinkt für die gute, die typische
Form gearbeitet. Wobei ihm seiner ganzen Begabung
nach die Kursiv im Grunde genommen noch »mehr
liegt«. Das schwingt sich alles fast von selbst. Man
sehe ein e, f, h, s, a, k, sehe das B, E, G, L, R, Z.
Auch da finde ich nichts Verblüffendes, das hervor-
zuheben wäre. Ein wenig mag vielleicht die glück-
liche Lösung der Ligatur ß oder das geschickte h auf-
fallen. Das ist alles. Ein Stück Sachkunst, das vielleicht
von dem geistreichelnden Amateurtum nicht goutiert
werden dürfte. Der Snobismus in der Typographie
scheint aber — wenn man die neuesten Erzeugnisse
der großen Schriftgießereien überschaut — wieder
einmal seine Episodenrolle ausgespielt zu haben. Eine
neueste Folge von Petzendorfers Schriftenatlas brauchte
auch für die ornamentalen Formen nicht mehr im
bizarrsten Cancanstil einherzutanzen.
Zu erproben wäre vielleicht noch, ob die kleineren
Grade nicht ein wenig dünn geraten sind. Dünne
Schriften ergeben doch nur selten glückliche Satzbilder.
Jedenfalls liegt aber hier eine werktüchtige Leistung
vor, die sich wirklich sehen lassen kann. Die Selbst-
beherrschung, die sich Wieynk in diesen Schriftformen
auferlegte, wird belohnt durch ihren praktischen Wert.
Die ernste Gediegenheit seiner Sachlichkeit zeigt sich
auch hier in der würdigsten und glücklichsten Form.
PAUL WESTHEIM.
Für die Redaktion des Kunstgewerbeblattes verantwortlich: Fritz Hellwao, Berlin-Zehlendorf
Verlag von E. A. Seemann in Leipzig — Druck von Ernst Hedrich Nachf., g. m. b. h. in Leipzig