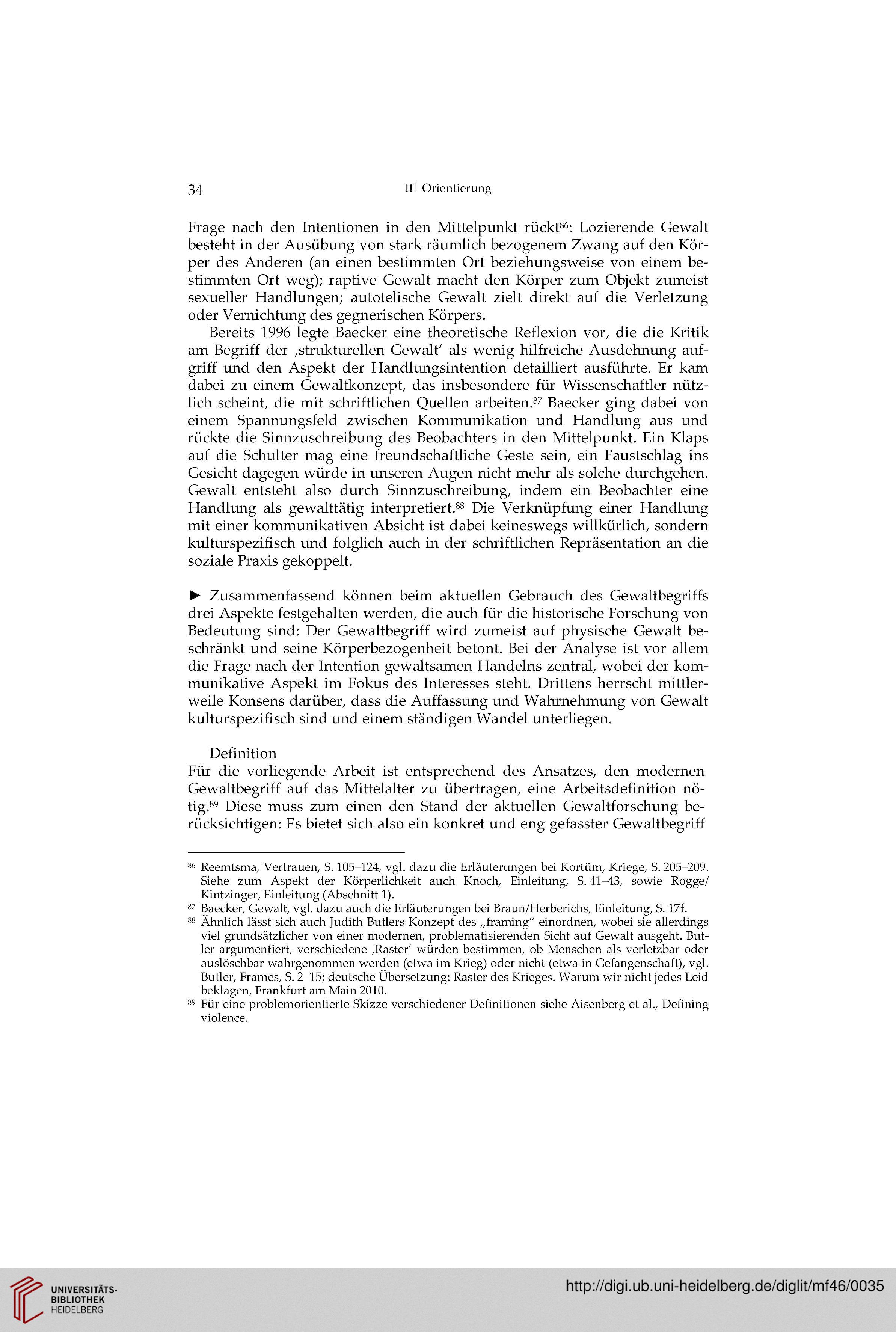34
III Orientierung
Frage nach den Intentionen in den Mittelpunkt rückt^: Lozierende Gewalt
besteht in der Ausübung von stark räumlich bezogenem Zwang auf den Kör-
per des Anderen (an einen bestimmten Ort beziehungsweise von einem be-
stimmten Ort weg); raptive Gewalt macht den Körper zum Objekt zumeist
sexueller Handlungen; autotelische Gewalt zielt direkt auf die Verletzung
oder Vernichtung des gegnerischen Körpers.
Bereits 1996 legte Baecker eine theoretische Reflexion vor, die die Kritik
am Begriff der , strukturellen Gewalt' als wenig hilfreiche Ausdehnung auf-
griff und den Aspekt der Handlungsintention detailliert ausführte. Er kam
dabei zu einem Gewaltkonzept, das insbesondere für Wissenschaftler nütz-
lich scheint, die mit schriftlichen Quellen arbeiten.^ Baecker ging dabei von
einem Spannungsfeld zwischen Kommunikation und Handlung aus und
rückte die Sinnzuschreibung des Beobachters in den Mittelpunkt. Ein Klaps
auf die Schulter mag eine freundschaftliche Geste sein, ein Faustschlag ins
Gesicht dagegen würde in unseren Augen nicht mehr als solche durchgehen.
Gewalt entsteht also durch Sinnzuschreibung, indem ein Beobachter eine
Handlung als gewalttätig interpretiert.^ Die Verknüpfung einer Handlung
mit einer kommunikativen Absicht ist dabei keineswegs willkürlich, sondern
kulturspezifisch und folglich auch in der schriftlichen Repräsentation an die
soziale Praxis gekoppelt.
Zusammenfassend können beim aktuellen Gebrauch des Gewaltbegriffs
drei Aspekte festgehalten werden, die auch für die historische Forschung von
Bedeutung sind: Der Gewaltbegriff wird zumeist auf physische Gewalt be-
schränkt und seine Körperbezogenheit betont. Bei der Analyse ist vor allem
die Frage nach der Intention gewaltsamen Handelns zentral, wobei der kom-
munikative Aspekt im Fokus des Interesses steht. Drittens herrscht mittler-
weile Konsens darüber, dass die Auffassung und Wahrnehmung von Gewalt
kulturspezifisch sind und einem ständigen Wandel unterliegen.
Definition
Für die vorliegende Arbeit ist entsprechend des Ansatzes, den modernen
Gewaltbegriff auf das Mittelalter zu übertragen, eine Arbeitsdefinition nö-
tig.^ Diese muss zum einen den Stand der aktuellen Gewaltforschung be-
rücksichtigen: Es bietet sich also ein konkret und eng gefasster Gewaltbegriff
86 Reemtsma, Vertrauen, S. 105-124, vgl. dazu die Erläuterungen bei Kortüm, Kriege, S. 205-209.
Siehe zum Aspekt der Körperlichkeit auch Knoch, Einleitung, S. 41-43, sowie Rogge/
Kintzinger, Einleitung (Abschnitt 1).
87 Baecker, Gewalt, vgl. dazu auch die Erläuterungen bei Braun/Herberichs, Einleitung, S. 17f.
88 Ähnlich lässt sich auch ludith Butlers Konzept des „framing" einordnen, wobei sie allerdings
viel grundsätzlicher von einer modernen, problematisierenden Sicht auf Gewalt ausgeht. But-
ler argumentiert, verschiedene ,Raster' würden bestimmen, ob Menschen als verletzbar oder
auslöschbar wahrgenommen werden (etwa im Krieg) oder nicht (etwa in Gefangenschaft), vgl.
Butler, Frames, S. 2-15; deutsche Übersetzung: Raster des Krieges. Warum wir nicht jedes Leid
beklagen, Frankfurt am Main 2010.
89 Für eine problemorientierte Skizze verschiedener Definitionen siehe Aisenberg et al., Defining
violence.
III Orientierung
Frage nach den Intentionen in den Mittelpunkt rückt^: Lozierende Gewalt
besteht in der Ausübung von stark räumlich bezogenem Zwang auf den Kör-
per des Anderen (an einen bestimmten Ort beziehungsweise von einem be-
stimmten Ort weg); raptive Gewalt macht den Körper zum Objekt zumeist
sexueller Handlungen; autotelische Gewalt zielt direkt auf die Verletzung
oder Vernichtung des gegnerischen Körpers.
Bereits 1996 legte Baecker eine theoretische Reflexion vor, die die Kritik
am Begriff der , strukturellen Gewalt' als wenig hilfreiche Ausdehnung auf-
griff und den Aspekt der Handlungsintention detailliert ausführte. Er kam
dabei zu einem Gewaltkonzept, das insbesondere für Wissenschaftler nütz-
lich scheint, die mit schriftlichen Quellen arbeiten.^ Baecker ging dabei von
einem Spannungsfeld zwischen Kommunikation und Handlung aus und
rückte die Sinnzuschreibung des Beobachters in den Mittelpunkt. Ein Klaps
auf die Schulter mag eine freundschaftliche Geste sein, ein Faustschlag ins
Gesicht dagegen würde in unseren Augen nicht mehr als solche durchgehen.
Gewalt entsteht also durch Sinnzuschreibung, indem ein Beobachter eine
Handlung als gewalttätig interpretiert.^ Die Verknüpfung einer Handlung
mit einer kommunikativen Absicht ist dabei keineswegs willkürlich, sondern
kulturspezifisch und folglich auch in der schriftlichen Repräsentation an die
soziale Praxis gekoppelt.
Zusammenfassend können beim aktuellen Gebrauch des Gewaltbegriffs
drei Aspekte festgehalten werden, die auch für die historische Forschung von
Bedeutung sind: Der Gewaltbegriff wird zumeist auf physische Gewalt be-
schränkt und seine Körperbezogenheit betont. Bei der Analyse ist vor allem
die Frage nach der Intention gewaltsamen Handelns zentral, wobei der kom-
munikative Aspekt im Fokus des Interesses steht. Drittens herrscht mittler-
weile Konsens darüber, dass die Auffassung und Wahrnehmung von Gewalt
kulturspezifisch sind und einem ständigen Wandel unterliegen.
Definition
Für die vorliegende Arbeit ist entsprechend des Ansatzes, den modernen
Gewaltbegriff auf das Mittelalter zu übertragen, eine Arbeitsdefinition nö-
tig.^ Diese muss zum einen den Stand der aktuellen Gewaltforschung be-
rücksichtigen: Es bietet sich also ein konkret und eng gefasster Gewaltbegriff
86 Reemtsma, Vertrauen, S. 105-124, vgl. dazu die Erläuterungen bei Kortüm, Kriege, S. 205-209.
Siehe zum Aspekt der Körperlichkeit auch Knoch, Einleitung, S. 41-43, sowie Rogge/
Kintzinger, Einleitung (Abschnitt 1).
87 Baecker, Gewalt, vgl. dazu auch die Erläuterungen bei Braun/Herberichs, Einleitung, S. 17f.
88 Ähnlich lässt sich auch ludith Butlers Konzept des „framing" einordnen, wobei sie allerdings
viel grundsätzlicher von einer modernen, problematisierenden Sicht auf Gewalt ausgeht. But-
ler argumentiert, verschiedene ,Raster' würden bestimmen, ob Menschen als verletzbar oder
auslöschbar wahrgenommen werden (etwa im Krieg) oder nicht (etwa in Gefangenschaft), vgl.
Butler, Frames, S. 2-15; deutsche Übersetzung: Raster des Krieges. Warum wir nicht jedes Leid
beklagen, Frankfurt am Main 2010.
89 Für eine problemorientierte Skizze verschiedener Definitionen siehe Aisenberg et al., Defining
violence.