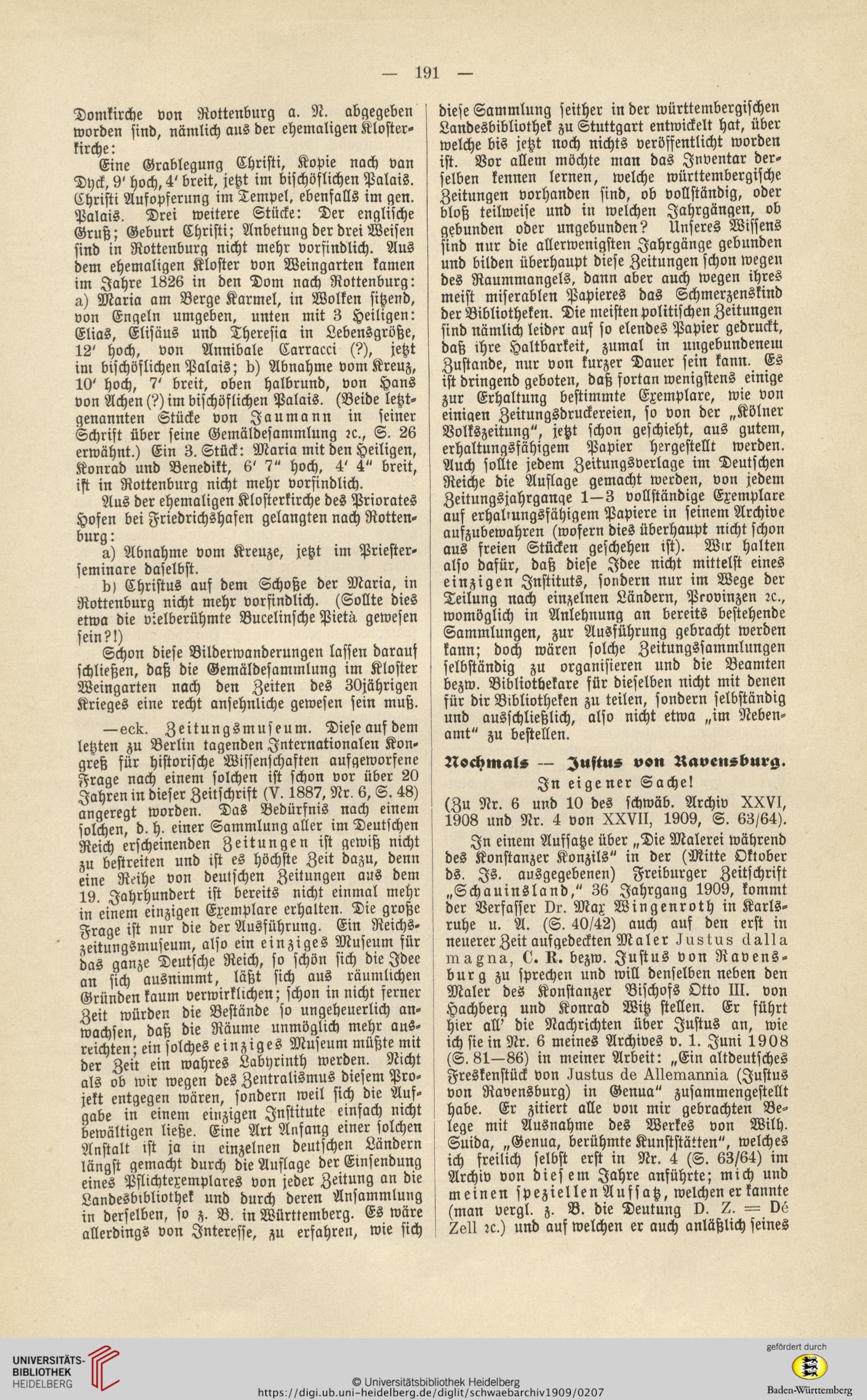191
Domkirche von Rottenburg a. N. abgegeben
worden sind, nämlich aus der ehemaligen Kloster-
kirche :
Eine Grablegung Christi, Kopie nach van
Dyck, 9' hoch, 4' breit, jetzt im bischöflichen Palais.
Christi Aufopferung im Tempel, ebenfalls im gen.
Palais. Drei weitere Stücke: Der englische
Gruß; Geburt Christi; Anbetung der drei Weisen
sind in Rottenburg nicht mehr vorsindlich. Aus
dem ehemaligen Kloster von Weingarten kamen
im Jahre 1826 in den Dom nach Rottenburg:
u) Maria am Berge Karmel, in Wolken sitzend,
von Engeln umgeben, unten mit 3 Heiligen:
Elias, Elisäus und Theresia in Lebensgröße,
12' hoch, von Annibale Carracci (?), jetzt
im bischöflichen Palais; d) Abnahme vom Kreuz,
10' hoch, 7' breit, oben halbrund, von Hans
von Achen (?) im bischöflichen Palais. (Beide letzt-
genannten Stücke von Jaumann in seiner
Schrift über seine Gemäldesammlung re., S. 26
erwähnt.) Ein 3. Stück: Maria mit den Heiligen,
Konrad und Benedikt, 6' 7" hoch, 4' 4" breit,
ist in Rottenburg nicht mehr vorsindlich.
Aus der ehemaligen Klosterkirche des Priorates
Hosen bei Friedrichshafen gelangten nach Rotten-
burg:
s.) Abnahme vom Kreuze, jetzt im Priester-
seminare daselbst.
bj Christus auf dem Schoße der Maria, in
Rottenburg nicht mehr vorsindlich. (Sollte dies
etwa die vielberühmte Bucelinsche Pieta gewesen
sein?!)
Schon diese Bilderwanderungen lassen darauf
schließen, daß die Gemäldesammlung im Kloster
Weingarten nach den Zeiten des 30jährigen
Krieges eine recht ansehnliche gewesen sein muß.
—sek. Zeitungsmuseum. Diese auf dem
letzten zu Berlin tagenden Internationalen Kon-
greß für historische Wissenschaften aufgeworfene
Frage nach einem solchen ist schon vor über 20
Jahren in dieser Zeitschrift (V. 1887, Nr. 6, S. 48)
angeregt worden. Das Bedürfnis nach einem
solchen, d. h. einer Sammlung aller im Deutschen
Reich erscheinenden Zeitungen ist gewiß nicht
zu bestreiten und ist es höchste Zeit dazu, denn
eine Reihe von deutschen Zeitungen aus dem
19. Jahrhundert ist bereits nicht einmal mehr
in einem einzigen Exemplare erhalten. Die große
Frage ist nur die der Ausführung. Ein Reichs-
zeitungsmuseum, also ein einziges Museum für
das ganze Deutsche Reich, so schön sich die Idee
an sich ausnimmt, läßt sich aus räumlichen
Gründen kaum verwirklichen; schon in nicht ferner
Zeit würden die Bestände so ungeheuerlich an-
wachsen, daß die Räume unmöglich mehr aus-
reichten ; ein solches einziges Museum müßte mit
der Zeil ein wahres Labyrinth werden. Nicht
als ob wir wegen des Zentralismus diesem Pro-
jekt entgegen wären, sondern weil sich die Auf-
gabe in einem einzigen Institute einfach nicht
bewältigen ließe. Eine Art Anfang einer solchen
Anstalt ist ja in einzelnen deutschen Ländern
längst gemacht durch die Auflage der Einsendung
eines Pflichtexemplares von jeder Zeitung an die
Landesbibliothek und durch deren Ansammlung
in derselben, so z. B. in Württemberg. Es wäre
allerdings von Interesse, zu erfahren, wie sich
diese Sammlung seither in der württembergischen
Landesbibliothek zu Stuttgart entwickelt hat, über
welche bis jetzt noch nichts veröffentlicht worden
ist. Vor allem möchte man das Inventar der-
selben kennen lernen, welche württembergische
Zeitungen vorhanden sind, ob vollständig, oder
bloß teilweise und in welchen Jahrgängen, ob
gebunden oder ungebunden? Unseres Wissens
sind nur die allerwenigsten Jahrgänge gebunden
und bilden überhaupt diese Zeitungen schon wegen
des Raummangels, dann aber auch wegen ihres
meist miserablen Papieres das Schmerzenskind
der Bibliotheken. Die meisten politischen Zeitungen
sind nämlich leider auf so elendes Papier gedruckt,
daß ihre Haltbarkeit, zumal in ungebundenem
Zustande, nur von kurzer Dauer sein kann. Es
ist dringend geboten, daß fortan wenigstens einige
zur Erhaltung bestimmte Exemplare, wie von
einiqen Zeikungsdruckereien, so von der „Kölner
Volkszeitung", jetzt schon geschieht, aus gutem,
erhaltungsfähigem Papier hergestellt werden.
Auch sollte jedem Zeitungsverlage im Deutschen
Reiche die Auflage gemacht werden, von jedem
Zeitungsjahrganqe 1—3 vollständige Exemplare
auf erhal'ungsfähigem Papiere in seinem Archive
aufzubewahren (wofern dies überhaupt nicht schon
aus freien Stücken geschehen ist). Ww halten
also dafür, daß diese Idee nicht mittelst eines
einzigen Instituts, sondern nur im Wege der
Teilung nach einzelnen Ländern, Provinzen rc.,
womöglich in Anlehnung an bereits bestehende
Sammlungen, zur Ausführung gebracht werden
kann; doch wären solche Zeitungssammlungen
selbständig zu organisieren und die Beamten
bezw. Bibliothekare für dieselben nicht mit denen
für dir Bibliotheken zu teilen, sondern selbständig
und ausschließlich, also nicht etwa „im Neben-
amt" zu bestellen.
Nochmal» — Justus von Ravensburg.
In eigener Sache!
(Zu Nr. 6 und 10 des schwäb. Archiv XXVI,
1908 und Nr. 4 von XXVIl, 1909, S. 63/64).
In einem Aussatze über „Die Malerei während
des Konstanzer Konzils" in der (Mitte Oktober
ds. Js. ausgegebenen) Freiburger Zeitschrift
„Schauinsland," 36 Jahrgang 1909, kommt
der Verfasser Or. Max Wingenroth in Karls-
ruhe u. A. (S. 40/42) auch aus den erst in
neuerer Zeit aufgedeckten Maler llustus llallu
inuAna, 6. R. bezw. Justus von Ravens-
burg zu sprechen und will denselben neben den
Maler des Konstanzer Bischofs Otto III. von
Hachberg und Konrad Witz stellen. Er führt
hier all' die Nachrichten über Justus an, wie
ich sie in Nr. 6 meines Archives v. 1. Juni 1908
(S. 81—86) in meiner Arbeit: „Ein altdeutsches
Freskenstück von llustus äs Lllomunniu (Justus
von Ravensburg) in Genua" zusammengestellt
habe. Er zitiert alle von mir gebrachten Be-
lege mit Ausnahme des Werkes von Wilh.
Suida, „Genua, berühmte Kunststätten", welches
ich freilich selbst erst in Nr. 4 (S. 63/64) im
Archiv von diesem Jahre anführte; mich und
meinen speziellen Aufsatz, welchen er kannte
(man vergl. z. B. die Deutung 0. X. — l)ö
2sII rc.) und auf welchen er auch anläßlich seines
Domkirche von Rottenburg a. N. abgegeben
worden sind, nämlich aus der ehemaligen Kloster-
kirche :
Eine Grablegung Christi, Kopie nach van
Dyck, 9' hoch, 4' breit, jetzt im bischöflichen Palais.
Christi Aufopferung im Tempel, ebenfalls im gen.
Palais. Drei weitere Stücke: Der englische
Gruß; Geburt Christi; Anbetung der drei Weisen
sind in Rottenburg nicht mehr vorsindlich. Aus
dem ehemaligen Kloster von Weingarten kamen
im Jahre 1826 in den Dom nach Rottenburg:
u) Maria am Berge Karmel, in Wolken sitzend,
von Engeln umgeben, unten mit 3 Heiligen:
Elias, Elisäus und Theresia in Lebensgröße,
12' hoch, von Annibale Carracci (?), jetzt
im bischöflichen Palais; d) Abnahme vom Kreuz,
10' hoch, 7' breit, oben halbrund, von Hans
von Achen (?) im bischöflichen Palais. (Beide letzt-
genannten Stücke von Jaumann in seiner
Schrift über seine Gemäldesammlung re., S. 26
erwähnt.) Ein 3. Stück: Maria mit den Heiligen,
Konrad und Benedikt, 6' 7" hoch, 4' 4" breit,
ist in Rottenburg nicht mehr vorsindlich.
Aus der ehemaligen Klosterkirche des Priorates
Hosen bei Friedrichshafen gelangten nach Rotten-
burg:
s.) Abnahme vom Kreuze, jetzt im Priester-
seminare daselbst.
bj Christus auf dem Schoße der Maria, in
Rottenburg nicht mehr vorsindlich. (Sollte dies
etwa die vielberühmte Bucelinsche Pieta gewesen
sein?!)
Schon diese Bilderwanderungen lassen darauf
schließen, daß die Gemäldesammlung im Kloster
Weingarten nach den Zeiten des 30jährigen
Krieges eine recht ansehnliche gewesen sein muß.
—sek. Zeitungsmuseum. Diese auf dem
letzten zu Berlin tagenden Internationalen Kon-
greß für historische Wissenschaften aufgeworfene
Frage nach einem solchen ist schon vor über 20
Jahren in dieser Zeitschrift (V. 1887, Nr. 6, S. 48)
angeregt worden. Das Bedürfnis nach einem
solchen, d. h. einer Sammlung aller im Deutschen
Reich erscheinenden Zeitungen ist gewiß nicht
zu bestreiten und ist es höchste Zeit dazu, denn
eine Reihe von deutschen Zeitungen aus dem
19. Jahrhundert ist bereits nicht einmal mehr
in einem einzigen Exemplare erhalten. Die große
Frage ist nur die der Ausführung. Ein Reichs-
zeitungsmuseum, also ein einziges Museum für
das ganze Deutsche Reich, so schön sich die Idee
an sich ausnimmt, läßt sich aus räumlichen
Gründen kaum verwirklichen; schon in nicht ferner
Zeit würden die Bestände so ungeheuerlich an-
wachsen, daß die Räume unmöglich mehr aus-
reichten ; ein solches einziges Museum müßte mit
der Zeil ein wahres Labyrinth werden. Nicht
als ob wir wegen des Zentralismus diesem Pro-
jekt entgegen wären, sondern weil sich die Auf-
gabe in einem einzigen Institute einfach nicht
bewältigen ließe. Eine Art Anfang einer solchen
Anstalt ist ja in einzelnen deutschen Ländern
längst gemacht durch die Auflage der Einsendung
eines Pflichtexemplares von jeder Zeitung an die
Landesbibliothek und durch deren Ansammlung
in derselben, so z. B. in Württemberg. Es wäre
allerdings von Interesse, zu erfahren, wie sich
diese Sammlung seither in der württembergischen
Landesbibliothek zu Stuttgart entwickelt hat, über
welche bis jetzt noch nichts veröffentlicht worden
ist. Vor allem möchte man das Inventar der-
selben kennen lernen, welche württembergische
Zeitungen vorhanden sind, ob vollständig, oder
bloß teilweise und in welchen Jahrgängen, ob
gebunden oder ungebunden? Unseres Wissens
sind nur die allerwenigsten Jahrgänge gebunden
und bilden überhaupt diese Zeitungen schon wegen
des Raummangels, dann aber auch wegen ihres
meist miserablen Papieres das Schmerzenskind
der Bibliotheken. Die meisten politischen Zeitungen
sind nämlich leider auf so elendes Papier gedruckt,
daß ihre Haltbarkeit, zumal in ungebundenem
Zustande, nur von kurzer Dauer sein kann. Es
ist dringend geboten, daß fortan wenigstens einige
zur Erhaltung bestimmte Exemplare, wie von
einiqen Zeikungsdruckereien, so von der „Kölner
Volkszeitung", jetzt schon geschieht, aus gutem,
erhaltungsfähigem Papier hergestellt werden.
Auch sollte jedem Zeitungsverlage im Deutschen
Reiche die Auflage gemacht werden, von jedem
Zeitungsjahrganqe 1—3 vollständige Exemplare
auf erhal'ungsfähigem Papiere in seinem Archive
aufzubewahren (wofern dies überhaupt nicht schon
aus freien Stücken geschehen ist). Ww halten
also dafür, daß diese Idee nicht mittelst eines
einzigen Instituts, sondern nur im Wege der
Teilung nach einzelnen Ländern, Provinzen rc.,
womöglich in Anlehnung an bereits bestehende
Sammlungen, zur Ausführung gebracht werden
kann; doch wären solche Zeitungssammlungen
selbständig zu organisieren und die Beamten
bezw. Bibliothekare für dieselben nicht mit denen
für dir Bibliotheken zu teilen, sondern selbständig
und ausschließlich, also nicht etwa „im Neben-
amt" zu bestellen.
Nochmal» — Justus von Ravensburg.
In eigener Sache!
(Zu Nr. 6 und 10 des schwäb. Archiv XXVI,
1908 und Nr. 4 von XXVIl, 1909, S. 63/64).
In einem Aussatze über „Die Malerei während
des Konstanzer Konzils" in der (Mitte Oktober
ds. Js. ausgegebenen) Freiburger Zeitschrift
„Schauinsland," 36 Jahrgang 1909, kommt
der Verfasser Or. Max Wingenroth in Karls-
ruhe u. A. (S. 40/42) auch aus den erst in
neuerer Zeit aufgedeckten Maler llustus llallu
inuAna, 6. R. bezw. Justus von Ravens-
burg zu sprechen und will denselben neben den
Maler des Konstanzer Bischofs Otto III. von
Hachberg und Konrad Witz stellen. Er führt
hier all' die Nachrichten über Justus an, wie
ich sie in Nr. 6 meines Archives v. 1. Juni 1908
(S. 81—86) in meiner Arbeit: „Ein altdeutsches
Freskenstück von llustus äs Lllomunniu (Justus
von Ravensburg) in Genua" zusammengestellt
habe. Er zitiert alle von mir gebrachten Be-
lege mit Ausnahme des Werkes von Wilh.
Suida, „Genua, berühmte Kunststätten", welches
ich freilich selbst erst in Nr. 4 (S. 63/64) im
Archiv von diesem Jahre anführte; mich und
meinen speziellen Aufsatz, welchen er kannte
(man vergl. z. B. die Deutung 0. X. — l)ö
2sII rc.) und auf welchen er auch anläßlich seines