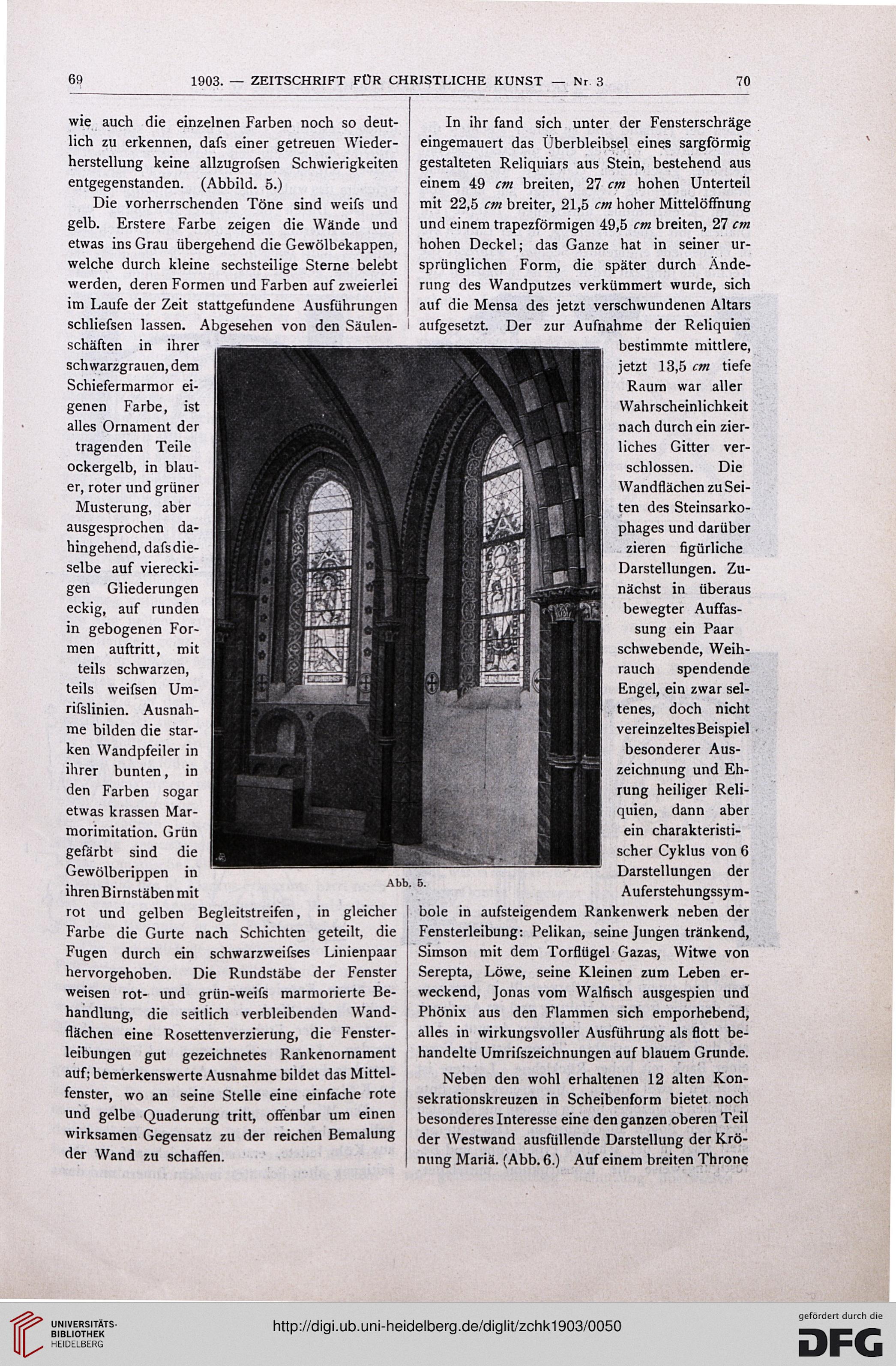69
1903.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 3
70
wie auch die einzelnen Farben noch so deut-
lich zu erkennen, dafs einer getreuen Wieder-
herstellung keine allzugrofsen Schwierigkeiten
entgegenstanden. (Abbild. 5.)
Die vorherrschenden Töne sind weifs und
gelb. Erstere Farbe zeigen die Wände und
etwas ins Grau übergehend die Gewölbekappen,
welche durch kleine sechsteilige Sterne belebt
werden, deren Formen und Farben auf zweierlei
im Laufe der Zeit stattgefundene Ausführungen
schliefsen lassen. Abgesehen von den Säulen-
schäften in ihrer
schwarzgrauen, dem
Schiefermarmor ei-
genen Farbe, ist
alles Ornament der
tragenden Teile
ockergelb, in blau-
er, roter und grüner
Musterung, aber
ausgesprochen da-
hingehend, dafs die-
selbe auf vierecki-
gen Gliederungen
eckig, auf runden
in gebogenen For-
men auftritt, mit
teils schwarzen,
teils weifsen Um-
rifslinien. Ausnah-
me bilden die star-
ken Wandpfeiler in
ihrer bunten, in
den Farben sogar
etwas krassen Mar-
morimitation. Grün
gefärbt sind die
Gewölberippen in
ihren Birnstäben mit
rot und gelben Begleitstreifen, in gleicher
Farbe die Gurte nach Schichten geteilt, die
Fugen durch ein schwarzweifses Linienpaar
hervorgehoben. Die Rundstäbe der Fenster
weisen rot- und grün-weifs marmorierte Be-
handlung, die seitlich verbleibenden Wand-
flächen eine Rosettenverzierung, die Fenster-
leibungen gut gezeichnetes Rankenornament
auf; bemerkenswerte Ausnahme bildet das Mittel-
fenster, wo an seine Stelle eine einfache rote
und gelbe Quaderung tritt, offenbar um einen
wirksamen Gegensatz zu der reichen Bemalung
der Wand zu schaffen.
Abb. 5.
In ihr fand sich unter der Fensterschräge
eingemauert das Überbleibsel eines sargförmig
gestalteten Reliquiars aus Stein, bestehend aus
einem 49 cm breiten, 27 cm hohen Unterteil
mit 22,5 cm breiter, 21,5 cm hoher Mittelöffnung
und einem trapezförmigen 49,5 cm breiten, 27 cm
hohen Deckel; das Ganze hat in seiner ur-
sprünglichen Form, die später durch Ände-
rung des Wandputzes verkümmert wurde, sich
auf die Mensa des jetzt verschwundenen Altars
aufgesetzt. Der zur Aufnahme der Reliquien
bestimmte mittlere,
jetzt 13,5 cm tiefe
Raum war aller
Wahrscheinlichkeit
nach durch ein zier-
liches Gitter ver-
schlossen. Die
Wandflächen zu Sei-
ten des Steinsarko-
phages und darüber
zieren figürliche
Darstellungen. Zu-
nächst in überaus
bewegter Auffas-
sung ein Paar
schwebende, Weih-
rauch spendende
Engel, ein zwar sel-
tenes, doch nicht
vereinzeltes Beispiel
besonderer Aus-
zeichnung und Eh-
rung heiliger Reli-
quien, dann aber
ein charakteristi-
scher Cyklus von 6
Darstellungen der
Auferstehungssym-
bole in aufsteigendem Rankenwerk neben der
Fensterleibung: Pelikan, seine Jungen tränkend,
Simson mit dem Torflügel Gazas, Witwe von
Serepta, Löwe, seine Kleinen zum Leben er-
weckend, Jonas vom Walfisch ausgespien und
Phönix aus den Flammen sich emporhebend,
alles in wirkungsvoller Ausführung als flott be-
handelte Umrifszeichnungen auf blauem Grunde.
Neben den wohl erhaltenen 12 alten Kon-
sekrationskreuzen in Scheibenform bietet noch
besonderes Interesse eine den ganzen oberen Teil
der Westwand ausfüllende Darstellung der Krö-
nung Maria. (Abb. 6.) Auf einem breiten Throne
1903.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr 3
70
wie auch die einzelnen Farben noch so deut-
lich zu erkennen, dafs einer getreuen Wieder-
herstellung keine allzugrofsen Schwierigkeiten
entgegenstanden. (Abbild. 5.)
Die vorherrschenden Töne sind weifs und
gelb. Erstere Farbe zeigen die Wände und
etwas ins Grau übergehend die Gewölbekappen,
welche durch kleine sechsteilige Sterne belebt
werden, deren Formen und Farben auf zweierlei
im Laufe der Zeit stattgefundene Ausführungen
schliefsen lassen. Abgesehen von den Säulen-
schäften in ihrer
schwarzgrauen, dem
Schiefermarmor ei-
genen Farbe, ist
alles Ornament der
tragenden Teile
ockergelb, in blau-
er, roter und grüner
Musterung, aber
ausgesprochen da-
hingehend, dafs die-
selbe auf vierecki-
gen Gliederungen
eckig, auf runden
in gebogenen For-
men auftritt, mit
teils schwarzen,
teils weifsen Um-
rifslinien. Ausnah-
me bilden die star-
ken Wandpfeiler in
ihrer bunten, in
den Farben sogar
etwas krassen Mar-
morimitation. Grün
gefärbt sind die
Gewölberippen in
ihren Birnstäben mit
rot und gelben Begleitstreifen, in gleicher
Farbe die Gurte nach Schichten geteilt, die
Fugen durch ein schwarzweifses Linienpaar
hervorgehoben. Die Rundstäbe der Fenster
weisen rot- und grün-weifs marmorierte Be-
handlung, die seitlich verbleibenden Wand-
flächen eine Rosettenverzierung, die Fenster-
leibungen gut gezeichnetes Rankenornament
auf; bemerkenswerte Ausnahme bildet das Mittel-
fenster, wo an seine Stelle eine einfache rote
und gelbe Quaderung tritt, offenbar um einen
wirksamen Gegensatz zu der reichen Bemalung
der Wand zu schaffen.
Abb. 5.
In ihr fand sich unter der Fensterschräge
eingemauert das Überbleibsel eines sargförmig
gestalteten Reliquiars aus Stein, bestehend aus
einem 49 cm breiten, 27 cm hohen Unterteil
mit 22,5 cm breiter, 21,5 cm hoher Mittelöffnung
und einem trapezförmigen 49,5 cm breiten, 27 cm
hohen Deckel; das Ganze hat in seiner ur-
sprünglichen Form, die später durch Ände-
rung des Wandputzes verkümmert wurde, sich
auf die Mensa des jetzt verschwundenen Altars
aufgesetzt. Der zur Aufnahme der Reliquien
bestimmte mittlere,
jetzt 13,5 cm tiefe
Raum war aller
Wahrscheinlichkeit
nach durch ein zier-
liches Gitter ver-
schlossen. Die
Wandflächen zu Sei-
ten des Steinsarko-
phages und darüber
zieren figürliche
Darstellungen. Zu-
nächst in überaus
bewegter Auffas-
sung ein Paar
schwebende, Weih-
rauch spendende
Engel, ein zwar sel-
tenes, doch nicht
vereinzeltes Beispiel
besonderer Aus-
zeichnung und Eh-
rung heiliger Reli-
quien, dann aber
ein charakteristi-
scher Cyklus von 6
Darstellungen der
Auferstehungssym-
bole in aufsteigendem Rankenwerk neben der
Fensterleibung: Pelikan, seine Jungen tränkend,
Simson mit dem Torflügel Gazas, Witwe von
Serepta, Löwe, seine Kleinen zum Leben er-
weckend, Jonas vom Walfisch ausgespien und
Phönix aus den Flammen sich emporhebend,
alles in wirkungsvoller Ausführung als flott be-
handelte Umrifszeichnungen auf blauem Grunde.
Neben den wohl erhaltenen 12 alten Kon-
sekrationskreuzen in Scheibenform bietet noch
besonderes Interesse eine den ganzen oberen Teil
der Westwand ausfüllende Darstellung der Krö-
nung Maria. (Abb. 6.) Auf einem breiten Throne