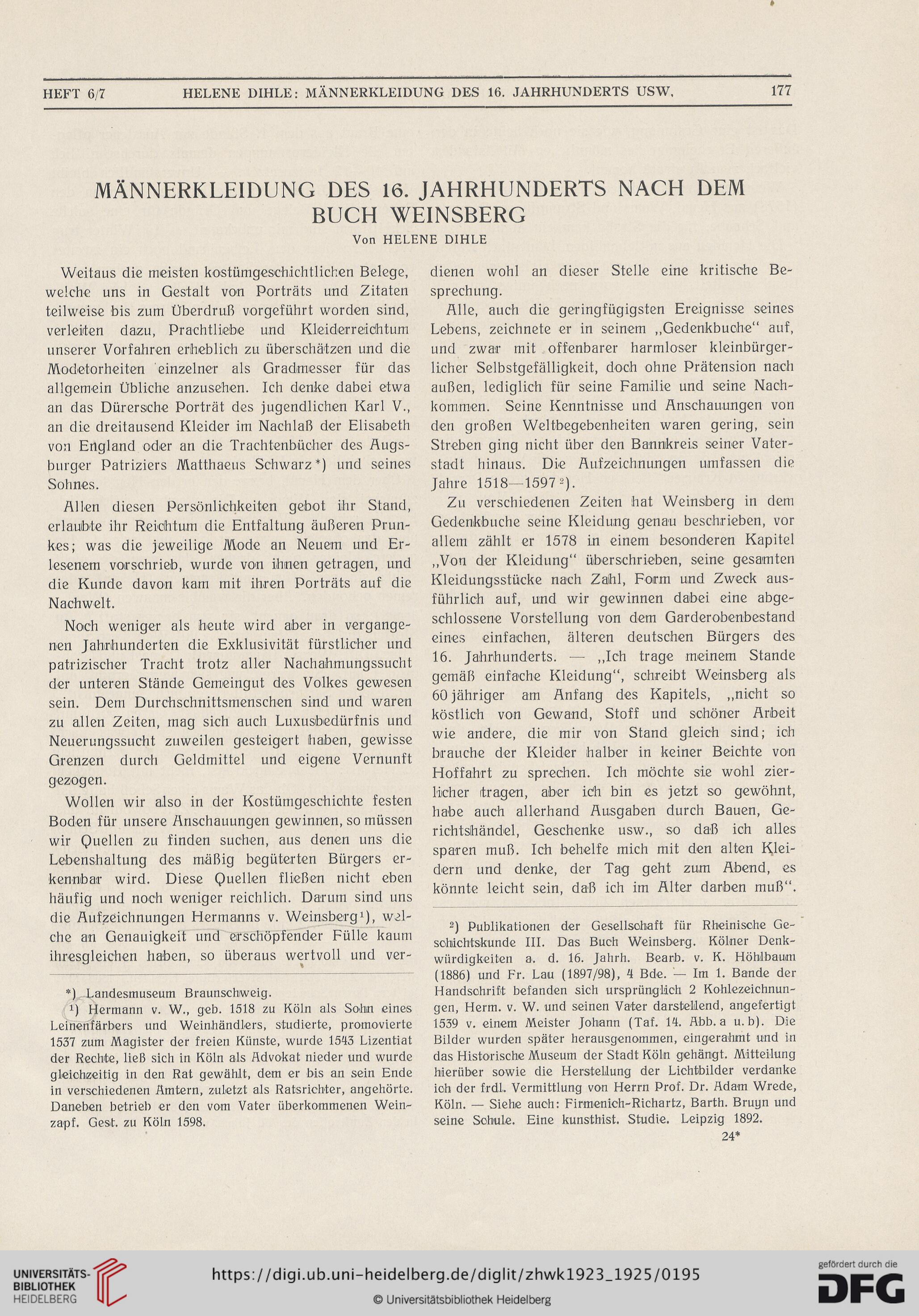HEFT 6/7
HELENE DIHLE: MÄNNERKLEIDUNG DES 16. JAHRHUNDERTS USW,
177
MANNERKLEIDUNG DES 16. JAHRHUNDERTS NACH DEM
BUCH WEINSBERG
Von HELENE DIHLE
Weitaus die meisten kostümgeschichtlichen Belege,
welche uns in Gestalt von Porträts und Zitaten
teilweise bis zum Überdruß vorgeführt worden sind,
verleiten dazu, Prachtliebe und Kleiderreichtum
unserer Vorfahren erheblich zu überschätzen und die
Modetorheiten einzelner als Gradmesser für das
allgemein Übliche anzusehen. Ich denke dabei etwa
an das Dürersche Porträt des jugendlichen Karl V.,
an die dreitausend Kleider im Nachlaß der Elisabeth
von England oder an die Trachtenbücher des Augs-
burger Patriziers Matthaeus Schwarz*) und seines
Sohnes.
Allen diesen Persönlichkeiten gebot ihr Stand,
erlaubte ihr Reichtum die Entfaltung äußeren Prun-
kes; was die jeweilige Mode an Neuem und Er-
lesenem vorschrieb, wurde von ihnen getragen, und
die Kunde davon kam mit ihren Porträts auf die
Nachwelt.
Noch weniger als heute wird aber in vergange-
nen Jahrhunderten die Exklusivität fürstlicher und
patrizischer Tracht trotz aller Nachahmungssucht
der unteren Stände Gemeingut des Volkes gewesen
sein. Dem Durchschnittsmenschen sind und waren
zu allen Zeiten, mag sich auch Luxusbedürfnis und
Neuerungssucht zuweilen gesteigert haben, gewisse
Grenzen durch Geldmittel und eigene Vernunft
gezogen.
Wollen wir also in der Kostümgeschichte festen
Boden für unsere Anschauungen gewinnen, so müssen
wir Quellen zu finden suchen, aus denen uns die
Lebenshaltung des mäßig begüterten Bürgers er-
kennbar wird. Diese Quellen fließen nicht eben
häufig und noch weniger reichlich. Darum sind uns
die Aufzeichnungen Hermanns v. Weinsberg1), wel-
che an Genauigkeit und erschöpfender Fülle kaum
ihresgleichen haben, so überaus wertvoll und ver-
*) Landesmuseum Braunschweig.
!) Hermann v. W., geb. 1518 zu Köln als Sohn eines
Leinenfärbers und Weinhändlers, studierte, promovierte
1537 zum Magister der freien Künste, wurde 1543 Lizentiat
der Rechte, ließ sich in Köln als Advokat nieder und wurde
gleichzeitig in den Rat gewählt, dem er bis an sein Ende
in verschiedenen Ämtern, zuletzt als Ratsrichter, angehörte.
Daneben betrieb er den vom Vater überkommenen Wein-
zapf. Gest, zu Köln 1598.
dienen wohl an dieser Stelle eine kritische Be-
sprechung.
Alle, auch die geringfügigsten Ereignisse seines
Lebens, zeichnete er in seinem „Gedenkbuche“ auf,
und zwar mit offenbarer harmloser kleinbürger-
licher Selbstgefälligkeit, doch ohne Prätension nach
außen, lediglich für seine Familie und seine Nach-
kommen. Seine Kenntnisse und Anschauungen von
den großen Weltbegebenheiten waren gering, sein
Streben ging nicht über den Bannkreis seiner Vater-
stadt hinaus. Die Aufzeichnungen umfassen die
Jahre 1518—1597 2).
Zu verschiedenen Zeiten hat Weinsberg in dem
Gedenkbuche seine Kleidung genau beschrieben, vor
allem zählt er 1578 in einem besonderen Kapitel
„Von der Kleidung“ überschrieben, seine gesamten
Kleidungsstücke nach Zahl, Form und Zweck aus-
führlich auf, und wir gewinnen dabei eine abge-
schlossene Vorstellung von dem Garderobenbestand
eines einfachen, älteren deutschen Bürgers des
16. Jahrhunderts. — „Ich trage meinem Stande
gemäß einfache Kleidung“, schreibt Weinsberg als
60 jähriger am Anfang des Kapitels, „nicht so
köstlich von Gewand, Stoff und schöner Arbeit
wie andere, die mir von Stand gleich sind; ich
brauche der Kleider halber in keiner Beichte von
Hoffahrt zu sprechen. Ich möchte sie wohl zier-
licher tragen, aber ich bin es jetzt so gewöhnt,
habe auch allerhand Ausgaben durch Bauen, Ge-
richtshändel, Geschenke usw., so daß ich alles
sparen muß. Ich behelfe mich mit den alten Klei-
dern und denke, der Tag geht zum Abend, es
könnte leicht sein, daß ich im Alter darben muß“.
2) Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Ge-
schiichtskunde III. Das Buch Weinsberg. Kölner Denk-
würdigkeiten a. d. 16. Jalirh. Bearb. v. K. Höhlbaum
(1886) und Fr. Lau (1897/98), 4 Bde. Im 1. Bande der
Handschrift befanden sich ursprünglich 2 Kohlezeichnun-
gen, Herrn, v. W. und seinen Vater darstellend, angefertigt
1539 v. einem Meister Johann (Taf. 14. Abb. a u. b). Die
Bilder wurden später herausgenommen, eingerahmt und in
das Historische Museum der Stadt Köln gehängt. Mitteilung
hierüber sowie die Herstellung der Lichtbilder verdanke
ich der frdl, Vermittlung von Herrn Prof. Dr. Adam Wrede,
Köln. — Siehe auch: Firmenich-Richartz, Barth. Bruyn und
seine Schule. Eine kunsthist. Studie. Leipzig 1892.
24*
HELENE DIHLE: MÄNNERKLEIDUNG DES 16. JAHRHUNDERTS USW,
177
MANNERKLEIDUNG DES 16. JAHRHUNDERTS NACH DEM
BUCH WEINSBERG
Von HELENE DIHLE
Weitaus die meisten kostümgeschichtlichen Belege,
welche uns in Gestalt von Porträts und Zitaten
teilweise bis zum Überdruß vorgeführt worden sind,
verleiten dazu, Prachtliebe und Kleiderreichtum
unserer Vorfahren erheblich zu überschätzen und die
Modetorheiten einzelner als Gradmesser für das
allgemein Übliche anzusehen. Ich denke dabei etwa
an das Dürersche Porträt des jugendlichen Karl V.,
an die dreitausend Kleider im Nachlaß der Elisabeth
von England oder an die Trachtenbücher des Augs-
burger Patriziers Matthaeus Schwarz*) und seines
Sohnes.
Allen diesen Persönlichkeiten gebot ihr Stand,
erlaubte ihr Reichtum die Entfaltung äußeren Prun-
kes; was die jeweilige Mode an Neuem und Er-
lesenem vorschrieb, wurde von ihnen getragen, und
die Kunde davon kam mit ihren Porträts auf die
Nachwelt.
Noch weniger als heute wird aber in vergange-
nen Jahrhunderten die Exklusivität fürstlicher und
patrizischer Tracht trotz aller Nachahmungssucht
der unteren Stände Gemeingut des Volkes gewesen
sein. Dem Durchschnittsmenschen sind und waren
zu allen Zeiten, mag sich auch Luxusbedürfnis und
Neuerungssucht zuweilen gesteigert haben, gewisse
Grenzen durch Geldmittel und eigene Vernunft
gezogen.
Wollen wir also in der Kostümgeschichte festen
Boden für unsere Anschauungen gewinnen, so müssen
wir Quellen zu finden suchen, aus denen uns die
Lebenshaltung des mäßig begüterten Bürgers er-
kennbar wird. Diese Quellen fließen nicht eben
häufig und noch weniger reichlich. Darum sind uns
die Aufzeichnungen Hermanns v. Weinsberg1), wel-
che an Genauigkeit und erschöpfender Fülle kaum
ihresgleichen haben, so überaus wertvoll und ver-
*) Landesmuseum Braunschweig.
!) Hermann v. W., geb. 1518 zu Köln als Sohn eines
Leinenfärbers und Weinhändlers, studierte, promovierte
1537 zum Magister der freien Künste, wurde 1543 Lizentiat
der Rechte, ließ sich in Köln als Advokat nieder und wurde
gleichzeitig in den Rat gewählt, dem er bis an sein Ende
in verschiedenen Ämtern, zuletzt als Ratsrichter, angehörte.
Daneben betrieb er den vom Vater überkommenen Wein-
zapf. Gest, zu Köln 1598.
dienen wohl an dieser Stelle eine kritische Be-
sprechung.
Alle, auch die geringfügigsten Ereignisse seines
Lebens, zeichnete er in seinem „Gedenkbuche“ auf,
und zwar mit offenbarer harmloser kleinbürger-
licher Selbstgefälligkeit, doch ohne Prätension nach
außen, lediglich für seine Familie und seine Nach-
kommen. Seine Kenntnisse und Anschauungen von
den großen Weltbegebenheiten waren gering, sein
Streben ging nicht über den Bannkreis seiner Vater-
stadt hinaus. Die Aufzeichnungen umfassen die
Jahre 1518—1597 2).
Zu verschiedenen Zeiten hat Weinsberg in dem
Gedenkbuche seine Kleidung genau beschrieben, vor
allem zählt er 1578 in einem besonderen Kapitel
„Von der Kleidung“ überschrieben, seine gesamten
Kleidungsstücke nach Zahl, Form und Zweck aus-
führlich auf, und wir gewinnen dabei eine abge-
schlossene Vorstellung von dem Garderobenbestand
eines einfachen, älteren deutschen Bürgers des
16. Jahrhunderts. — „Ich trage meinem Stande
gemäß einfache Kleidung“, schreibt Weinsberg als
60 jähriger am Anfang des Kapitels, „nicht so
köstlich von Gewand, Stoff und schöner Arbeit
wie andere, die mir von Stand gleich sind; ich
brauche der Kleider halber in keiner Beichte von
Hoffahrt zu sprechen. Ich möchte sie wohl zier-
licher tragen, aber ich bin es jetzt so gewöhnt,
habe auch allerhand Ausgaben durch Bauen, Ge-
richtshändel, Geschenke usw., so daß ich alles
sparen muß. Ich behelfe mich mit den alten Klei-
dern und denke, der Tag geht zum Abend, es
könnte leicht sein, daß ich im Alter darben muß“.
2) Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Ge-
schiichtskunde III. Das Buch Weinsberg. Kölner Denk-
würdigkeiten a. d. 16. Jalirh. Bearb. v. K. Höhlbaum
(1886) und Fr. Lau (1897/98), 4 Bde. Im 1. Bande der
Handschrift befanden sich ursprünglich 2 Kohlezeichnun-
gen, Herrn, v. W. und seinen Vater darstellend, angefertigt
1539 v. einem Meister Johann (Taf. 14. Abb. a u. b). Die
Bilder wurden später herausgenommen, eingerahmt und in
das Historische Museum der Stadt Köln gehängt. Mitteilung
hierüber sowie die Herstellung der Lichtbilder verdanke
ich der frdl, Vermittlung von Herrn Prof. Dr. Adam Wrede,
Köln. — Siehe auch: Firmenich-Richartz, Barth. Bruyn und
seine Schule. Eine kunsthist. Studie. Leipzig 1892.
24*