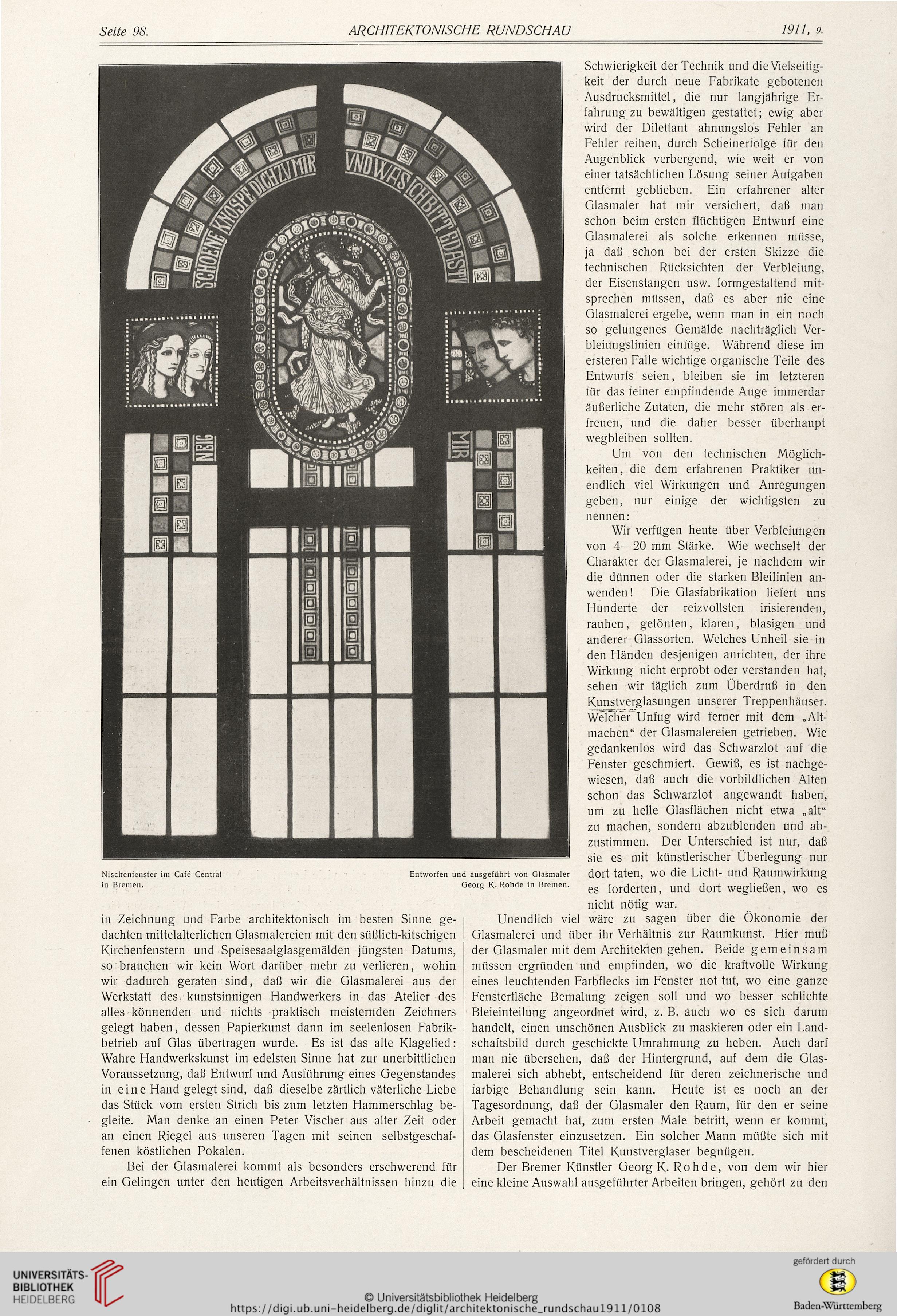Seite 98.
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
1911, 9.
Nischenfenster im Cafe Central Entworfen und ausgeführt von Glasmaler
in Bremen. Georg K. Rohde in Bremen.
Schwierigkeit der Technik und die Vielseitig-
keit der durch neue Fabrikate gebotenen
Ausdrucksmittel, die nur langjährige Er-
fahrung zu bewältigen gestattet; ewig aber
wird der Dilettant ahnungslos Fehler an
Fehler reihen, durch Scheinerfolge für den
Augenblick verbergend, wie weit er von
einer tatsächlichen Lösung seiner Aufgaben
entfernt geblieben. Ein erfahrener alter
Glasmaler hat mir versichert, daß man
schon beim ersten flüchtigen Entwurf eine
Glasmalerei als solche erkennen müsse,
ja daß schon bei der ersten Skizze die
technischen Rücksichten der Verbleiung,
der Eisenstangen usw. formgestaltend mit-
sprechen müssen, daß es aber nie eine
Glasmalerei ergebe, wenn man in ein noch
so gelungenes Gemälde nachträglich Ver-
bleiungslinien einfüge. Während diese im
ersteren Falle wichtige organische Teile des
Entwurfs seien, bleiben sie im letzteren
für das feiner empfindende Auge immerdar
äußerliche Zutaten, die mehr stören als er-
freuen, und die daher besser überhaupt
wegbleiben sollten.
Um von den technischen Möglich-
keiten, die dem erfahrenen Praktiker un-
endlich viel Wirkungen und Anregungen
geben, nur einige der wichtigsten zu
nennen:
Wir verfügen heute über Verbleiungen
von 4—20 mm Stärke. Wie wechselt der
Charakter der Glasmalerei, je nachdem wir
die dünnen oder die starken Bleilinien an-
wenden! Die Glasfabrikation liefert uns
Hunderte der reizvollsten irisierenden,
rauhen, getönten, klaren, blasigen und
anderer Glassorten. Welches Unheil sie in
den Händen desjenigen anrichten, der ihre
Wirkung nicht erprobt oder verstanden hat,
sehen wir täglich zum Überdruß in den
Kunstverglasungen unserer Treppenhäuser.
Welcher Unfug wird ferner mit dem „Alt-
machen“ der Glasmalereien getrieben. Wie
gedankenlos wird das Schwarzlot auf die
Fenster geschmiert. Gewiß, es ist nachge-
wiesen, daß auch die vorbildlichen Alten
schon das Schwarzlot angewandt haben,
um zu helle Glasflächen nicht etwa „alt“
zu machen, sondern abzublenden und ab-
zustimmen. Der Unterschied ist nur, daß
sie es mit künstlerischer Überlegung nur
dort taten, wo die Licht- und Raumwirkung
es forderten, und dort wegließen, wo es
in Zeichnung und Farbe architektonisch im besten Sinne ge-
dachten mittelalterlichen Glasmalereien mit den süßlich-kitschigen
Kirchenfenstern und Speisesaalglasgemälden jüngsten Datums,
so brauchen wir kein Wort darüber mehr zu verlieren, wohin
wir dadurch geraten sind, daß wir die Glasmalerei aus der
Werkstatt des kunstsinnigen Handwerkers in das Atelier des
alles könnenden und nichts praktisch meisternden Zeichners
gelegt haben, dessen Papierkunst dann im seelenlosen Fabrik-
betrieb auf Glas übertragen wurde. Es ist das alte Klagelied:
Wahre Handwerkskunst im edelsten Sinne hat zur unerbittlichen
Voraussetzung, daß Entwurf und Ausführung eines Gegenstandes
in eine Hand gelegt sind, daß dieselbe zärtlich väterliche Liebe
das Stück vom ersten Strich bis zum letzten Hammerschlag be-
gleite. Man denke an einen Peter Vischer aus alter Zeit oder
an einen Riegel aus unseren Tagen mit seinen selbstgeschaf-
fenen köstlichen Pokalen.
Bei der Glasmalerei kommt als besonders erschwerend für
ein Gelingen unter den heutigen Arbeitsverhältnissen hinzu die
nicht nötig war.
Unendlich viel wäre zu sagen über die Ökonomie der
Glasmalerei und über ihr Verhältnis zur Raumkunst. Hier muß
der Glasmaler mit dem Architekten gehen. Beide gemeinsam
müssen ergründen und empfinden, wo die kraftvolle Wirkung
eines leuchtenden Farbflecks im Fenster not tut, wo eine ganze
Fensterfläche Bemalung zeigen soll und wo besser schlichte
Bleieinteilung angeordnet wird, z. B. auch wo es sich darum
handelt, einen unschönen Ausblick zu maskieren oder ein Land-
schaftsbild durch geschickte Umrahmung zu heben. Auch darf
man nie übersehen, daß der Hintergrund, auf dem die Glas-
malerei sich abhebt, entscheidend für deren zeichnerische und
farbige Behandlung sein kann. Heute ist es noch an der
Tagesordnung, daß der Glasmaler den Raum, für den er seine
Arbeit gemacht hat, zum ersten Male betritt, wenn er kommt,
das Glasfenster einzusetzen. Ein solcher Mann müßte sich mit
dem bescheidenen Titel Kunstverglaser begnügen.
Der Bremer Künstler Georg K. Rohde, von dem wir hier
eine kleine Auswahl ausgeführter Arbeiten bringen, gehört zu den
ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU
1911, 9.
Nischenfenster im Cafe Central Entworfen und ausgeführt von Glasmaler
in Bremen. Georg K. Rohde in Bremen.
Schwierigkeit der Technik und die Vielseitig-
keit der durch neue Fabrikate gebotenen
Ausdrucksmittel, die nur langjährige Er-
fahrung zu bewältigen gestattet; ewig aber
wird der Dilettant ahnungslos Fehler an
Fehler reihen, durch Scheinerfolge für den
Augenblick verbergend, wie weit er von
einer tatsächlichen Lösung seiner Aufgaben
entfernt geblieben. Ein erfahrener alter
Glasmaler hat mir versichert, daß man
schon beim ersten flüchtigen Entwurf eine
Glasmalerei als solche erkennen müsse,
ja daß schon bei der ersten Skizze die
technischen Rücksichten der Verbleiung,
der Eisenstangen usw. formgestaltend mit-
sprechen müssen, daß es aber nie eine
Glasmalerei ergebe, wenn man in ein noch
so gelungenes Gemälde nachträglich Ver-
bleiungslinien einfüge. Während diese im
ersteren Falle wichtige organische Teile des
Entwurfs seien, bleiben sie im letzteren
für das feiner empfindende Auge immerdar
äußerliche Zutaten, die mehr stören als er-
freuen, und die daher besser überhaupt
wegbleiben sollten.
Um von den technischen Möglich-
keiten, die dem erfahrenen Praktiker un-
endlich viel Wirkungen und Anregungen
geben, nur einige der wichtigsten zu
nennen:
Wir verfügen heute über Verbleiungen
von 4—20 mm Stärke. Wie wechselt der
Charakter der Glasmalerei, je nachdem wir
die dünnen oder die starken Bleilinien an-
wenden! Die Glasfabrikation liefert uns
Hunderte der reizvollsten irisierenden,
rauhen, getönten, klaren, blasigen und
anderer Glassorten. Welches Unheil sie in
den Händen desjenigen anrichten, der ihre
Wirkung nicht erprobt oder verstanden hat,
sehen wir täglich zum Überdruß in den
Kunstverglasungen unserer Treppenhäuser.
Welcher Unfug wird ferner mit dem „Alt-
machen“ der Glasmalereien getrieben. Wie
gedankenlos wird das Schwarzlot auf die
Fenster geschmiert. Gewiß, es ist nachge-
wiesen, daß auch die vorbildlichen Alten
schon das Schwarzlot angewandt haben,
um zu helle Glasflächen nicht etwa „alt“
zu machen, sondern abzublenden und ab-
zustimmen. Der Unterschied ist nur, daß
sie es mit künstlerischer Überlegung nur
dort taten, wo die Licht- und Raumwirkung
es forderten, und dort wegließen, wo es
in Zeichnung und Farbe architektonisch im besten Sinne ge-
dachten mittelalterlichen Glasmalereien mit den süßlich-kitschigen
Kirchenfenstern und Speisesaalglasgemälden jüngsten Datums,
so brauchen wir kein Wort darüber mehr zu verlieren, wohin
wir dadurch geraten sind, daß wir die Glasmalerei aus der
Werkstatt des kunstsinnigen Handwerkers in das Atelier des
alles könnenden und nichts praktisch meisternden Zeichners
gelegt haben, dessen Papierkunst dann im seelenlosen Fabrik-
betrieb auf Glas übertragen wurde. Es ist das alte Klagelied:
Wahre Handwerkskunst im edelsten Sinne hat zur unerbittlichen
Voraussetzung, daß Entwurf und Ausführung eines Gegenstandes
in eine Hand gelegt sind, daß dieselbe zärtlich väterliche Liebe
das Stück vom ersten Strich bis zum letzten Hammerschlag be-
gleite. Man denke an einen Peter Vischer aus alter Zeit oder
an einen Riegel aus unseren Tagen mit seinen selbstgeschaf-
fenen köstlichen Pokalen.
Bei der Glasmalerei kommt als besonders erschwerend für
ein Gelingen unter den heutigen Arbeitsverhältnissen hinzu die
nicht nötig war.
Unendlich viel wäre zu sagen über die Ökonomie der
Glasmalerei und über ihr Verhältnis zur Raumkunst. Hier muß
der Glasmaler mit dem Architekten gehen. Beide gemeinsam
müssen ergründen und empfinden, wo die kraftvolle Wirkung
eines leuchtenden Farbflecks im Fenster not tut, wo eine ganze
Fensterfläche Bemalung zeigen soll und wo besser schlichte
Bleieinteilung angeordnet wird, z. B. auch wo es sich darum
handelt, einen unschönen Ausblick zu maskieren oder ein Land-
schaftsbild durch geschickte Umrahmung zu heben. Auch darf
man nie übersehen, daß der Hintergrund, auf dem die Glas-
malerei sich abhebt, entscheidend für deren zeichnerische und
farbige Behandlung sein kann. Heute ist es noch an der
Tagesordnung, daß der Glasmaler den Raum, für den er seine
Arbeit gemacht hat, zum ersten Male betritt, wenn er kommt,
das Glasfenster einzusetzen. Ein solcher Mann müßte sich mit
dem bescheidenen Titel Kunstverglaser begnügen.
Der Bremer Künstler Georg K. Rohde, von dem wir hier
eine kleine Auswahl ausgeführter Arbeiten bringen, gehört zu den