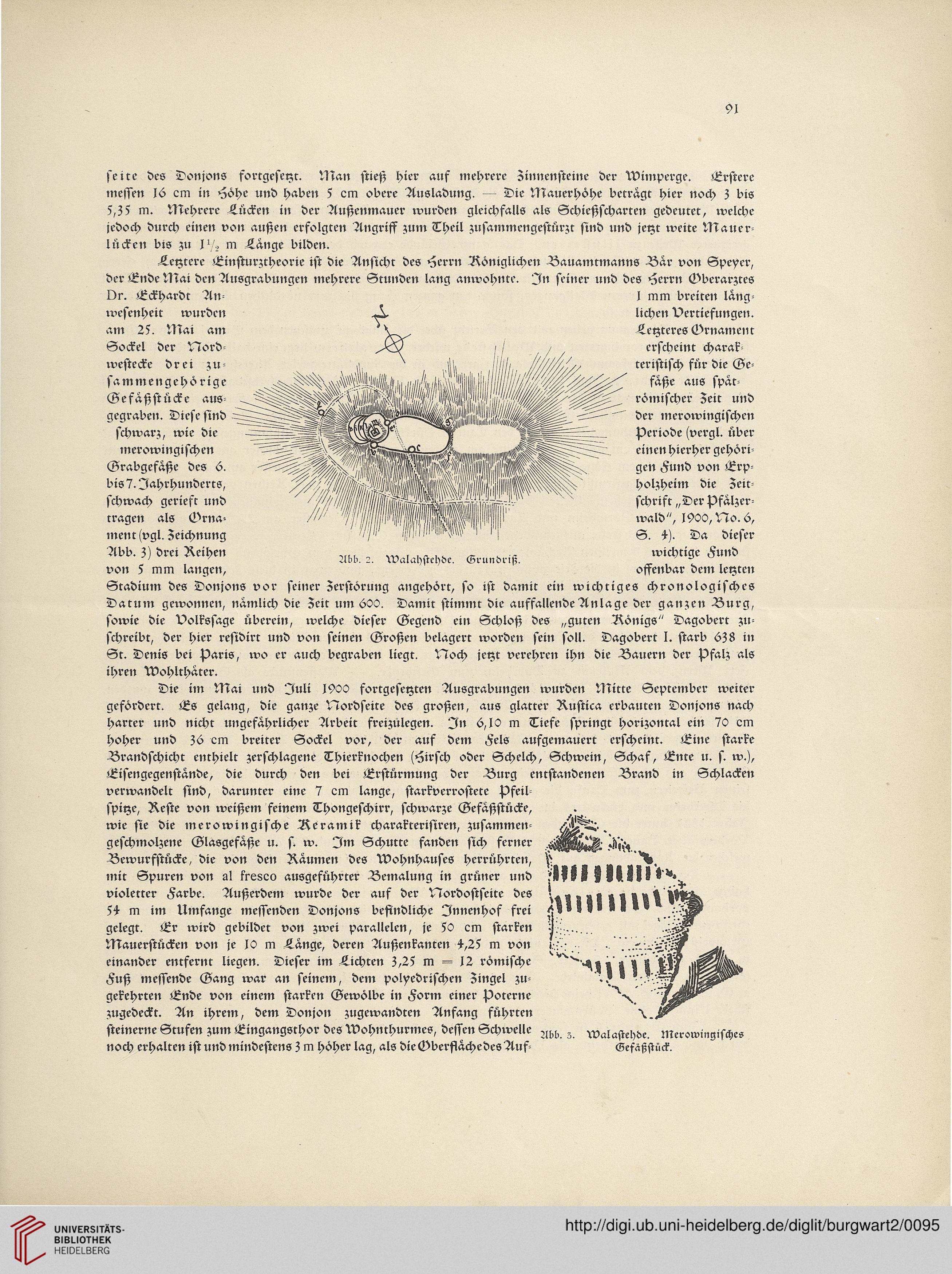seire des D<>njottö fortgeseyc. Nlan stieß hier auf mehrere ZLttttettsteitte der Wuuperge. Erstere
messett Lm Lri ^öhe imd haberi 5 cm obere Ausladmig. — Die Mauerhöhe betragt hier uoch Z bis
5,Z5 m. Mehrere Eückeii iu der Außemnauer wurdeu gleichfalls als Schießscharten gedeutet, welche
jedoch durch eiuen vou außeu erfolgteu Augriff zum Theil zusammeugesturzt siud und jetzt weite Mauer-
luckeu bis zu m Eange bildeu.
Letztere Eiusturztheorie ist die AusLchc des Herru Röuiglicheu Bauamtmanns Bar vou Speyer,
der Ende Mai den Ausgrabungen mehrere Stimden lang anwohnte. In seiner und des »Zerrtt Gberarztes
Or. Eckhardc An-
wesenheit wurdeu
am 25. Uiai am
Sockel der Vlord-
westecke drei zu
sam mengehörige
Gefaßstücke aus
gegrabeu. Diese sind
schwarz, wie die
merowingischeu
Grabgefaße des ö.
bis 7. Iahrhunderts,
schwach geriefc und
cragen als Grna-
mencjvgl. Zeichnuttg
Abb. Z) drei Reihen
von 5 mm langen,
Abb. 2. walahstehde. Geundriß.
I mm breiten lang
lichen 1?ertiefungen.
Eetzteres Grnament
erscheint charak
teristisch für die Ge-
faße aus spat-
römischer Zeit uud
der merowingischen
s)eriode (vergl. über
einen hierher gehöri-
gen Fund von Erp-
holzheim die Zeic-
schrifc „Der pfalzer
wald", I9OO, V7o. ö,
G. 4). Da dieser
wichtige Lund
offenbar dem letzten
Gtadium des Donjons vor seiner Zerstörung augehörc, so ist damic ein wichtiges chronologisches
Datum gewonnen, namlich die Zeit um 600. Damit stimmt die auffallendeAnlage der ganzen Burg,
sowie die Dolkssage überein, welche dieser Gegend ein Gchloß des „gucen Rönigs" Dagoberc zu-
schreibt, der hier residirt und von seinen Großen belagert worden sein soll. Dagobert I. starb öZ5 in
Gt. Denis bei s)aris, wo er auch begraben liegt. )7loch jetzt verehren Lhn die Bauern der s)falz als
Lhren Wohlthacer.
Die im Mai und Iuli löOö fortgesetzten Ausgrabungen wurden MLtte Geptember weiter
gefördert. Es gelang, die ganze ^Aordseice des großen, aus glatter Rustica erbaucen Donjons nach
harter und nicht ungefahrlicher Arbeit freizulegen. In ö,lö m Tiefe springt horizoncal ein 7ö em
hoher und Zö cm breiter Gockel vor, der auf dem Lels aufgemauert erscheint. Eine starke
Brandschicht enchielt zerschlagene Thierknochen (Hirsch oder Schelch, Gchwein, Gchaf, Ence u. s. w.),
Eisengegenstande, die durch den bei Erstürmung der Burg entstandenen Brand in Schlacken
verwandelt sind, darunter eine 7 em lange, starkverrostete s)feil-
spitze, Reste von weißem feinem Thongeschirr, schwarze Gefaßstücke,
wie sie die merowingische Reramik charakterisiren, zusammen-
geschmolzene Glasgefaße u. s. w. Im Gchutte fanden sich ferner
Bewurfstücke, die von den Raumen des Wohnhauses herrührcen,
mit Spuren von al fre8L0 ausgeführcer Bemalung in grüner und
violetter Larbe. Außerdem wurde der auf der Vlordostseite des
54 m im Umfange messenden Donjons befindliche Innenhof frei
gelegt. Er wird gebildet von zwei parallelen, je 5ö cm starken
Mauerstücken von je lc> m Lange, deren Außenkancen 4,25 m von
einander entfernt liegen. Dieser im Eichcen Z,25 m --- l2 römische
Fuß messende Gang war an seinem, dem polyedrischen Zingel zu-
gekehrten Ende von einem starken Gewölbe in Form einer Pocerne
zugedeckt. An ihrem, dem Donjon zugewandten Anfang führcen
fteinerne Gcufen zum Eingangsthor des wohnthurmes, dessen Gchwelle ^b. z. walaftehde. Merowingischcs
noch erhalcen ist und mindestens Z m höher lag, als dieGberfiachedesAuf- Gefäßftück.
»»»I^
messett Lm Lri ^öhe imd haberi 5 cm obere Ausladmig. — Die Mauerhöhe betragt hier uoch Z bis
5,Z5 m. Mehrere Eückeii iu der Außemnauer wurdeu gleichfalls als Schießscharten gedeutet, welche
jedoch durch eiuen vou außeu erfolgteu Augriff zum Theil zusammeugesturzt siud und jetzt weite Mauer-
luckeu bis zu m Eange bildeu.
Letztere Eiusturztheorie ist die AusLchc des Herru Röuiglicheu Bauamtmanns Bar vou Speyer,
der Ende Mai den Ausgrabungen mehrere Stimden lang anwohnte. In seiner und des »Zerrtt Gberarztes
Or. Eckhardc An-
wesenheit wurdeu
am 25. Uiai am
Sockel der Vlord-
westecke drei zu
sam mengehörige
Gefaßstücke aus
gegrabeu. Diese sind
schwarz, wie die
merowingischeu
Grabgefaße des ö.
bis 7. Iahrhunderts,
schwach geriefc und
cragen als Grna-
mencjvgl. Zeichnuttg
Abb. Z) drei Reihen
von 5 mm langen,
Abb. 2. walahstehde. Geundriß.
I mm breiten lang
lichen 1?ertiefungen.
Eetzteres Grnament
erscheint charak
teristisch für die Ge-
faße aus spat-
römischer Zeit uud
der merowingischen
s)eriode (vergl. über
einen hierher gehöri-
gen Fund von Erp-
holzheim die Zeic-
schrifc „Der pfalzer
wald", I9OO, V7o. ö,
G. 4). Da dieser
wichtige Lund
offenbar dem letzten
Gtadium des Donjons vor seiner Zerstörung augehörc, so ist damic ein wichtiges chronologisches
Datum gewonnen, namlich die Zeit um 600. Damit stimmt die auffallendeAnlage der ganzen Burg,
sowie die Dolkssage überein, welche dieser Gegend ein Gchloß des „gucen Rönigs" Dagoberc zu-
schreibt, der hier residirt und von seinen Großen belagert worden sein soll. Dagobert I. starb öZ5 in
Gt. Denis bei s)aris, wo er auch begraben liegt. )7loch jetzt verehren Lhn die Bauern der s)falz als
Lhren Wohlthacer.
Die im Mai und Iuli löOö fortgesetzten Ausgrabungen wurden MLtte Geptember weiter
gefördert. Es gelang, die ganze ^Aordseice des großen, aus glatter Rustica erbaucen Donjons nach
harter und nicht ungefahrlicher Arbeit freizulegen. In ö,lö m Tiefe springt horizoncal ein 7ö em
hoher und Zö cm breiter Gockel vor, der auf dem Lels aufgemauert erscheint. Eine starke
Brandschicht enchielt zerschlagene Thierknochen (Hirsch oder Schelch, Gchwein, Gchaf, Ence u. s. w.),
Eisengegenstande, die durch den bei Erstürmung der Burg entstandenen Brand in Schlacken
verwandelt sind, darunter eine 7 em lange, starkverrostete s)feil-
spitze, Reste von weißem feinem Thongeschirr, schwarze Gefaßstücke,
wie sie die merowingische Reramik charakterisiren, zusammen-
geschmolzene Glasgefaße u. s. w. Im Gchutte fanden sich ferner
Bewurfstücke, die von den Raumen des Wohnhauses herrührcen,
mit Spuren von al fre8L0 ausgeführcer Bemalung in grüner und
violetter Larbe. Außerdem wurde der auf der Vlordostseite des
54 m im Umfange messenden Donjons befindliche Innenhof frei
gelegt. Er wird gebildet von zwei parallelen, je 5ö cm starken
Mauerstücken von je lc> m Lange, deren Außenkancen 4,25 m von
einander entfernt liegen. Dieser im Eichcen Z,25 m --- l2 römische
Fuß messende Gang war an seinem, dem polyedrischen Zingel zu-
gekehrten Ende von einem starken Gewölbe in Form einer Pocerne
zugedeckt. An ihrem, dem Donjon zugewandten Anfang führcen
fteinerne Gcufen zum Eingangsthor des wohnthurmes, dessen Gchwelle ^b. z. walaftehde. Merowingischcs
noch erhalcen ist und mindestens Z m höher lag, als dieGberfiachedesAuf- Gefäßftück.
»»»I^