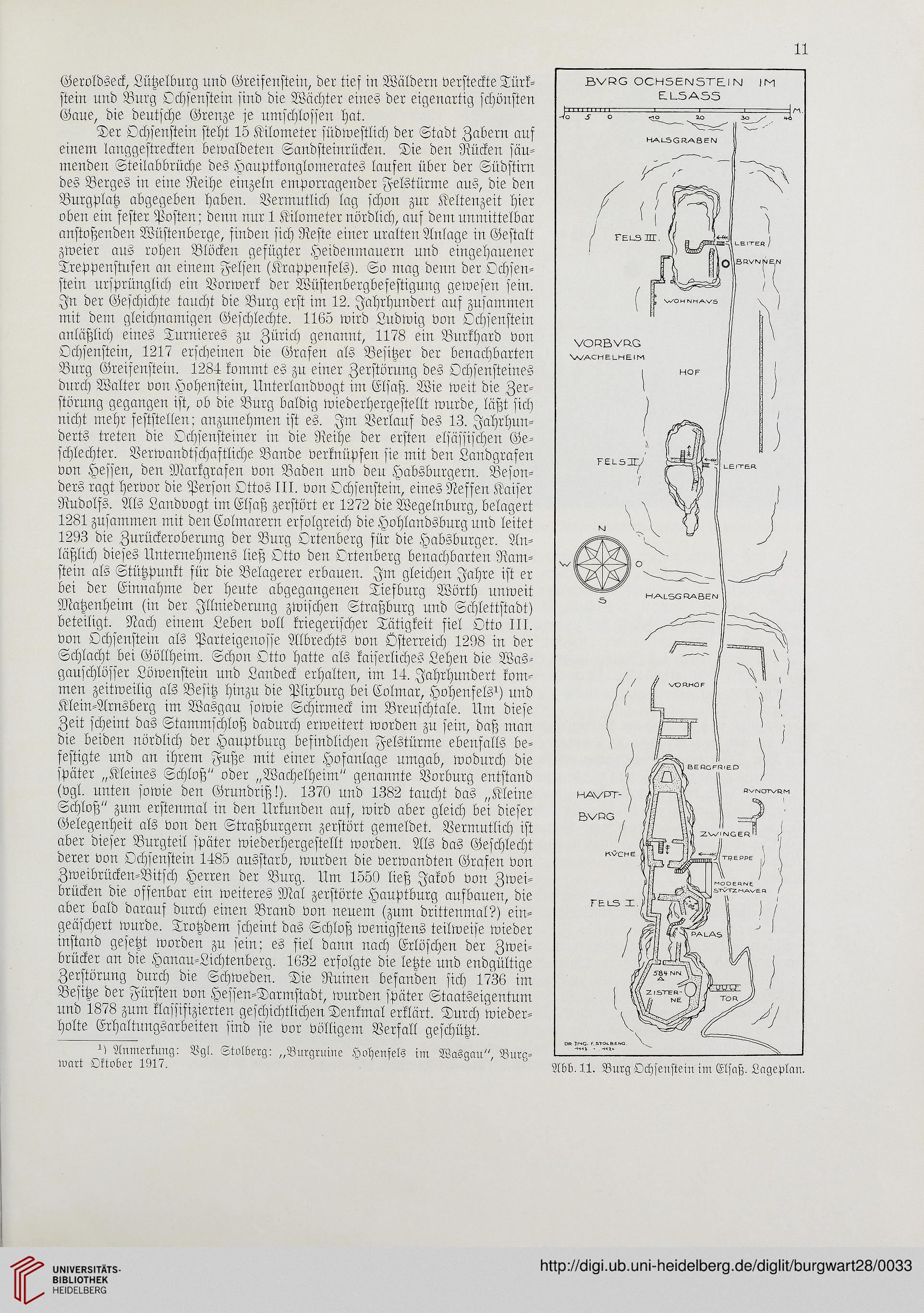11
Geroldseck, Lützelburg und Greifenstein, der tief in Wäldern versteckte Türk-
stein und Burg Ochsenstein sind die Wächter eines der eigenartig schönsten
Gaue, die deutsche Grenze je umschlossen hat.
Der Ochsenstein steht 15 Kilometer südwestlich der Stadt Zabern ans
einem langgestreckten bewaldeten Sandsteinrücken. Die den Rücken säu-
menden Steilabbrüche des Hauptkonglomerates laufen über der Südstirn
des Berges in eine Reihe einzeln emporragender Felstürme aus, die den
Burgplatz abgegeben haben. Vermutlich lag schon zur Keltenzeit hier
oben ein fester Posten: denn nur 1 Kilometer nördlich, auf dem unmittelbar
anstoßenden Wüstenberge, finden sich Reste einer uralten Anlage in Gestalt
zweier aus rohen Blöcken gefügter Heidenmauern und eingehauener
Treppenstufen an einem Felsen (Krappenfels). So mag denn der Ochsen-
stein ursprünglich ein Vorwerk der Wüstenbergbefestignng gewesen sein.
In der Geschichte taucht die Burg erst im 12. Jahrhundert auf zusammen
mit dem gleichnamigen Geschlechts. 1165 wird Ludwig von Ochsenstein
anläßlich eines Tnrnieres zu Zürich genannt, 1178 ein Burkhard von
Ochsenstein, 1217 erscheinen die Grafen als Besitzer der benachbarten
Burg Greifenstein. 1284 kommt es zu einer Zerstörung des Ochsensteines
durch Walter von Hohenstein, Unterlandvogt nn Elsaß. Wie weit die Zer-
störung gegangen ist, ob die Burg baldig wiederhergestellt wurde, läßt sich
nicht mehr feststellen: anzunehmen ist es. Im Verlauf des 13. Jahrhun-
derts treten die Ochsensteiner in die Reihe der ersten elsässischen Ge-
schlechter. Verwandtschaftliche Bande verknüpfen sie mit den Landgrafen
von Hessen, den Markgrafen von Baden und den Habsburgern. Beson-
ders ragt hervor die Person Ottos III. von Ochsenstein, eines Neffen Kaiser
Rudolfs. Als Landvogt im Elsaß zerstört er 1272 die Wegelnburg, belagert
1281 zusammen mit den Colmarern erfolgreich die Hohlandsburg und leitet
1293 die Zurückeroberung der Burg Ortenberg für die Habsburger. An-
läßlich dieses Unternehmens ließ Otto den Ortenberg benachbarten Ram-
stein als Stützpunkt für die Belagerer erbauen. Im gleichen Jahre ist er
bei der Einnahme der heute abgegangenen Tiefburg Wörth unweit
Matzenheim (in der Jllniederung zwischen Straßburg und Schlettstadt)
beteiligt. Nach einem Leben voll kriegerischer Tätigkeit fiel Otto III.
von Ochsenstein als Parteigenosse Albrechts von Österreich 1298 in der
Schlacht bei Göllheim. Schon Otto hatte als kaiserliches Lehen die Was-
gauschlösser Löwenstein und Landeck erhalten, im 14. Jahrhundert kom-
men zeitweilig als Besitz hinzu die Plixburg bei Colmar, HohenfelsZ und
Klein-Arnsberg im Wasgau sowie Schirmeck im Breuschtale. Um diese
Zeit scheint das Stammschloß dadurch erweitert worden zu sein, daß man
die beiden nördlich der Hauptburg befindlichen Felstürme ebenfalls be-
festigte und an ihrem Fuße mit einer Hofanlage umgab, wodurch die
später „Kleines Schloß" oder „Wachelheim" genannte Vorburg entstand
(vgl. unten sowie den Grundriß!). 1370 und 1382 taucht das „Kleine
Schloß" zum erstenmal in den Urkunden auf, wird aber gleich bei dieser
Gelegenheit als von den Straßburgern zerstört gemeldet. Vermutlich ist
aber dieser Burgteil später wiederhergestellt worden. Als das Geschlecht
derer von Ochsenstein 1485 ausstarb, wurden die verwandten Grafen von
Zweibrücken-Bitsch Herren der Burg. Um 1550 ließ Jakob von Zwei-
brücken die offenbar ein weiteres Mal zerstörte Hauptburg aufbauen, die
aber bald darauf durch einen Brand von neuem (zum drittenmal?) ein-
geäschert wurde. Trotzdem scheint das Schloß wenigstens teilweise wieder
instand gesetzt worden zu sein; es siel dann nach Erlöschen der Zwei-
brücker an die Hanau-Lichtenberg. 1632 erfolgte die letzte und endgültige
Zerstörung durch die Schweden. Die Ruinen befanden sich 1736 nn
Besitze der Fürsten von Hessen-Darmstadt, wurden später Staatseigentum
und 1878 zum klassifizierten geschichtlichen Denkmal erklärt. Durch wieder-
holte Erhaltungsarbeiten sind sie vor völligem Verfall geschützt.
0 Anmerkung: Vgl. Stolberg: „Burgruine Hohenfels im Wasgau", Burg-
wart Oktober 1917. Abb. 11. Burg Ochsenstein im Elsaß. Lageplan.
Geroldseck, Lützelburg und Greifenstein, der tief in Wäldern versteckte Türk-
stein und Burg Ochsenstein sind die Wächter eines der eigenartig schönsten
Gaue, die deutsche Grenze je umschlossen hat.
Der Ochsenstein steht 15 Kilometer südwestlich der Stadt Zabern ans
einem langgestreckten bewaldeten Sandsteinrücken. Die den Rücken säu-
menden Steilabbrüche des Hauptkonglomerates laufen über der Südstirn
des Berges in eine Reihe einzeln emporragender Felstürme aus, die den
Burgplatz abgegeben haben. Vermutlich lag schon zur Keltenzeit hier
oben ein fester Posten: denn nur 1 Kilometer nördlich, auf dem unmittelbar
anstoßenden Wüstenberge, finden sich Reste einer uralten Anlage in Gestalt
zweier aus rohen Blöcken gefügter Heidenmauern und eingehauener
Treppenstufen an einem Felsen (Krappenfels). So mag denn der Ochsen-
stein ursprünglich ein Vorwerk der Wüstenbergbefestignng gewesen sein.
In der Geschichte taucht die Burg erst im 12. Jahrhundert auf zusammen
mit dem gleichnamigen Geschlechts. 1165 wird Ludwig von Ochsenstein
anläßlich eines Tnrnieres zu Zürich genannt, 1178 ein Burkhard von
Ochsenstein, 1217 erscheinen die Grafen als Besitzer der benachbarten
Burg Greifenstein. 1284 kommt es zu einer Zerstörung des Ochsensteines
durch Walter von Hohenstein, Unterlandvogt nn Elsaß. Wie weit die Zer-
störung gegangen ist, ob die Burg baldig wiederhergestellt wurde, läßt sich
nicht mehr feststellen: anzunehmen ist es. Im Verlauf des 13. Jahrhun-
derts treten die Ochsensteiner in die Reihe der ersten elsässischen Ge-
schlechter. Verwandtschaftliche Bande verknüpfen sie mit den Landgrafen
von Hessen, den Markgrafen von Baden und den Habsburgern. Beson-
ders ragt hervor die Person Ottos III. von Ochsenstein, eines Neffen Kaiser
Rudolfs. Als Landvogt im Elsaß zerstört er 1272 die Wegelnburg, belagert
1281 zusammen mit den Colmarern erfolgreich die Hohlandsburg und leitet
1293 die Zurückeroberung der Burg Ortenberg für die Habsburger. An-
läßlich dieses Unternehmens ließ Otto den Ortenberg benachbarten Ram-
stein als Stützpunkt für die Belagerer erbauen. Im gleichen Jahre ist er
bei der Einnahme der heute abgegangenen Tiefburg Wörth unweit
Matzenheim (in der Jllniederung zwischen Straßburg und Schlettstadt)
beteiligt. Nach einem Leben voll kriegerischer Tätigkeit fiel Otto III.
von Ochsenstein als Parteigenosse Albrechts von Österreich 1298 in der
Schlacht bei Göllheim. Schon Otto hatte als kaiserliches Lehen die Was-
gauschlösser Löwenstein und Landeck erhalten, im 14. Jahrhundert kom-
men zeitweilig als Besitz hinzu die Plixburg bei Colmar, HohenfelsZ und
Klein-Arnsberg im Wasgau sowie Schirmeck im Breuschtale. Um diese
Zeit scheint das Stammschloß dadurch erweitert worden zu sein, daß man
die beiden nördlich der Hauptburg befindlichen Felstürme ebenfalls be-
festigte und an ihrem Fuße mit einer Hofanlage umgab, wodurch die
später „Kleines Schloß" oder „Wachelheim" genannte Vorburg entstand
(vgl. unten sowie den Grundriß!). 1370 und 1382 taucht das „Kleine
Schloß" zum erstenmal in den Urkunden auf, wird aber gleich bei dieser
Gelegenheit als von den Straßburgern zerstört gemeldet. Vermutlich ist
aber dieser Burgteil später wiederhergestellt worden. Als das Geschlecht
derer von Ochsenstein 1485 ausstarb, wurden die verwandten Grafen von
Zweibrücken-Bitsch Herren der Burg. Um 1550 ließ Jakob von Zwei-
brücken die offenbar ein weiteres Mal zerstörte Hauptburg aufbauen, die
aber bald darauf durch einen Brand von neuem (zum drittenmal?) ein-
geäschert wurde. Trotzdem scheint das Schloß wenigstens teilweise wieder
instand gesetzt worden zu sein; es siel dann nach Erlöschen der Zwei-
brücker an die Hanau-Lichtenberg. 1632 erfolgte die letzte und endgültige
Zerstörung durch die Schweden. Die Ruinen befanden sich 1736 nn
Besitze der Fürsten von Hessen-Darmstadt, wurden später Staatseigentum
und 1878 zum klassifizierten geschichtlichen Denkmal erklärt. Durch wieder-
holte Erhaltungsarbeiten sind sie vor völligem Verfall geschützt.
0 Anmerkung: Vgl. Stolberg: „Burgruine Hohenfels im Wasgau", Burg-
wart Oktober 1917. Abb. 11. Burg Ochsenstein im Elsaß. Lageplan.