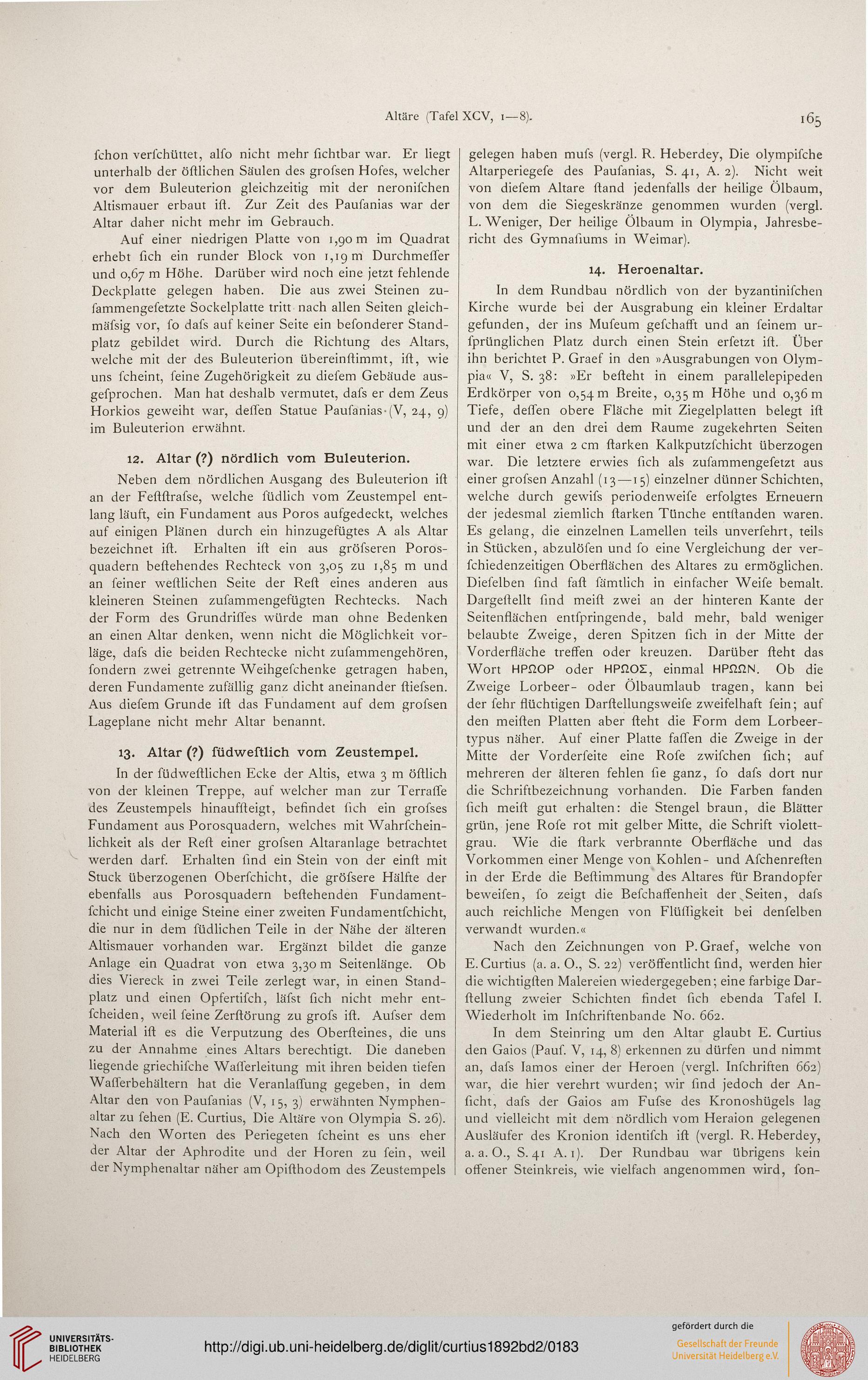Altäre (Tafel XCV, i—i
165
schon verschüttet, also nicht mehr sichtbar war. Er liegt
unterhalb der örtlichen Säulen des grossen Hoses, welcher
vor dem Buleuterion gleichzeitig mit der neronischen
Altismauer erbaut ist. Zur Zeit des Pausanias war der
Altar daher nicht mehr im Gebrauch.
Auf einer niedrigen Platte von 1,90 m im Quadrat
erhebt sich ein runder Block von 1,19 m Durchmesser
und 0,67 m Höhe. Darüber wird noch eine jetzt fehlende
Deckplatte gelegen haben. Die aus zwei Steinen zu-
sammengesetzte Sockelplatte tritt nach allen Seiten gleich-
mä'ssig vor, so dass auf keiner Seite ein besonderer Stand-
platz gebildet wird. Durch die Richtung des Altars,
welche mit der des Buleuterion übereinstimmt, ist, wie
uns scheint, seine Zugehörigkeit zu diesem Gebäude aus-
gesprochen. Man hat deshalb vermutet, dass er dem Zeus
Horkios geweiht war, dessen Statue Pausanias-(V, 24, 9)
im Buleuterion erwähnt.
12. Altar (?) nördlich vom Buleuterion.
Neben dem nördlichen Ausgang des Buleuterion ist
an der Feststrasse, welche südlich vom Zeustempel ent-
lang läuft, ein Fundament aus Porös aufgedeckt, welches
auf einigen Plänen durch ein hinzugefügtes A als Altar
bezeichnet ist. Erhalten ist ein aus grösseren Poros-
quadern bestehendes Rechteck von 3,05 zu 1,85 m und
an seiner weltlichen Seite der Rest eines anderen aus
kleineren Steinen zusammengefügten Rechtecks. Nach
der Form des Grundrisses würde man ohne Bedenken
an einen Altar denken, wenn nicht die Möglichkeit vor-
läge, dass die beiden Rechtecke nicht zusammengehören,
sondern zwei getrennte Weihgeschenke getragen haben,
deren Fundamente zufällig ganz dicht aneinander stiessen.
Aus diesem Grunde ist das Fundament auf dem grossen
Lageplane nicht mehr Altar benannt.
13. Altar (?) südwestlich vorn Zeustempel.
In der südwestlichen Ecke der Altis, etwa 3 m örtlich
von der kleinen Treppe, auf welcher man zur Terrasse
des Zeustempels hinauflteigt, befindet lieh ein grosses
Fundament aus Porosquadern, welches mit Wahrschein-
lichkeit als der Rest einer grossen Altaranlage betrachtet
werden darf. Erhalten sind ein Stein von der einst mit
Stuck überzogenen Oberschicht, die grössere Hälfte der
ebenfalls aus Porosquadern bestehenden Fundament-
schicht und einige Steine einer zweiten Fundamentschicht,
die nur in dem südlichen Teile in der Nähe der älteren
Altismauer vorhanden war. Ergänzt bildet die ganze
Anlage ein Quadrat von etwa 3,30 m Seitenlänge. Ob
dies Viereck in zwei Teile zerlegt war, in einen Stand-
platz und einen Opfertisch, lässt sich nicht mehr ent-
scheiden, weil seine Zerstörung zu gross ist. Ausser dem
Material ist es die Verputzung des Obersteines, die uns
zu der Annahme eines Altars berechtigt. Die daneben
liegende griechische WalTerleitung mit ihren beiden tiefen
Wasserbehältern hat die Veranlassung gegeben, in dem
Altar den von Pausanias (V, 1 5, 3) erwähnten Nymphen-
altar zu sehen (E. Curtius, Die Altäre von Olympia S. 26).
Nach den Worten des Periegeten scheint es uns eher
der Altar der Aphrodite und der Hören zu sein, weil
der Nymphenaltar näher am Opisthodom des Zeustempels
gelegen haben muss (vergl. R. Heberdey, Die olympische
Altarperiegese des Pausanias, S. 41, A. 2). Nicht weit
von diesem Altare stand jedenfalls der heilige Ölbaum,
von dem die Siegeskränze genommen wurden (vergl.
L. Weniger, Der heilige Ölbaum in Olympia, Jahresbe-
richt des Gymnasiums in Weimar).
14. Heroenaltar.
In dem Rundbau nördlich von der byzantinischen
Kirche wurde bei der Ausgrabung ein kleiner Erdaltar
gefunden, der ins Museum geschasft und an seinem ur-
sprünglichen Platz durch einen Stein ersetzt ist. Über
ihn berichtet P. Graef in den »Ausgrabungen von Olym-
pia« V, S. 38: »Er besteht in einem parallelepipeden
Erdkörper von 0,54m Breite, 0,35 m Höhe und 0,36m
Tiefe, dessen obere Fläche mit Ziegelplatten belegt ist
und der an den drei dem Räume zugekehrten Seiten
mit einer etwa 2 cm starken Kalkputzschicht überzogen
war. Die letztere erwies sich als zusammengesetzt aus
einer grossen Anzahl (13 —15) einzelner dünner Schichten,
welche durch gewiss periodenweise erfolgtes Erneuern
der jedesmal ziemlich starken Tünche entstanden waren.
Es gelang, die einzelnen Lamellen teils unversehrt, teils
in Stücken, abzulösen und so eine Vergleichung der ver-
schiedenzeitigen Oberssächen des Altares zu ermöglichen.
Dieselben sind fast sämtlich in einfacher Weise bemalt.
Dargestellt sind meist zwei an der hinteren Kante der
Seitenssächen entspringende, bald mehr, bald weniger
belaubte Zweige, deren Spitzen sich in der Mitte der
Vorderssäche trefsen oder kreuzen. Darüber sleht das
Wort HPssOP oder HPstOZ, einmal HPsssiN. Ob die
Zweige Lorbeer- oder Ölbaumlaub tragen, kann bei
der sehr ssüchtigen Darstellungsweise zweifelhaft sein; auf
den meisten Platten aber fleht die Form dem Lorbeer-
typus näher. Auf einer Platte fallen die Zweige in der
Mitte der Vorderseite eine Rose zwischen sich; auf
mehreren der älteren fehlen sie ganz, so dass dort nur
die Schriftbezeichnung vorhanden. Die Farben fanden
sich meist gut erhalten: die Stengel braun, die Blätter
grün, jene Rose rot mit gelber Mitte, die Schrift violett-
grau. Wie die stark verbrannte Oberssäche und das
Vorkommen einer Menge von Kohlen- und Aschenresten
in der Erde die Bestimmung des Altares für Brandopfer
beweisen, so zeigt die Beschasfenheit der„Seiten, dass
auch reichliche Mengen von Flüsligkeit bei denselben
verwandt wurden.«
Nach den Zeichnungen von P. Graef, welche von
E. Curtius (a.a.O., S. 22) veröfsentlicht sind, werden hier
die wichtigsten Malereien wiedergegeben; eine farbige Dar-
stellung zweier Schichten findet sieb ebenda Tafel I.
Wiederholt im Inschriftenbande No. 662.
In dem Steinring um den Altar glaubt E. Curtius
den Gaios (Paus. V, 14, 8) erkennen zu dürfen und nimmt
an, dass Iamos einer der Heroen (vergl. Inschriften 662)
war, die hier verehrt wurden; wir sind jedoch der An-
sicht, dass der Gaios am Fusse des Kronoshügels lag
und vielleicht mit dem nördlich vom Heraion gelegenen
Ausläufer des Kronion identisch ist (vergl. R. Heberdey,
a.a.O., S. 41 A. 1). Der Rundbau war übrigens kein
ofsener Steinkreis, wie vielfach angenommen wird, son-
165
schon verschüttet, also nicht mehr sichtbar war. Er liegt
unterhalb der örtlichen Säulen des grossen Hoses, welcher
vor dem Buleuterion gleichzeitig mit der neronischen
Altismauer erbaut ist. Zur Zeit des Pausanias war der
Altar daher nicht mehr im Gebrauch.
Auf einer niedrigen Platte von 1,90 m im Quadrat
erhebt sich ein runder Block von 1,19 m Durchmesser
und 0,67 m Höhe. Darüber wird noch eine jetzt fehlende
Deckplatte gelegen haben. Die aus zwei Steinen zu-
sammengesetzte Sockelplatte tritt nach allen Seiten gleich-
mä'ssig vor, so dass auf keiner Seite ein besonderer Stand-
platz gebildet wird. Durch die Richtung des Altars,
welche mit der des Buleuterion übereinstimmt, ist, wie
uns scheint, seine Zugehörigkeit zu diesem Gebäude aus-
gesprochen. Man hat deshalb vermutet, dass er dem Zeus
Horkios geweiht war, dessen Statue Pausanias-(V, 24, 9)
im Buleuterion erwähnt.
12. Altar (?) nördlich vom Buleuterion.
Neben dem nördlichen Ausgang des Buleuterion ist
an der Feststrasse, welche südlich vom Zeustempel ent-
lang läuft, ein Fundament aus Porös aufgedeckt, welches
auf einigen Plänen durch ein hinzugefügtes A als Altar
bezeichnet ist. Erhalten ist ein aus grösseren Poros-
quadern bestehendes Rechteck von 3,05 zu 1,85 m und
an seiner weltlichen Seite der Rest eines anderen aus
kleineren Steinen zusammengefügten Rechtecks. Nach
der Form des Grundrisses würde man ohne Bedenken
an einen Altar denken, wenn nicht die Möglichkeit vor-
läge, dass die beiden Rechtecke nicht zusammengehören,
sondern zwei getrennte Weihgeschenke getragen haben,
deren Fundamente zufällig ganz dicht aneinander stiessen.
Aus diesem Grunde ist das Fundament auf dem grossen
Lageplane nicht mehr Altar benannt.
13. Altar (?) südwestlich vorn Zeustempel.
In der südwestlichen Ecke der Altis, etwa 3 m örtlich
von der kleinen Treppe, auf welcher man zur Terrasse
des Zeustempels hinauflteigt, befindet lieh ein grosses
Fundament aus Porosquadern, welches mit Wahrschein-
lichkeit als der Rest einer grossen Altaranlage betrachtet
werden darf. Erhalten sind ein Stein von der einst mit
Stuck überzogenen Oberschicht, die grössere Hälfte der
ebenfalls aus Porosquadern bestehenden Fundament-
schicht und einige Steine einer zweiten Fundamentschicht,
die nur in dem südlichen Teile in der Nähe der älteren
Altismauer vorhanden war. Ergänzt bildet die ganze
Anlage ein Quadrat von etwa 3,30 m Seitenlänge. Ob
dies Viereck in zwei Teile zerlegt war, in einen Stand-
platz und einen Opfertisch, lässt sich nicht mehr ent-
scheiden, weil seine Zerstörung zu gross ist. Ausser dem
Material ist es die Verputzung des Obersteines, die uns
zu der Annahme eines Altars berechtigt. Die daneben
liegende griechische WalTerleitung mit ihren beiden tiefen
Wasserbehältern hat die Veranlassung gegeben, in dem
Altar den von Pausanias (V, 1 5, 3) erwähnten Nymphen-
altar zu sehen (E. Curtius, Die Altäre von Olympia S. 26).
Nach den Worten des Periegeten scheint es uns eher
der Altar der Aphrodite und der Hören zu sein, weil
der Nymphenaltar näher am Opisthodom des Zeustempels
gelegen haben muss (vergl. R. Heberdey, Die olympische
Altarperiegese des Pausanias, S. 41, A. 2). Nicht weit
von diesem Altare stand jedenfalls der heilige Ölbaum,
von dem die Siegeskränze genommen wurden (vergl.
L. Weniger, Der heilige Ölbaum in Olympia, Jahresbe-
richt des Gymnasiums in Weimar).
14. Heroenaltar.
In dem Rundbau nördlich von der byzantinischen
Kirche wurde bei der Ausgrabung ein kleiner Erdaltar
gefunden, der ins Museum geschasft und an seinem ur-
sprünglichen Platz durch einen Stein ersetzt ist. Über
ihn berichtet P. Graef in den »Ausgrabungen von Olym-
pia« V, S. 38: »Er besteht in einem parallelepipeden
Erdkörper von 0,54m Breite, 0,35 m Höhe und 0,36m
Tiefe, dessen obere Fläche mit Ziegelplatten belegt ist
und der an den drei dem Räume zugekehrten Seiten
mit einer etwa 2 cm starken Kalkputzschicht überzogen
war. Die letztere erwies sich als zusammengesetzt aus
einer grossen Anzahl (13 —15) einzelner dünner Schichten,
welche durch gewiss periodenweise erfolgtes Erneuern
der jedesmal ziemlich starken Tünche entstanden waren.
Es gelang, die einzelnen Lamellen teils unversehrt, teils
in Stücken, abzulösen und so eine Vergleichung der ver-
schiedenzeitigen Oberssächen des Altares zu ermöglichen.
Dieselben sind fast sämtlich in einfacher Weise bemalt.
Dargestellt sind meist zwei an der hinteren Kante der
Seitenssächen entspringende, bald mehr, bald weniger
belaubte Zweige, deren Spitzen sich in der Mitte der
Vorderssäche trefsen oder kreuzen. Darüber sleht das
Wort HPssOP oder HPstOZ, einmal HPsssiN. Ob die
Zweige Lorbeer- oder Ölbaumlaub tragen, kann bei
der sehr ssüchtigen Darstellungsweise zweifelhaft sein; auf
den meisten Platten aber fleht die Form dem Lorbeer-
typus näher. Auf einer Platte fallen die Zweige in der
Mitte der Vorderseite eine Rose zwischen sich; auf
mehreren der älteren fehlen sie ganz, so dass dort nur
die Schriftbezeichnung vorhanden. Die Farben fanden
sich meist gut erhalten: die Stengel braun, die Blätter
grün, jene Rose rot mit gelber Mitte, die Schrift violett-
grau. Wie die stark verbrannte Oberssäche und das
Vorkommen einer Menge von Kohlen- und Aschenresten
in der Erde die Bestimmung des Altares für Brandopfer
beweisen, so zeigt die Beschasfenheit der„Seiten, dass
auch reichliche Mengen von Flüsligkeit bei denselben
verwandt wurden.«
Nach den Zeichnungen von P. Graef, welche von
E. Curtius (a.a.O., S. 22) veröfsentlicht sind, werden hier
die wichtigsten Malereien wiedergegeben; eine farbige Dar-
stellung zweier Schichten findet sieb ebenda Tafel I.
Wiederholt im Inschriftenbande No. 662.
In dem Steinring um den Altar glaubt E. Curtius
den Gaios (Paus. V, 14, 8) erkennen zu dürfen und nimmt
an, dass Iamos einer der Heroen (vergl. Inschriften 662)
war, die hier verehrt wurden; wir sind jedoch der An-
sicht, dass der Gaios am Fusse des Kronoshügels lag
und vielleicht mit dem nördlich vom Heraion gelegenen
Ausläufer des Kronion identisch ist (vergl. R. Heberdey,
a.a.O., S. 41 A. 1). Der Rundbau war übrigens kein
ofsener Steinkreis, wie vielfach angenommen wird, son-