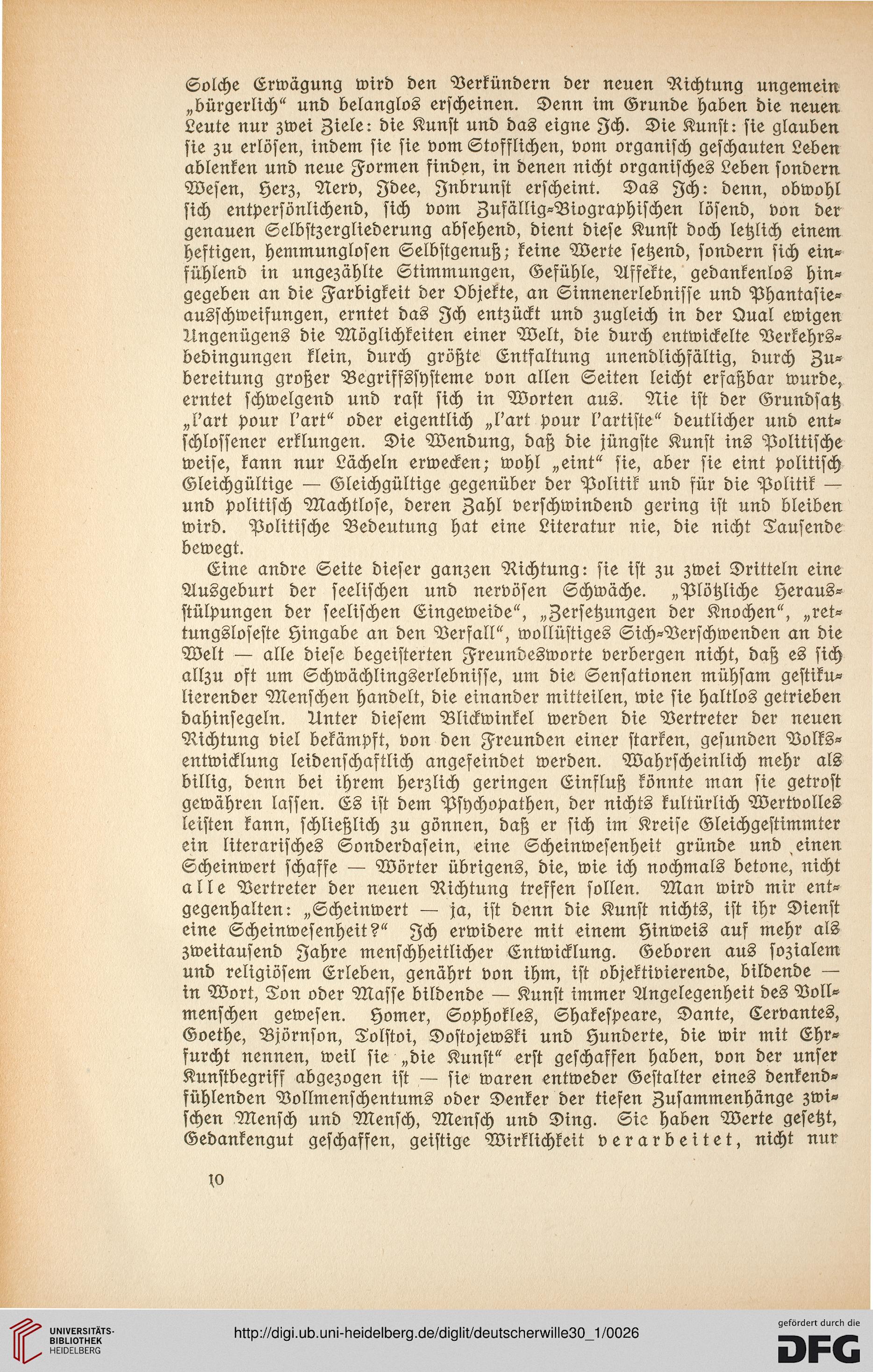Solche Erwägung wird den Verkündern der neuen Richtung ungerneirr
„bürgerlich" und belanglos erscheinen. Denn im Grunde haben die neuen
Leute nur zwei Ziele: die Kunst und das eigne Ich. Die Kunst: sie glauben
sie zu erlösen, indem sie sie vom StofflicheN) vom organisch geschauten Leben
ablenken und neue Formen finden, in denen nicht organisches Leben sondern
WeseN) tzerz, Nerv, Idee, Inbrunst erscheint. Das Ich: denn, obwohl
sich entpersönlichend, sich vom Zufällig-Biographischen lösend, von der
genauen Selbstzergliederung absehend, dient diese Kunst doch letzlich einem
heftigen, hemmunglosen Selbstgenuß; keine Werte setzend, sondern sich ein«
fühlend in ungezählte StimmungeN) Gefühle, Affekte) gedankenlos hin-
gegeben an die Farbigkeit der Objekte, an Sinnenerlebnisse und Phantasie-
ausschweifungeN) erntet das Ich entzückt und zugleich in der Qual ewigen
Ilngenügens die Möglichkeiten einer Welt, die durch entwickelte Verkehrs»
bedingungen klein, durch größte Entfaltung unendlichfältig) durch Zu--
bereitung großer Begriffssysteme von allen Seiten leicht erfaßbar wurde»
erntet schwelgend und rast sich in Worten aus. Me ist der Grundsatz
^l'art pour l'art" oder eigentlich „l'art pour l'artiste" deutlicher und ent«
schlossener erklungen. Die Wendung, daß die jüngste Kunst ins Politische
weise, kann nur LLcheln erwecken; wohl „eint" sie, aber sie eint politisch
Gleichgültige — Gleichgültige gegenüber der Politik und für die Politik —
und politisch Machtlose, deren Zahl verschwindend gering ist und bleiben
wird. Politische Bedeutung hat eine Literatur nie- die nicht Tausende
bewegt.
Eine andre Seite dieser ganzen Richtung: sie ist zu zwei Dritteln eine
Ausgeburt der seelischen und nervösen Schwäche. „Plötzliche tzeraus-
stülpungen der seelischen Eingeweide", „Zersetzungen der Knochen", „ret-
tungsloseste tzingabe an den Verfall", wollüstiges Sich-Verschwenden an die
Welt — alle diese begeisterten Freundesworte verbergen nicht, daß es sich
allzu oft um Schwächlingserlebnisse, um die Sensationen mühsam gestiku-
lierender Menschen handelt, die einander mitteilen, wie sie haltlos getrieben
dahinsegeln. Unter diesem Blickwinkel werden die Vertreter der neuen
Richtung viel bekämpft, von den Freunden einer starken, gesunden Volks-
entwicklung leidenschaftlich angefeindet werden. Wahrscheinlich mehr als
billig, denn bei ihrem herzlich geringen Einfluß könnte man sie getrost
gewähren lassen. Es ist dem Psychopathen, der nichts kultürlich Wertvolles
leisten kann, schließlich zu gönnen, daß er sich im Kreise Gleichgestimmter
ein literarisches Sonderdasein, eine Scheinwesenheit gründe und ^einen
Scheinwert schaffe — Wörter übrigens) die, wie ich nochmals betone, nicht
alle Vertreter der neuen Richtung Lreffen sollen. Man wird mir ent-
gegenhalten: „Scheinwert — ja, ist denn die Kunst nichts, ist ihr Dienst
eine Scheinwesenheit?" Ich erwidere mit einem tzinweis auf mehr als
zweitausend Iahre menschheitlicher Entwicklung. Geboren aus sozialem
und religiösem Erleben, genährt von ihm, ist objektivierende, bildende —
in Wort, Ton oder Masse bildende — Kunst immer Angelegenheit des Voll-
menschen gewesen. tzomer> Sophokles, Shakespeare, Dante, Cervantes,
Goethe, Björnson, Tolstoi, Dostojewski und tzunderte, die wir mit Ehr-
furcht nennen, weil sie „die Kunst" erst geschaffen haben, von der unser
Kunstbegriff abgezogen ist — sie waren entweder Gestalter eines denkend«
fühlenden Vollmenschentums oder Denker der tiefen Zusammenhänge zwi-
schen Mensch und Mensch, Mensch und Ding. Sie haben Werte gesetzt,
Gedankengut geschaffen, geistige Wirklichkeit verarbeitet, nicht nur
„bürgerlich" und belanglos erscheinen. Denn im Grunde haben die neuen
Leute nur zwei Ziele: die Kunst und das eigne Ich. Die Kunst: sie glauben
sie zu erlösen, indem sie sie vom StofflicheN) vom organisch geschauten Leben
ablenken und neue Formen finden, in denen nicht organisches Leben sondern
WeseN) tzerz, Nerv, Idee, Inbrunst erscheint. Das Ich: denn, obwohl
sich entpersönlichend, sich vom Zufällig-Biographischen lösend, von der
genauen Selbstzergliederung absehend, dient diese Kunst doch letzlich einem
heftigen, hemmunglosen Selbstgenuß; keine Werte setzend, sondern sich ein«
fühlend in ungezählte StimmungeN) Gefühle, Affekte) gedankenlos hin-
gegeben an die Farbigkeit der Objekte, an Sinnenerlebnisse und Phantasie-
ausschweifungeN) erntet das Ich entzückt und zugleich in der Qual ewigen
Ilngenügens die Möglichkeiten einer Welt, die durch entwickelte Verkehrs»
bedingungen klein, durch größte Entfaltung unendlichfältig) durch Zu--
bereitung großer Begriffssysteme von allen Seiten leicht erfaßbar wurde»
erntet schwelgend und rast sich in Worten aus. Me ist der Grundsatz
^l'art pour l'art" oder eigentlich „l'art pour l'artiste" deutlicher und ent«
schlossener erklungen. Die Wendung, daß die jüngste Kunst ins Politische
weise, kann nur LLcheln erwecken; wohl „eint" sie, aber sie eint politisch
Gleichgültige — Gleichgültige gegenüber der Politik und für die Politik —
und politisch Machtlose, deren Zahl verschwindend gering ist und bleiben
wird. Politische Bedeutung hat eine Literatur nie- die nicht Tausende
bewegt.
Eine andre Seite dieser ganzen Richtung: sie ist zu zwei Dritteln eine
Ausgeburt der seelischen und nervösen Schwäche. „Plötzliche tzeraus-
stülpungen der seelischen Eingeweide", „Zersetzungen der Knochen", „ret-
tungsloseste tzingabe an den Verfall", wollüstiges Sich-Verschwenden an die
Welt — alle diese begeisterten Freundesworte verbergen nicht, daß es sich
allzu oft um Schwächlingserlebnisse, um die Sensationen mühsam gestiku-
lierender Menschen handelt, die einander mitteilen, wie sie haltlos getrieben
dahinsegeln. Unter diesem Blickwinkel werden die Vertreter der neuen
Richtung viel bekämpft, von den Freunden einer starken, gesunden Volks-
entwicklung leidenschaftlich angefeindet werden. Wahrscheinlich mehr als
billig, denn bei ihrem herzlich geringen Einfluß könnte man sie getrost
gewähren lassen. Es ist dem Psychopathen, der nichts kultürlich Wertvolles
leisten kann, schließlich zu gönnen, daß er sich im Kreise Gleichgestimmter
ein literarisches Sonderdasein, eine Scheinwesenheit gründe und ^einen
Scheinwert schaffe — Wörter übrigens) die, wie ich nochmals betone, nicht
alle Vertreter der neuen Richtung Lreffen sollen. Man wird mir ent-
gegenhalten: „Scheinwert — ja, ist denn die Kunst nichts, ist ihr Dienst
eine Scheinwesenheit?" Ich erwidere mit einem tzinweis auf mehr als
zweitausend Iahre menschheitlicher Entwicklung. Geboren aus sozialem
und religiösem Erleben, genährt von ihm, ist objektivierende, bildende —
in Wort, Ton oder Masse bildende — Kunst immer Angelegenheit des Voll-
menschen gewesen. tzomer> Sophokles, Shakespeare, Dante, Cervantes,
Goethe, Björnson, Tolstoi, Dostojewski und tzunderte, die wir mit Ehr-
furcht nennen, weil sie „die Kunst" erst geschaffen haben, von der unser
Kunstbegriff abgezogen ist — sie waren entweder Gestalter eines denkend«
fühlenden Vollmenschentums oder Denker der tiefen Zusammenhänge zwi-
schen Mensch und Mensch, Mensch und Ding. Sie haben Werte gesetzt,
Gedankengut geschaffen, geistige Wirklichkeit verarbeitet, nicht nur