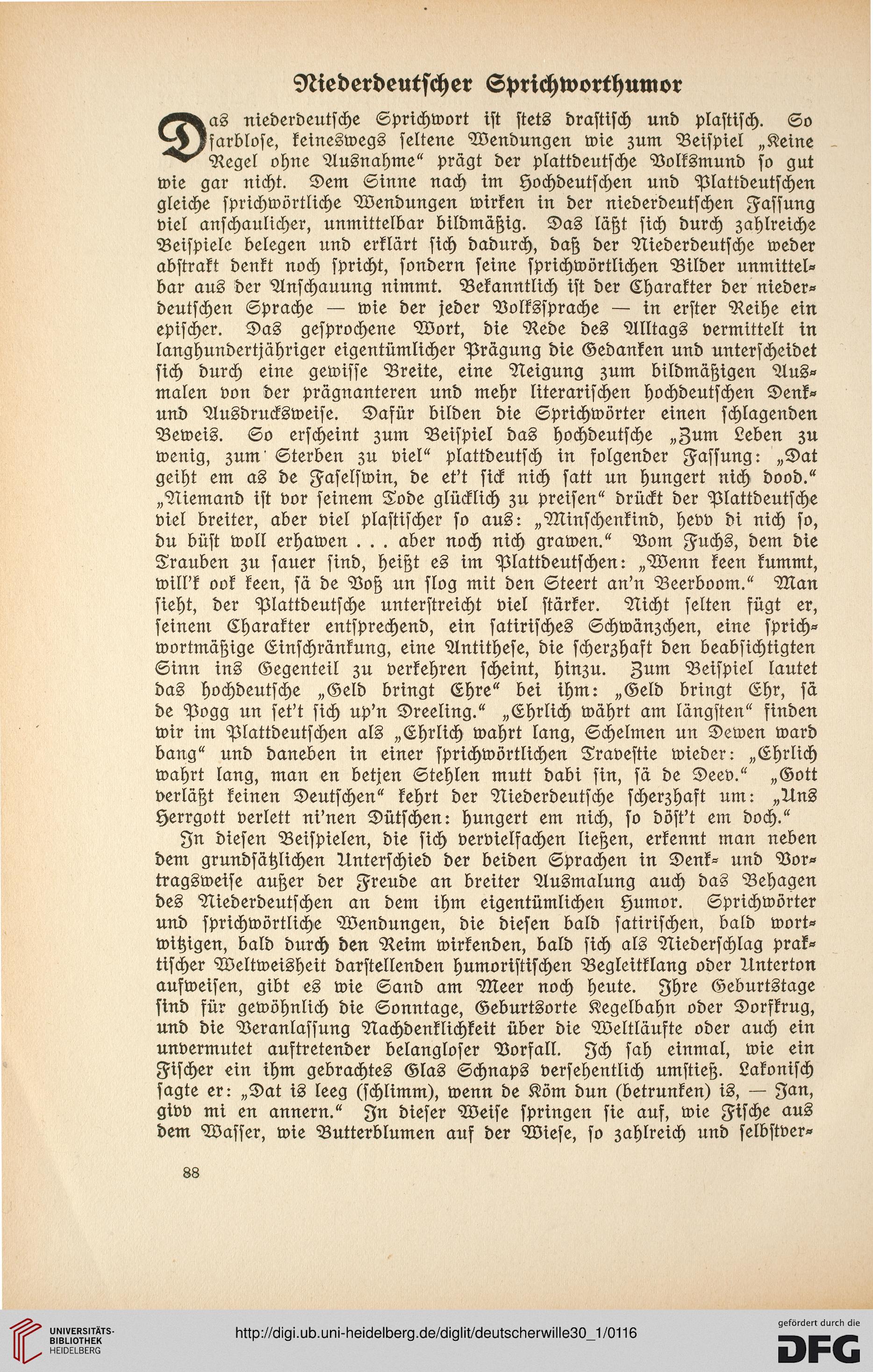Niederdeutscher Sprichworthumor
^V^as niederdeutsche Sprichwort ist stets drastisch und plastisch. So
^AIfarblose, keineswegs seltene Wendungen wie zum Beispiel „Keine -
ohne Ausnahme" prägt der plattdeutsche Volksmund so gut
wie gar nicht. Dem Sinne nach im tzochdeutschen und Plattdeutschen
gleiche sprichwörtliche Wendungen wirken in der niederdeutschen Fassung
viel anschaulicher, unmittelbar bildmäßig. Das läßt sich durch zahlreichr
Beispiele belegen und erklärt sich dadurch, daß der Niederdeutsche weder
abstrakt denkt noch spricht, sondern seine sprichwörtlichen Bilder unmittel--
bar aus der Bnschauung nimmt. Bekanntlich ist der Charakter der nieder--
deutschen Sprache — wie der jeder Volkssprache — in erster Reihe ein
epischer. Das gesprochene Wort, die Rede des Alltags vermittelt in
langhundertjähriger eigentümlicher Prägung die Gedanken und unterscheidet
sich durch eine gewisse Breite, eine Neigung zum bildmäßigen Aus-
malen von der prägnanteren und mehr literarischen hochdeutschen Denk-
und Ausdrucksweise. Dafür bilden die Sprichwörter einen schlagenden
Beweis. So erscheint zum Beispiel das hochdeutsche „Zum Leben zu
wenig, zum' Sterben zu viel" plattdeutsch in folgender Fassung: „Dat
geiht em as de Faselswin, de et't sick nich satt un hungert nich dood."
„Niemand ist vor seinem Tode glücklich zu preisen" drückt der Plattdeutsche
viel breiter, aber viel plastischer so aus: „Minschenkind, hevv di nich so,
du büst woll erhawen. . . aber noch nich grawen." Vom Fuchs, dem die
Trauben zu sauer sind, heißt es im Plattdeutschen: „Wenn keen kummt,
will'k ook keen, sä de Voß un slog mit den Steert an'n Beerboom." Man
sieht, der Plattdeutsche unterstreicht viel stärker. Nicht selten fügt er,
seinem Charakter entsprechend, ein satirisches Schwänzchen, eine sprich»
wortmäßige Einschränkung, eine Antithese, die scherzhaft den beabsichtigten
Sinn ins Gegenteil zu verkehren scheint, hinzu. Zum Beispiel lautet
das hochdeutsche „Geld bringt Ehre" bei ihm: „Geld bringt Ehr, sä
de Pogg un set't sich up'n Dreeling.^ „Ehrlich währt am längsten" finden
wir im Plattdeutschen als „Ehrlich wahrt lang, Schelmen un Dewen ward
bang" und daneben in einer sprichwörtlichen Travestie wieder: „Ehrlich
wahrt lang, man en betjen Stehlen mutt dabi sin, sä de Deev." „Gott
verläßt keinen Deutschen" kehrt der Niederdeutsche scherzhaft um: „Ans
tzerrgott verlett ni'nen Dütschen: hungert em nich, so döst't em doch."
In diesen Beispielen, die sich vervielfachen ließen, erkennt man neben
dem grundsätzlichen Unterschied der beiden Sprachen in Denk- und Vor-
tragsweise außer der Freude an breiter Ausmalung auch das Behagen
des Niederdeutschen an dem ihm eigentümlichen tzumor. Sprichwörter
und sprichwörtliche Wendungen, die diesen bald satirischen, bald wort-
witzigen, bald durch den Reim wirkenden, bald sich als Niederschlag prak-
tischer Weltweisheit darstellenden humoristischen Begleitklang oder Unterton
aufweisen, gibt es wie Sand am Meer noch heute. Ihre Geburtstage
sind für gewöhnlich die Sonntage, Geburtsorte Kegelbahn oder Dorfkrug,
und die Veranlassung Nachdenklichkeit über die Weltläufte oder auch ein
unvermutet auftretender belangloser Vorfall. Ich sah einmal, wie ein
Fischer ein ihm gebrachtes Glas Schnaps versehentlich umstieß. Lakonisch
sagte er: „Dat is leeg (schlimm), wenn de Köm dun (betrunken) is, — Ian,
givv mi en annern." In dieser Weise springen sie auf, wie Fische aus
dem Wasser, wie Butterblumen auf der Wiese, so zahlreich und selbstver-
88
^V^as niederdeutsche Sprichwort ist stets drastisch und plastisch. So
^AIfarblose, keineswegs seltene Wendungen wie zum Beispiel „Keine -
ohne Ausnahme" prägt der plattdeutsche Volksmund so gut
wie gar nicht. Dem Sinne nach im tzochdeutschen und Plattdeutschen
gleiche sprichwörtliche Wendungen wirken in der niederdeutschen Fassung
viel anschaulicher, unmittelbar bildmäßig. Das läßt sich durch zahlreichr
Beispiele belegen und erklärt sich dadurch, daß der Niederdeutsche weder
abstrakt denkt noch spricht, sondern seine sprichwörtlichen Bilder unmittel--
bar aus der Bnschauung nimmt. Bekanntlich ist der Charakter der nieder--
deutschen Sprache — wie der jeder Volkssprache — in erster Reihe ein
epischer. Das gesprochene Wort, die Rede des Alltags vermittelt in
langhundertjähriger eigentümlicher Prägung die Gedanken und unterscheidet
sich durch eine gewisse Breite, eine Neigung zum bildmäßigen Aus-
malen von der prägnanteren und mehr literarischen hochdeutschen Denk-
und Ausdrucksweise. Dafür bilden die Sprichwörter einen schlagenden
Beweis. So erscheint zum Beispiel das hochdeutsche „Zum Leben zu
wenig, zum' Sterben zu viel" plattdeutsch in folgender Fassung: „Dat
geiht em as de Faselswin, de et't sick nich satt un hungert nich dood."
„Niemand ist vor seinem Tode glücklich zu preisen" drückt der Plattdeutsche
viel breiter, aber viel plastischer so aus: „Minschenkind, hevv di nich so,
du büst woll erhawen. . . aber noch nich grawen." Vom Fuchs, dem die
Trauben zu sauer sind, heißt es im Plattdeutschen: „Wenn keen kummt,
will'k ook keen, sä de Voß un slog mit den Steert an'n Beerboom." Man
sieht, der Plattdeutsche unterstreicht viel stärker. Nicht selten fügt er,
seinem Charakter entsprechend, ein satirisches Schwänzchen, eine sprich»
wortmäßige Einschränkung, eine Antithese, die scherzhaft den beabsichtigten
Sinn ins Gegenteil zu verkehren scheint, hinzu. Zum Beispiel lautet
das hochdeutsche „Geld bringt Ehre" bei ihm: „Geld bringt Ehr, sä
de Pogg un set't sich up'n Dreeling.^ „Ehrlich währt am längsten" finden
wir im Plattdeutschen als „Ehrlich wahrt lang, Schelmen un Dewen ward
bang" und daneben in einer sprichwörtlichen Travestie wieder: „Ehrlich
wahrt lang, man en betjen Stehlen mutt dabi sin, sä de Deev." „Gott
verläßt keinen Deutschen" kehrt der Niederdeutsche scherzhaft um: „Ans
tzerrgott verlett ni'nen Dütschen: hungert em nich, so döst't em doch."
In diesen Beispielen, die sich vervielfachen ließen, erkennt man neben
dem grundsätzlichen Unterschied der beiden Sprachen in Denk- und Vor-
tragsweise außer der Freude an breiter Ausmalung auch das Behagen
des Niederdeutschen an dem ihm eigentümlichen tzumor. Sprichwörter
und sprichwörtliche Wendungen, die diesen bald satirischen, bald wort-
witzigen, bald durch den Reim wirkenden, bald sich als Niederschlag prak-
tischer Weltweisheit darstellenden humoristischen Begleitklang oder Unterton
aufweisen, gibt es wie Sand am Meer noch heute. Ihre Geburtstage
sind für gewöhnlich die Sonntage, Geburtsorte Kegelbahn oder Dorfkrug,
und die Veranlassung Nachdenklichkeit über die Weltläufte oder auch ein
unvermutet auftretender belangloser Vorfall. Ich sah einmal, wie ein
Fischer ein ihm gebrachtes Glas Schnaps versehentlich umstieß. Lakonisch
sagte er: „Dat is leeg (schlimm), wenn de Köm dun (betrunken) is, — Ian,
givv mi en annern." In dieser Weise springen sie auf, wie Fische aus
dem Wasser, wie Butterblumen auf der Wiese, so zahlreich und selbstver-
88