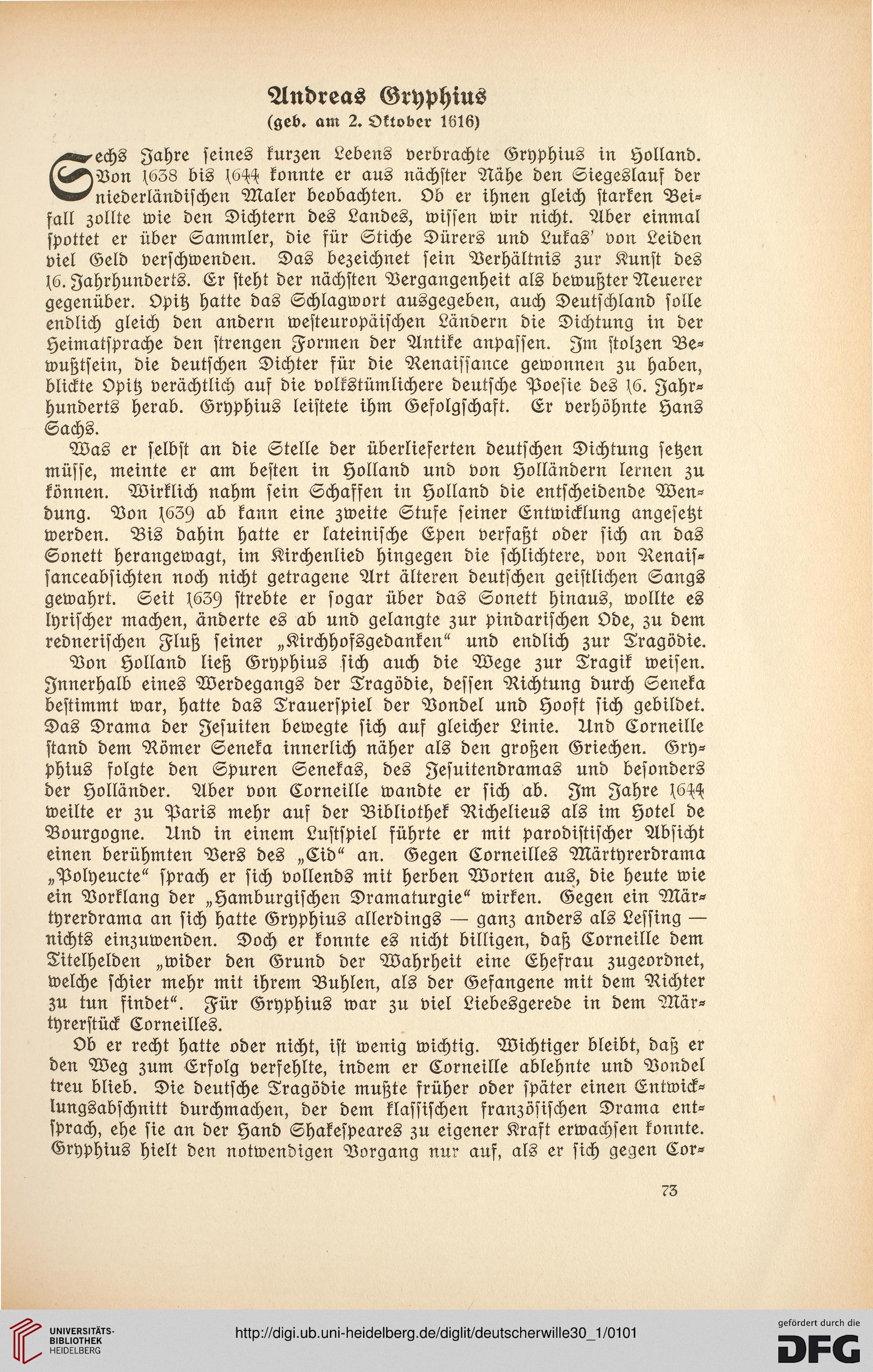Andreas Gryphius
(geb. am 2. Oktober 1616)
^^echs Iahre seines kurzen Lebens verbrachte Gryphius in Holland.
^^^Von (638 bis (6^ konnte er aus nächster Nähe den Siegeslauf der
^^niederländischen Maler beobachten. Ob er ihnen gleich starken Bei«
fall zollte wie den Dichtern des Landes, wissen wir nicht. Aber einmal
spottet er über Sammler, die für Stiche Dürers und Lukas' von Leiden
viel Geld verschwenden. Das bezeichnet sein Verhältnis zur Kunst des
(6. Iahrhunderts. Er steht der nächsten Vergangenheit als bewußter Neuerer
gegenüber. Opitz hatte das Schlagwort ausgegeben, auch Deutschland solle
endlich gleich den andern westeuropäischen Ländern die Dichtung in der
tzeimatsprache den strengen Formen der Antike anpassen. Im stolzen Be--
wußtseiN) die deutschen Dichter für die Renaissance gewonnen zu haben,
blickte Opitz verächtlich auf die volkstümlichere deutsche Poesie des (6. Iahr-
hunderts herab. Gryphius leistete ihm Gefolgschaft. Er verhöhnte Hans
Sachs.
Was er selbst an die Stelle der überlieferten deutschen Dichtung setzen
müsse, meinte er am besten in Holland und von tzolländern lernen zu
können. Wirklich nahm sein Schaffen in tzolland die entscheidende Wen-
dung. Von (63Y ab kann eine zweite Stufe seiner Entwicklung angesetzt
werden. Bis dahin hatte er kateinische Epen verfaßt oder sich an das
Sonett herangewagt, im Kirchenlied hingegen die schlichtere, von Renais--
sanceabsichten noch nicht getragene Art älteren deutschen geistlichen Sangs
gewahrt. Seit (639 strebte er sogar über das SoneLL hinaus, wollte es
lyrischer machen, änderte es ab und gelangte zur pindarischen Ode, zu dem
rednerischen Fluß seiner „Kirchhofsgedanken" und endlich zur Tragödie.
Von tzolland ließ Gryphius sich auch die Wege zur Tragik weisen.
Innerhalb eines Werdegangs der Tragödie, dessen Richtung durch Seneka
bestimmt war, hatte das Trauerspiel der Vondel und tzooft sich gebildet.
Das Drama der Iesuiten bewegte sich auf gleicher Linie. And Eorneille
stand dem Römer Seneka innerlrch näher als den großen Griechen. Gry-
phius folgte den Spuren Senekas, des Iesuitendramas und besonders
der Holländer. Aber von Corneille wandte er sich ab. Im Iahre (6^
weilte er zu Paris mehr auf der Bibliothek Richelieus als im tzotel de
Bourgogne. And in einem Lustspiel führte er mit parodistischer Absicht
einen berühmten Vers des „Eid" an. Gegen Eorneilles Märtyrerdrama
„Polyeucte" sprach er sich vollends mit herben Worten aus, die heute wie
ein Vorklang der „tzamburgischen Dramaturgie^ wirken. Gegen ein Mär«
tyrerdrama an sich hatte Gryphius allerdings — ganz anders als Lessing —
nichts einzuwenden. Doch er konnte es nicht billigen, daß Corneille dem
Titelhelden „wider den Grund der Wahrheit eine Ehefrau zugeordnet,
welche schier mehr mit ihrem Buhlen, als der Gefangene mit dem Richter
zu tun findet". Für Gryphius war zu viel Liebesgerede in dem Mär«
tyrerstück Corneilles.
Ob er recht hatte oder nicht, ist wenig wichtig. Wichtiger bleibt, daß er
den Weg zum Erfolg verfehlte, indem er Corneille ablehnte und Vondel
treu blieb. Die deutsche Tragödie mußte früher oder später einen Entwick--
lungsabschnitt durchmachen, der dem klassischen französischen Drama ent-
sprach, ehe sie an der Hand Shakespeares zu eigener Kraft erwachsen konnte.
Gryphius hielt den notwendigen Vorgang nur auf, als er sich gegen Cor-
73
(geb. am 2. Oktober 1616)
^^echs Iahre seines kurzen Lebens verbrachte Gryphius in Holland.
^^^Von (638 bis (6^ konnte er aus nächster Nähe den Siegeslauf der
^^niederländischen Maler beobachten. Ob er ihnen gleich starken Bei«
fall zollte wie den Dichtern des Landes, wissen wir nicht. Aber einmal
spottet er über Sammler, die für Stiche Dürers und Lukas' von Leiden
viel Geld verschwenden. Das bezeichnet sein Verhältnis zur Kunst des
(6. Iahrhunderts. Er steht der nächsten Vergangenheit als bewußter Neuerer
gegenüber. Opitz hatte das Schlagwort ausgegeben, auch Deutschland solle
endlich gleich den andern westeuropäischen Ländern die Dichtung in der
tzeimatsprache den strengen Formen der Antike anpassen. Im stolzen Be--
wußtseiN) die deutschen Dichter für die Renaissance gewonnen zu haben,
blickte Opitz verächtlich auf die volkstümlichere deutsche Poesie des (6. Iahr-
hunderts herab. Gryphius leistete ihm Gefolgschaft. Er verhöhnte Hans
Sachs.
Was er selbst an die Stelle der überlieferten deutschen Dichtung setzen
müsse, meinte er am besten in Holland und von tzolländern lernen zu
können. Wirklich nahm sein Schaffen in tzolland die entscheidende Wen-
dung. Von (63Y ab kann eine zweite Stufe seiner Entwicklung angesetzt
werden. Bis dahin hatte er kateinische Epen verfaßt oder sich an das
Sonett herangewagt, im Kirchenlied hingegen die schlichtere, von Renais--
sanceabsichten noch nicht getragene Art älteren deutschen geistlichen Sangs
gewahrt. Seit (639 strebte er sogar über das SoneLL hinaus, wollte es
lyrischer machen, änderte es ab und gelangte zur pindarischen Ode, zu dem
rednerischen Fluß seiner „Kirchhofsgedanken" und endlich zur Tragödie.
Von tzolland ließ Gryphius sich auch die Wege zur Tragik weisen.
Innerhalb eines Werdegangs der Tragödie, dessen Richtung durch Seneka
bestimmt war, hatte das Trauerspiel der Vondel und tzooft sich gebildet.
Das Drama der Iesuiten bewegte sich auf gleicher Linie. And Eorneille
stand dem Römer Seneka innerlrch näher als den großen Griechen. Gry-
phius folgte den Spuren Senekas, des Iesuitendramas und besonders
der Holländer. Aber von Corneille wandte er sich ab. Im Iahre (6^
weilte er zu Paris mehr auf der Bibliothek Richelieus als im tzotel de
Bourgogne. And in einem Lustspiel führte er mit parodistischer Absicht
einen berühmten Vers des „Eid" an. Gegen Eorneilles Märtyrerdrama
„Polyeucte" sprach er sich vollends mit herben Worten aus, die heute wie
ein Vorklang der „tzamburgischen Dramaturgie^ wirken. Gegen ein Mär«
tyrerdrama an sich hatte Gryphius allerdings — ganz anders als Lessing —
nichts einzuwenden. Doch er konnte es nicht billigen, daß Corneille dem
Titelhelden „wider den Grund der Wahrheit eine Ehefrau zugeordnet,
welche schier mehr mit ihrem Buhlen, als der Gefangene mit dem Richter
zu tun findet". Für Gryphius war zu viel Liebesgerede in dem Mär«
tyrerstück Corneilles.
Ob er recht hatte oder nicht, ist wenig wichtig. Wichtiger bleibt, daß er
den Weg zum Erfolg verfehlte, indem er Corneille ablehnte und Vondel
treu blieb. Die deutsche Tragödie mußte früher oder später einen Entwick--
lungsabschnitt durchmachen, der dem klassischen französischen Drama ent-
sprach, ehe sie an der Hand Shakespeares zu eigener Kraft erwachsen konnte.
Gryphius hielt den notwendigen Vorgang nur auf, als er sich gegen Cor-
73