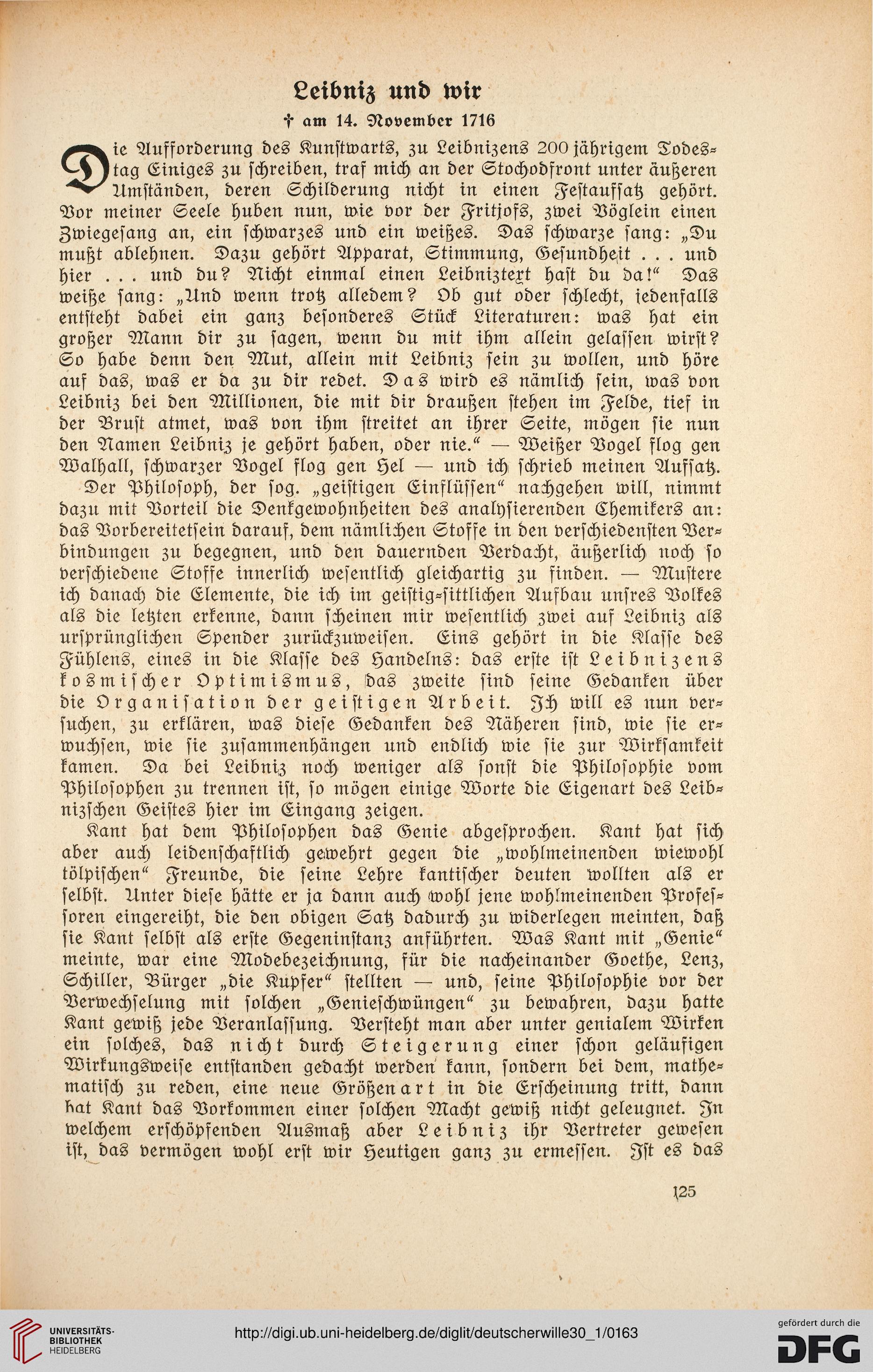Leibniz und wir
^ am 14. November 1716
^m^ie Aufforderung des Kunstwarts, zu Leibnizens 200jährigem Todes-
(^^^tag Einiges zu schreiben, traf mich an der Stochodfront unter äutzeren
AmständeN) deren Schilderung nicht in einen Festaufsatz gehört.
Vor meiner Seele huben nun, wie vor der Fritjofs, zwei Vöglein einen
Zwiegesang an, ein schwarzes und ein weißes. Das schwarze sang: „Du
mußt ablehnen. Dazu gehört Apparat, Stimmung, Gesundhezt . . . und
hier . . . und du? Nicht einmal einen Leibniztext hast du da!" Das
weiße sang: „And wenn trotz alledem? Ob gut oder schlecht, jedenfalls
entsteht dabei ein ganz besonderes Stück Literaturen: was hat ein
großer Mann dir zu sagen, wenn du mit ihm allein gelassen wirst?
So habe denn den Mut, allein mit Leibniz sein zu wollen, und höre
auf das, was er da zu dir redet. Das wird es nämlich sein, was von
Leibniz bei den Millionen, die mit dir draußen stehen im Felde, tief in
der Brust atmet, was von ihm streitet an ihrer Seite, mögen sie nun
den Namen Leibniz je gehört haben, oder nie." — Weißer Vogel flog gen
Walhall, schwarzer Vogel flog gen tzel — und ich schrieb meinen Aufsatz.
Der Philosoph, der sog. „geistigen Einflüssen" nachgehen will, nimmt
dazn mit Vorteil die Denkgewohnheiten des analysierenden Chemikers an:
das Vorbereitetsein darauf, dem nämlichen Stoffe in ben verschiedensten Ver-
bindungen zu begegnen, und den dauernden Verdacht, äußerlich noch so
verschiedene Stoffe innerlich wesentlich gleichartig zu finden. — Mustere
ich danach die Elemente, die ich im geistig-sittlichen Aufbau unsres Volkes
als die letzten erkenne, dann scheinen mir wesentlich zwei auf Leibniz als
ursprünglichen Spender zurückzuweisen. Eins gehört in die Klasse des
Fühlens, eines in die Klasse des tzandelns: das erste ist Leibnizens
kosmischer Optimismus, !das zweite sind seine Gedanken über
die Organisation der geistigen Arbeit. Ich will es nun ver-
suchen, zu erklären, was diese Gedanken des Näheren sind, wie sie er-
wuchsen, wie sie zusammenhängen und endlich wie sie zur Wirksamkeit
kamen. Da bei Leibniz noch weniger als sonst die Philosophie vom
Philosophen zu trennen ist, so mögen einige Worte die Ligenart des Leib-
nizschen Geistes hier im Eingang zeigen.
Kant hat dem Philosophen das Genie abgesprochen. Kant hat sich
aber auch leidenschaftlich gewehrt gegen die „wohlmeinenden wiewohl
tölpischen" Freunde, die seine Lehre kantischer deuten wollten als er
selbst. Nnter diese hätte er ja dann auch wohl jene wohlmeinenden Profes-
soren eingereiht, die den obigen Satz dadurch zu widerlegen meinten, daß
sie Kant selbst als erste Gegeninstanz anführten. Was Kant mit „Genie"
meinte, war eine Modebezeichnung, für die nacheinander Goethe, Lenz,
Schiller, Bürger „die Kupfer^ stellten — und, seine Philosophie vor der
Verwechselung mit solchen „Genieschwüngen" zu bewahren, dazu hatte
Kant gewiß jede Veranlassung. Versteht man aber unter genialem Wirken
ein solches, das nicht durch Steigerung einer schon geläufigen
Wirkungsweise entstanden gedacht werden kann, sondern bei dem, mathe-
matisch zu reden, eine neue Größenart in die Erscheinung tritt, dann
bat Kant das Vorkommen einer solchen Macht gewiß nicht geleugnet. In
welchem erschöpfenden Ausmaß aber Leibniz ihr Vertreter gewesen
ist, das vermögen wohl erst wir tzeutigen ganz zu ermessen. Ist es das
125
^ am 14. November 1716
^m^ie Aufforderung des Kunstwarts, zu Leibnizens 200jährigem Todes-
(^^^tag Einiges zu schreiben, traf mich an der Stochodfront unter äutzeren
AmständeN) deren Schilderung nicht in einen Festaufsatz gehört.
Vor meiner Seele huben nun, wie vor der Fritjofs, zwei Vöglein einen
Zwiegesang an, ein schwarzes und ein weißes. Das schwarze sang: „Du
mußt ablehnen. Dazu gehört Apparat, Stimmung, Gesundhezt . . . und
hier . . . und du? Nicht einmal einen Leibniztext hast du da!" Das
weiße sang: „And wenn trotz alledem? Ob gut oder schlecht, jedenfalls
entsteht dabei ein ganz besonderes Stück Literaturen: was hat ein
großer Mann dir zu sagen, wenn du mit ihm allein gelassen wirst?
So habe denn den Mut, allein mit Leibniz sein zu wollen, und höre
auf das, was er da zu dir redet. Das wird es nämlich sein, was von
Leibniz bei den Millionen, die mit dir draußen stehen im Felde, tief in
der Brust atmet, was von ihm streitet an ihrer Seite, mögen sie nun
den Namen Leibniz je gehört haben, oder nie." — Weißer Vogel flog gen
Walhall, schwarzer Vogel flog gen tzel — und ich schrieb meinen Aufsatz.
Der Philosoph, der sog. „geistigen Einflüssen" nachgehen will, nimmt
dazn mit Vorteil die Denkgewohnheiten des analysierenden Chemikers an:
das Vorbereitetsein darauf, dem nämlichen Stoffe in ben verschiedensten Ver-
bindungen zu begegnen, und den dauernden Verdacht, äußerlich noch so
verschiedene Stoffe innerlich wesentlich gleichartig zu finden. — Mustere
ich danach die Elemente, die ich im geistig-sittlichen Aufbau unsres Volkes
als die letzten erkenne, dann scheinen mir wesentlich zwei auf Leibniz als
ursprünglichen Spender zurückzuweisen. Eins gehört in die Klasse des
Fühlens, eines in die Klasse des tzandelns: das erste ist Leibnizens
kosmischer Optimismus, !das zweite sind seine Gedanken über
die Organisation der geistigen Arbeit. Ich will es nun ver-
suchen, zu erklären, was diese Gedanken des Näheren sind, wie sie er-
wuchsen, wie sie zusammenhängen und endlich wie sie zur Wirksamkeit
kamen. Da bei Leibniz noch weniger als sonst die Philosophie vom
Philosophen zu trennen ist, so mögen einige Worte die Ligenart des Leib-
nizschen Geistes hier im Eingang zeigen.
Kant hat dem Philosophen das Genie abgesprochen. Kant hat sich
aber auch leidenschaftlich gewehrt gegen die „wohlmeinenden wiewohl
tölpischen" Freunde, die seine Lehre kantischer deuten wollten als er
selbst. Nnter diese hätte er ja dann auch wohl jene wohlmeinenden Profes-
soren eingereiht, die den obigen Satz dadurch zu widerlegen meinten, daß
sie Kant selbst als erste Gegeninstanz anführten. Was Kant mit „Genie"
meinte, war eine Modebezeichnung, für die nacheinander Goethe, Lenz,
Schiller, Bürger „die Kupfer^ stellten — und, seine Philosophie vor der
Verwechselung mit solchen „Genieschwüngen" zu bewahren, dazu hatte
Kant gewiß jede Veranlassung. Versteht man aber unter genialem Wirken
ein solches, das nicht durch Steigerung einer schon geläufigen
Wirkungsweise entstanden gedacht werden kann, sondern bei dem, mathe-
matisch zu reden, eine neue Größenart in die Erscheinung tritt, dann
bat Kant das Vorkommen einer solchen Macht gewiß nicht geleugnet. In
welchem erschöpfenden Ausmaß aber Leibniz ihr Vertreter gewesen
ist, das vermögen wohl erst wir tzeutigen ganz zu ermessen. Ist es das
125