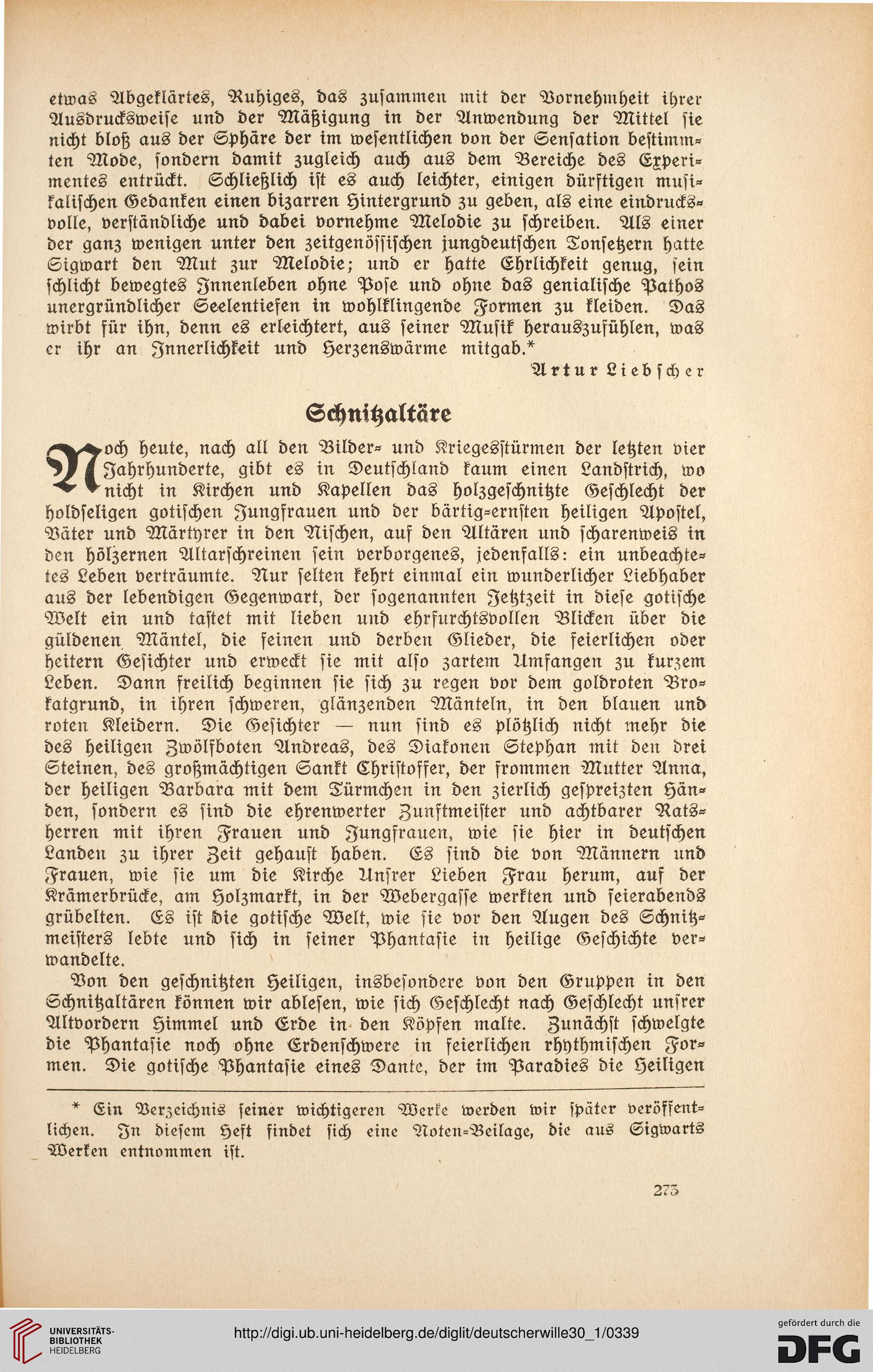etwas AbgekLärtes, Ruhrges, das zusammen mit der Vornehmheit ihrer
Ausdrucksweise und der Mäßigung in der Anwendung der Mittel sie
nicht bloß aus der Sphäre der im wesentlichen von der Sensation bestimm--
ten Mode, sondern damit zugleich auch aus dem Bereiche des (Lxperi-
mentes entrückt. Schließlich ist es auch leichter, einigen dürftigen musi«
kalischen Gedanken einen bizarren Hintergrund zu geben, als eine eindrucks«
volle, verständliche und dabei vornehme Melodie zu schreiben. Als einer
der ganz wenigen unter den zeitgenössischen jungdeutschen Tonsetzern hatte
Sigwart den Mut zur Melodie; und er hatte Ehrlichkeit genug, sein
schlicht bewegtes Innenleben ohne Pose und ohne das genialische Pathos
unergründlicher Seelentiefen in wohlklingende Formen zu kleiden. Das
wirbt für ihn, denn es erleichtert, aus seiner Musik herauszufühlen, was
cr ihr an Innerlichkeit und Herzenswärme mitgab/
Artur Liebscher
Schnitzaltöre
/-^^och heute, nach all den Bilder« und Kriegesstürmen der letzten vier
L Iahrhunderte, gibt es in Deutschland kaum einen Landstrich, wo
^ ^nicht in Kirchen und Kapellen das Holzgeschnitzte Geschlecht der
holdseligen gotischen Iungfrauen und der bärtig-ernsten heiligen Apostel,
Väter und Märtyrer in den Bischen, auf den Altären und scharenweis in
den hölzernen Altarschreinen sein verborgenes, jedenfalls: ein unbeachte-
tes Leben verträumte. Bur selten kehrt einmal ein wunderlicher Liebhaber
aus der lebendigen Gegenwart, der sogenannten Ietztzeit in diese gotische
Welt ein und tastet mit lieben und ehrfurchtsvollen Blicken über die
güldenen Mäntel, die feinen und derben Glieder, die feierlichen oder
heitern Gesichter und erweckt sie mit also zartem Umfangen zu kurzem
Leben. Dann freilich beginnen sie sich zu regen vor dem goldroten Bro-
katgrund, in ihren schweren, glänzenden Mänteln, in den blauen und
roten Kleidern. Die Gesichter — nun sind es plötzlich nicht mehr die
des heiligen Zwölfboten Andreas, des Diakonen Stephan mit den drei
Steinen, des großmächtigen Sankt Christoffer, der frommen Mutter Anna,
der heiligen Barbara mit dem Türmchen in den zierlich gespreizten tzän»
den, sondern es sind die ehrenwerter Aunftmeister und achtbarer Rats-
herren mit ihren Frauen und Iungfrauen, wie sie hier in deutschen
Landen zu ihrer Zeit gehaust haben. Es sind die von Männern und
Frauen, wie sie um die Kirche Unsrer Lieben Frau herum, auf der
Krämerbrücke, am tzolzmarkt, in der Webergasse werkten und seierabends
grübelten. Es ist die gotische Welt, wie sie vor den Augen des Schnitz-
meisters lebte und sich in seiner Phantasie in heilige Geschichte ver-
wandelte. ^
Von den geschnitzten tzeiligen, insbesondere von den Gruppen in den
Schnitzaltären können wir ablesen, wie sich Geschlecht nach Geschlecht unsrer
Altvordern tzimmel und Erde in den Köpfen malte. Zunächst schwelgte
die Phantasie noch ohne Erdenschwere in feierlichen rhythmischen For-
men. Die gotische Phantasie eines Dante, der im Paradies die tzeiligen
* Ein Verzeichnis feiner wichtigeren Werke werden wir später veröffent-
lichen. In diesem tzeft findet sich eine Aoten-Beilage, die aus Sigwarts
Werken entnommen ist.
272
Ausdrucksweise und der Mäßigung in der Anwendung der Mittel sie
nicht bloß aus der Sphäre der im wesentlichen von der Sensation bestimm--
ten Mode, sondern damit zugleich auch aus dem Bereiche des (Lxperi-
mentes entrückt. Schließlich ist es auch leichter, einigen dürftigen musi«
kalischen Gedanken einen bizarren Hintergrund zu geben, als eine eindrucks«
volle, verständliche und dabei vornehme Melodie zu schreiben. Als einer
der ganz wenigen unter den zeitgenössischen jungdeutschen Tonsetzern hatte
Sigwart den Mut zur Melodie; und er hatte Ehrlichkeit genug, sein
schlicht bewegtes Innenleben ohne Pose und ohne das genialische Pathos
unergründlicher Seelentiefen in wohlklingende Formen zu kleiden. Das
wirbt für ihn, denn es erleichtert, aus seiner Musik herauszufühlen, was
cr ihr an Innerlichkeit und Herzenswärme mitgab/
Artur Liebscher
Schnitzaltöre
/-^^och heute, nach all den Bilder« und Kriegesstürmen der letzten vier
L Iahrhunderte, gibt es in Deutschland kaum einen Landstrich, wo
^ ^nicht in Kirchen und Kapellen das Holzgeschnitzte Geschlecht der
holdseligen gotischen Iungfrauen und der bärtig-ernsten heiligen Apostel,
Väter und Märtyrer in den Bischen, auf den Altären und scharenweis in
den hölzernen Altarschreinen sein verborgenes, jedenfalls: ein unbeachte-
tes Leben verträumte. Bur selten kehrt einmal ein wunderlicher Liebhaber
aus der lebendigen Gegenwart, der sogenannten Ietztzeit in diese gotische
Welt ein und tastet mit lieben und ehrfurchtsvollen Blicken über die
güldenen Mäntel, die feinen und derben Glieder, die feierlichen oder
heitern Gesichter und erweckt sie mit also zartem Umfangen zu kurzem
Leben. Dann freilich beginnen sie sich zu regen vor dem goldroten Bro-
katgrund, in ihren schweren, glänzenden Mänteln, in den blauen und
roten Kleidern. Die Gesichter — nun sind es plötzlich nicht mehr die
des heiligen Zwölfboten Andreas, des Diakonen Stephan mit den drei
Steinen, des großmächtigen Sankt Christoffer, der frommen Mutter Anna,
der heiligen Barbara mit dem Türmchen in den zierlich gespreizten tzän»
den, sondern es sind die ehrenwerter Aunftmeister und achtbarer Rats-
herren mit ihren Frauen und Iungfrauen, wie sie hier in deutschen
Landen zu ihrer Zeit gehaust haben. Es sind die von Männern und
Frauen, wie sie um die Kirche Unsrer Lieben Frau herum, auf der
Krämerbrücke, am tzolzmarkt, in der Webergasse werkten und seierabends
grübelten. Es ist die gotische Welt, wie sie vor den Augen des Schnitz-
meisters lebte und sich in seiner Phantasie in heilige Geschichte ver-
wandelte. ^
Von den geschnitzten tzeiligen, insbesondere von den Gruppen in den
Schnitzaltären können wir ablesen, wie sich Geschlecht nach Geschlecht unsrer
Altvordern tzimmel und Erde in den Köpfen malte. Zunächst schwelgte
die Phantasie noch ohne Erdenschwere in feierlichen rhythmischen For-
men. Die gotische Phantasie eines Dante, der im Paradies die tzeiligen
* Ein Verzeichnis feiner wichtigeren Werke werden wir später veröffent-
lichen. In diesem tzeft findet sich eine Aoten-Beilage, die aus Sigwarts
Werken entnommen ist.
272